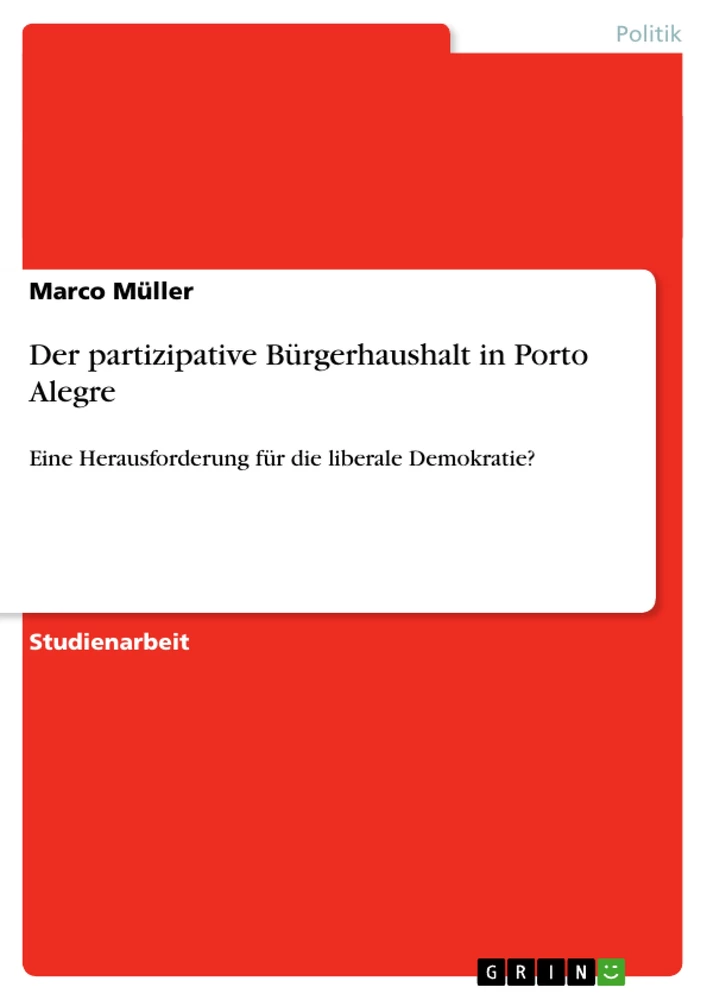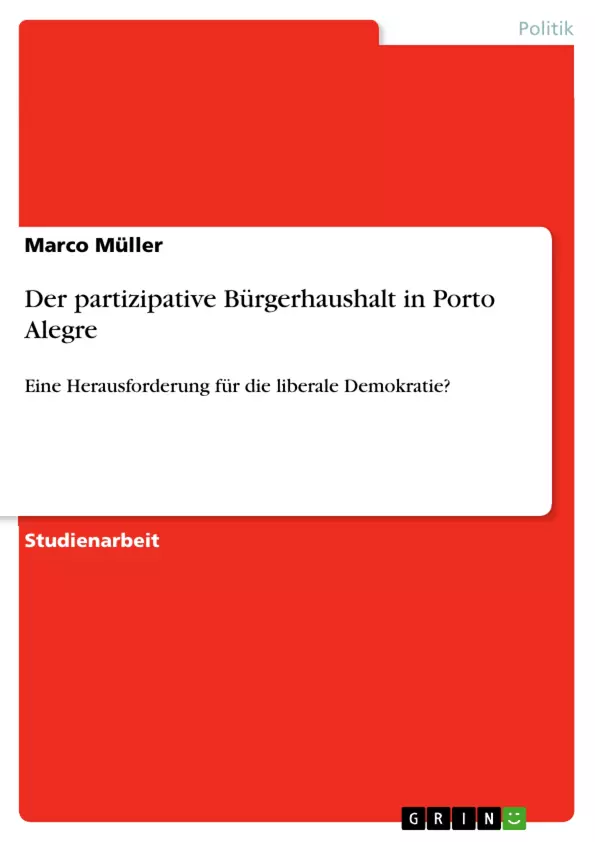Den Autor dieses Aufsatzes hat die Vorstellung von direkter Demokratie schon immer fasziniert. Mit direkter Demokratie ist damit ein Bild verknüpft, bei dem man Bürger über ihre gemeinsamen Angelegenheiten in einer aufgeschlossenen Art debattieren und entscheiden sieht. Natürlich spielt dabei ein Menschenbild eine Rolle, daß impliziert, das sich unterschiedliche Auffassungen und Interessen letztlich in Einklang bringen lassen, wenn man die richtigen Rahmenbedingungen schafft und die Akteure guten Willens sind.
In der Literatur gibt es unterschiedliche Einschätzungen von direkter Demokratie. Aber es gibt wohl auch einen gewissen common sense. So findet man beispielsweise weitverbreitete Argumente für und wider die direkte Demokratie, wenn man ein Handbuch der Demokratietheorie aufschlägt. (...) Die Vorteile direktdemokratischer Verfahren, die Waschkuhn nennt, sind eher mechanistischer Natur. Als einen solchen führt er beispielsweise die ´Erhöhung der Responsivität im politischen Prozeß´ (S. 509). an. Daher treffen sie nicht das, was für den Autor das Faszinosum des Themas ausmacht. Die Nachteile wiederum entbehren zugestandenermaßen nicht eines empirischen Gehalts. Doch ändert dies nichts an der Überzeugung des Autors. Da es dafür bisher aber keine handfesten Erfahrungen gab, konnte man sie höchstens als Vision deklarieren. Nun scheint es aber im Süden Brasiliens ein Modell der Bürgerbeteiligung zu geben, das oben genannten Einwänden dem ersten Anschein nach widerspricht. Denn dort entscheiden die Bürger in allen offenstehenden Versammlungen seit gut zehn Jahren selbst darüber, wie das Investitionsbudget der Stadt verwendet werden soll. In diesem Aufsatz soll daher nach einer Darstellung des Modells die den Zitaten zugrunde liegenden skeptischen Variante der Demokratietheorie im Vergleich mit einer dem Autor näher liegenden optimistischeren Variante in diesem konkreten Fallbeispiel einer Überprüfung unterzogen werden. Dazu müssen die beiden Theorieschulen erst einmal kurz expliziert werden, um die nötigen Hypothesen aufstellen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Theoretischer Hintergrund
- 1.1 Die skeptische Variante der Demokratietheorie
- 1.2 Die optimistische Position
- 1.3 Zusammenfassung
- 2. Der Hintergrund des Bürgerhaushaltes
- 2.1 Die politische Kultur Brasiliens
- 2.2 Die Stellung der Gemeinde im brasilianischen Staatsaufbau
- 2.3 Porto Alegre
- 2.3 Die Arbeiterpartei
- 3. Darstellung des Prozesses des Bürgerhaushaltes
- 4. Analyse
- 4.1 Zu 1. Welche Bürger nehmen Teil?
- 4.2 Zu 2. Zeigen sich Lerneffekte?
- 4.3 Zu 3. Wird der Prozeß von Eliten dominiert?
- 4.4 Zu 4. Sind die Ergebnisse angemessen?
- 4.5 Zu 5. Dienen die Entscheidungen dem Gemeinwohl?
- 4.6 Zu 6. Welche Stellung verbleibt dem Stadtrat?
- 4.7 Zu 7. Wird die OP als Gegenmacht instrumentalisiert?
- 4.8 Zu 8. Welche Wirkung hat die OP auf die Stadtgesellschaft?
- 5. Schlußbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den partizipativen Bürgerhaushalt in Porto Alegre und bewertet dessen Eignung als Modell für liberale Demokratien. Sie vergleicht dazu zwei gegensätzliche Demokratietheorien und analysiert, inwiefern der Bürgerhaushalt den Kritikpunkten an direkter Demokratie begegnet.
- Demokratietheorien (skeptisch vs. optimistisch)
- Partizipation der Bürger und deren Lerneffekte
- Einfluss von Eliten auf den Prozess
- Angemessenheit der Ergebnisse und Gemeinwohlorientierung
- Rolle des Stadtrates im Entscheidungsprozess
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt zwei gegensätzliche Demokratietheorien gegenüber: eine skeptische, die die Grenzen direkter Demokratie betont, und eine optimistischere, die Partizipation befürwortet. Das zweite Kapitel beschreibt den politischen Hintergrund in Brasilien und die Entstehung des Bürgerhaushaltes in Porto Alegre. Kapitel drei erläutert den Prozess des Bürgerhaushaltes selbst. Die Analyse in Kapitel vier untersucht verschiedene Aspekte des Prozesses, wie die Teilhabe der Bürger, Lerneffekte, den Einfluss von Eliten und die Angemessenheit der Ergebnisse.
Schlüsselwörter
Partizipativer Bürgerhaushalt, Porto Alegre, Direkte Demokratie, Repräsentative Demokratie, Demokratietheorie, Partizipation, Bürgerbeteiligung, Gemeinwohl, Eliten, Lerneffekte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein partizipativer Bürgerhaushalt?
Ein Verfahren der direkten Demokratie, bei dem Bürger direkt darüber entscheiden oder debattieren, wie Teile des Investitionsbudgets ihrer Stadt verwendet werden.
Warum ist das Modell von Porto Alegre so bekannt?
In Porto Alegre entscheiden Bürger seit über zehn Jahren erfolgreich in Versammlungen über das Budget, was als Gegenbeweis zu skeptischen Demokratietheorien gilt.
Welche Demokratietheorien werden in der Arbeit verglichen?
Die Arbeit stellt eine skeptische Variante (Betonung der Grenzen direkter Demokratie) einer optimistischen Variante (Befürwortung von Partizipation) gegenüber.
Werden Bürgerhaushalte von Eliten dominiert?
Die Analyse untersucht kritisch, ob tatsächlich alle Bürger teilnehmen oder ob der Prozess von bestimmten Interessengruppen oder Eliten gesteuert wird.
Welche Rolle bleibt dem Stadtrat bei einem Bürgerhaushalt?
Die Arbeit analysiert das Spannungsfeld zwischen der direkten Entscheidungsgewalt der Bürger und der verbleibenden legislativen Funktion des gewählten Stadtrates.
Gibt es Lerneffekte bei den teilnehmenden Bürgern?
Ja, ein Kernpunkt der Untersuchung ist, ob die Teilnahme am Haushaltsprozess das politische Verständnis und die Verantwortungsbereitschaft der Bürger fördert.
- Citar trabajo
- Diplom Sozialwissenschaftler Marco Müller (Autor), 2001, Der partizipative Bürgerhaushalt in Porto Alegre, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119461