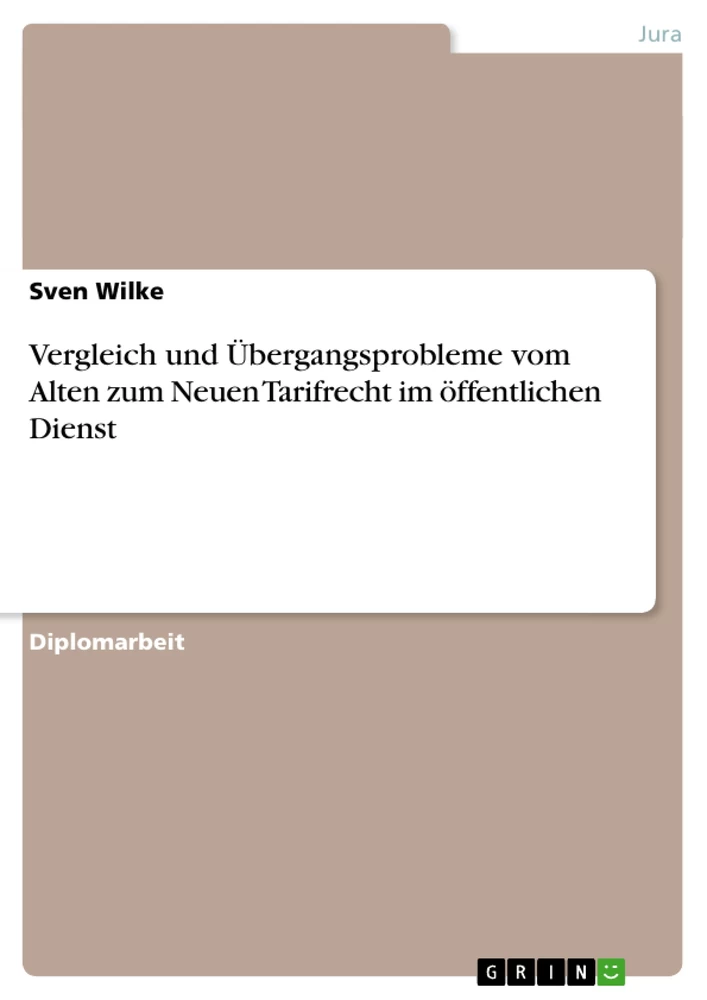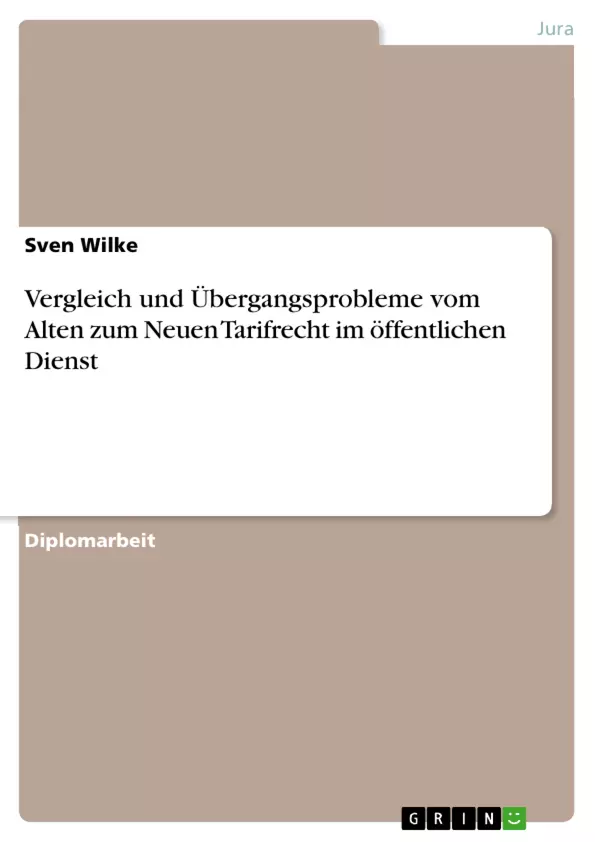In allen Epochen in der Entwicklung der modernen menschlichen Gesellschaft gibt es den historischen Nachweis, dass ein bestimmter Personenkreis im Auftrag des Herrschers bzw. später des Staates Aufgaben der Verwaltung, Aufrechterhaltung der Ordnung (Polizei) und Rechtssprechung auch in Zeiten von Kriegsereignissen, Naturkatastrophen oder anderen wirtschaftlichen bzw. sozialen Erschütterungen des Staates durch ihre loyale Haltung zum Staat garantierten, dass die wichtigsten Funktionen eines Staates trotz der Geschehnisse weiter aufrechterhalten werden konnten.
Der Soziologe Max Weber unterscheidet deshalb zwischen patrimonialen Beamten, die im wesentlichen dem jeweiligen Herrscher verpflichtet waren und den bürokratischen Beamten, die fest umrissenen Kompetenzen haben und an den Staat gebunden sind.
Im griechischen Staatswesen wurde erstmals festgestellt, dass Gesetze von Bürgern geschaffen werden und bestimmten sozialen Zielen dienen – damit wurde erstmals die Bedeutung von Gesetzen als Regelmechanismus im Staat formuliert.
Diese Grundsätze wurden im römischen Reich übernommen und weitergeführt. Nach dem Niedergang des römischen Reiches waren in Europa die patrimonialen Beamten, die dem jeweiligen Herrscher verpflichtet waren vorherrschend. Es gab jedoch auch Ausnahmen unter den Königreichen/ Fürstentümern. So wurde z. B. im staufischen Sizilien unter Friedrich II großen Wert auf ein straff organisiertes, weltliches Beamten-tum gelegt. Unter seiner Herrschaft gab es einen Verwaltungsapparat mit Berufsbeamten und einer Behördenverfassung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die einzelnen Tarifverträge
- 2.1. BAT
- 2.1.1. Struktur und Natur des BAT
- 2.1.2. Grundprinzipien / Besonderheiten
- 2.2. TVÖD
- 2.2.1. Struktur und Natur des TVÖD
- 2.2.2. Grundprinzipien / Besonderheiten
- 2.2.3. Genauere Darstellung der Leistungsentgeltsregelung des TVÖD und des Leistungstarifvertrages des Bundes
- 2.2.3.1. § 18 TVÖD-VKA
- 2.2.3.2. Leistungstarifvertrag des Bundes
- 2.2.4. Kritikpunkte
- 2.3. TVÜ
- 2.4. TV-L
- 3. Vergleich von BAT/TVÖD/TVÜ/TV-L
- 4. Stellungnahmen / Zielsetzungen / Standpunkte
- 4.1. von Ver.di.
- 4.2. der Arbeitgeber
- 4.3. Vergleich der jeweiligen Stellungnahmen
- 5. Ziele
- 5.1. Erreichte Ziele
- 5.2. Nicht-erreichte Ziele
- 5.3. Gründe für die Nicht-Erreichung der Ziele
- 6. Wesentliche Probleme der Überleitung und der Tarifreform und jeweilige Lösungsvorschläge
- 7. Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht den Vergleich und die Übergangsprobleme vom alten zum neuen Tarifrecht im öffentlichen Dienst. Sie analysiert die Strukturen und Besonderheiten der verschiedenen Tarifverträge (BAT, TVÖD, TVÜ, TV-L), vergleicht diese miteinander und beleuchtet die Stellungnahmen der beteiligten Parteien (Ver.di und Arbeitgeber).
- Vergleich der Tarifverträge BAT und TVÖD
- Analyse der Übergangsprobleme bei der Tarifreform
- Bewertung der Zielsetzungen der Tarifparteien
- Untersuchung der Stellungnahmen von Gewerkschaft und Arbeitgebern
- Auswertung der erreichten und nicht erreichten Ziele der Tarifreform
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung skizziert die historische Entwicklung des öffentlichen Dienstes und führt in die Thematik der Tarifreform ein. Kapitel 2 beschreibt detailliert die einzelnen Tarifverträge BAT und TVÖD, inklusive ihrer Strukturen, Prinzipien und Kritikpunkte. Kapitel 3 vergleicht die verschiedenen Tarifverträge. Kapitel 4 präsentiert die Standpunkte von Ver.di und den Arbeitgebern sowie einen Vergleich dieser Positionen. Kapitel 5 befasst sich mit den Zielen der Tarifreform und deren Erreichungsgrad. Kapitel 6 analysiert die Probleme während des Übergangs und Lösungsansätze.
Schlüsselwörter
Tarifrecht, öffentlicher Dienst, BAT, TVÖD, TVÜ, TV-L, Tarifreform, Übergangsprobleme, Ver.di, Arbeitgeber, Leistungsentgelt, Gehaltsfortzahlung.
- Citation du texte
- Sven Wilke (Auteur), 2007, Vergleich und Übergangsprobleme vom Alten zum Neuen Tarifrecht im öffentlichen Dienst, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119471