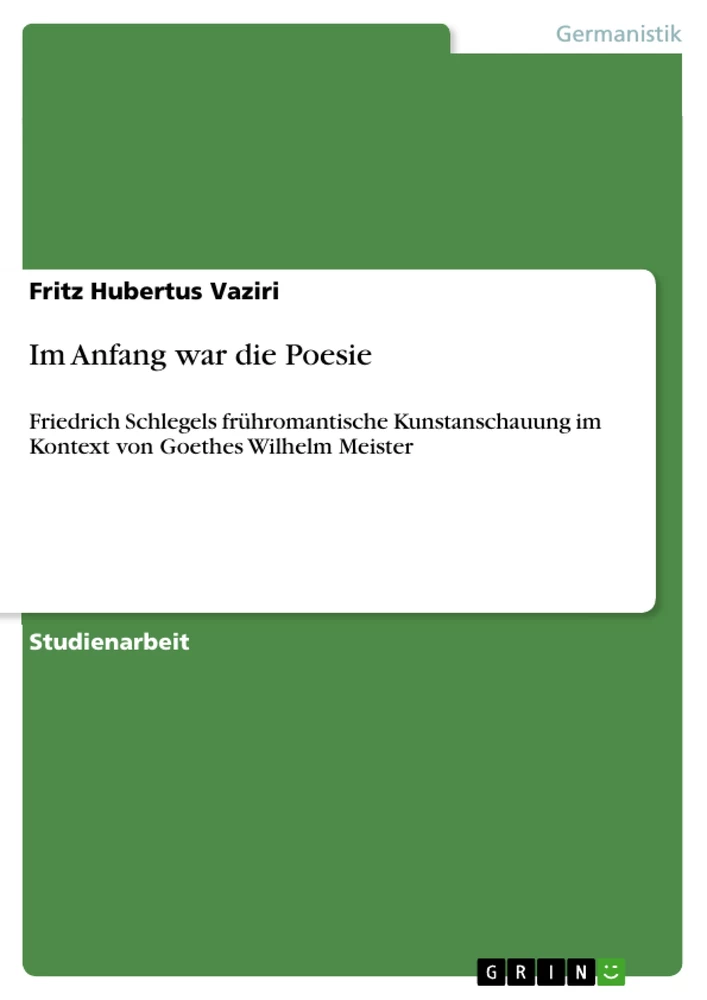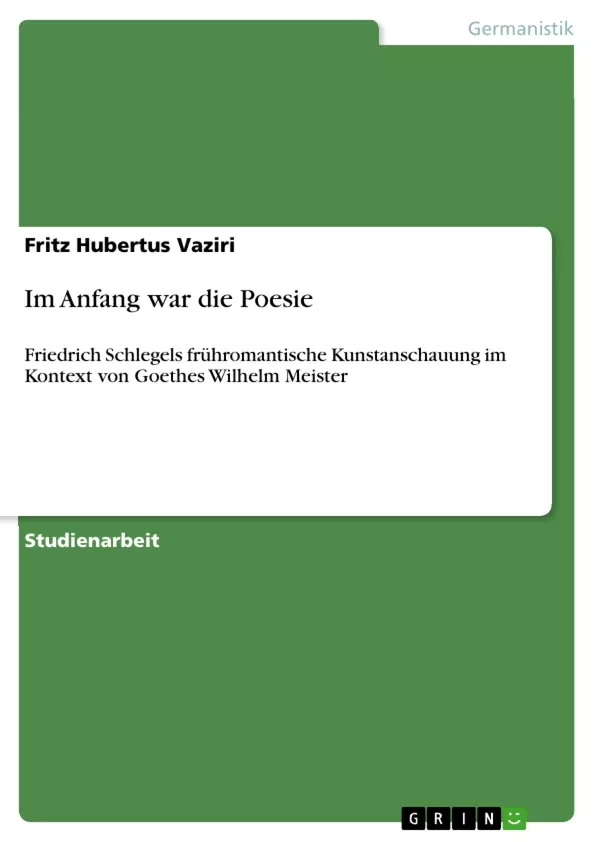Auch wenn SAFRANSKI das Ende der „große[n] Epoche der Romantik“ in den 20er Jahren des
19.Jahrhunderts sieht, ist noch fast zweihundert Jahre später zumindest im alltäglichen
Sprachgebrauch eine geradezu inflationäre Verwendung des Begriffes „Romantik“ und der
zugehörigen Wortfamilie zu beobachten – was wird nicht alles als „romantisch“ bezeichnet.
SAFRANSKI unterscheidet daher mit Recht zwischen Romantik als Epoche und als
Geisteshaltung, wobei Letztere für ihn in der Bezeichnung „das Romantische“ benannt ist, das
„in der Epoche der Romantik [seinen] vollkommenen Ausdruck“ gefunden habe.
Doch was eigentlich ist Romantik? Eine erschöpfende Antwort auf diese Frage kann auf den
folgenden Seiten kaum gelingen. Es soll allerdings der Versuch unternommen werden, ein
wenig unter die Oberfläche popularsprachlicher Verwendungen des Begriffs zu gelangen,
indem exemplarisch einige Texte der frühen Romantik in Augenschein genommen werden, in
denen nach PIKULIK „bereits der gesamte Bestand an Ideen, Tendenzen, Formen, Verfahren
und Motiven begründet wird […], auf dem auch die spätere Romantik beruht.“ Die im
Folgenden vorgenommene Auswahl beschränkt sich im Wesentlichen auf theoretische
Abhandlungen Friedrich Schlegels, des jüngeren der Gebrüder Schlegel, von denen es bei
FROMM heißt: „Wenn man von der deutschen Frühromantik spricht, dann ist man verpflichtet,
zumindest die Namen Friedrich und August Wilhelm von Schlegel […] zu nennen.“
Ausführungen des Letzteren, den man bisweilen ebenso wie seinen Bruder „zu den
theoretischen Köpfen“ der Frühromantik gerechnet hat,5 können bei den hier vorgenommenen
Untersuchungen nur in sehr begrenztem Maße berücksichtigt werden. Aber auch von den zu
Rate gezogenen Aufzeichnungen Friedrich Schlegels ist zu sagen, dass es in keiner Weise um
eine umfassende Darstellung von dessen komplexer Ästhetik und Philosophie mitsamt den für
deren Herausbildung bedeutsamen vielfältigen Einflüssen gehen kann. Lediglich einige
beispielhafte Äußerungen sind aufgeführt und erörtert.
Die Schlussteil der Arbeit ansatzweise behandelte Rezeption von Goethes Wilhelm Meister
gestattet zusätzliche Einblicke in die ästhetischen Auffassungen Friedrich Schlegels und soll
zur Veranschaulichung von dessen Poesiebegriffes einen weiteren Impuls für ein Verständnis
(früh)romantischer Kunstanschauung liefern.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Was ist Romantik?
- 2.1 Schlegels Ästhetik der Frühromantik
- 2.2 Das Schlegelsche Konzept einer progressiven Universalpoesie
- 2.3 Kernbegriffe
- 2.4 Der Roman als literarische Gattung der Moderne
- 3. Goethes Wilhelm Meister
- 4. Ende
- 5. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Friedrich Schlegels frühromantische Kunstanschauung im Kontext von Goethes Wilhelm Meister. Ziel ist es, Schlegels Ästhetik zu beleuchten und den Begriff der Romantik im frühen 19. Jahrhundert zu erörtern. Dabei wird der Fokus auf die theoretischen Abhandlungen Schlegels gelegt, um ein Verständnis seiner Poesiekonzeption im Kontext der Frühromantik zu entwickeln.
- Schlegels Ästhetik der Frühromantik und ihre zentralen Begriffe
- Das Konzept einer progressiven Universalpoesie
- Der Roman als literarische Gattung der Moderne
- Die Rezeption von Goethes Wilhelm Meister durch Schlegel
- Der Vergleich zwischen Klassik und Romantik
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die weitverbreitete und oft inflationäre Verwendung des Begriffs „Romantik“ im alltäglichen Sprachgebrauch und unterscheidet zwischen Romantik als Epoche und Geisteshaltung. Sie skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, der sich auf ausgewählte Texte der frühen Romantik, insbesondere Friedrich Schlegels, konzentriert, um ein tiefergehendes Verständnis des Begriffs zu entwickeln. Die Arbeit beschränkt sich dabei auf einige beispielhafte Äußerungen Schlegels und behandelt die Rezeption von Goethes Wilhelm Meister als zusätzlichen Einblick in dessen ästhetische Auffassungen.
2. Was ist Romantik?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition von Romantik. Es analysiert unterschiedliche Interpretationen des Begriffs, von Goethes Beschreibung der Romantik als „Krankes“ im Gegensatz zum „Gesunden“ der Klassik bis hin zu Novalis’ Betonung des Geheimnisvollen und Unendlichen. Es wird die religiöse Dimension der Romantik im Kontext des Christentums und des Mittelalters untersucht, sowie der Vergleich zur klassischen Kunst der Griechen und Römer, die sich durch eine „plastische Abbildung“ auszeichnet, während die romantische Kunst eine „esoterische Bedeutung“ beinhaltet. Die Entwicklung des Begriffs „romantisch“ von der Bezeichnung für den romanischen Sprachraum bis hin zu einem facettenreichen Leitbegriff der Frühromantik wird nachgezeichnet. Die Rolle der Athenäums-Fragmente als Manifeste der Frühromantik wird hervorgehoben.
2.1 Schlegels Ästhetik der Frühromantik: Dieses Kapitel analysiert die Problematik des Begriffs „Romantik“ als Epochenbegriff und beleuchtet die ästhetischen und philosophischen Arbeiten der Frühromantik als Einheit, trotz unterschiedlicher Verfahrensweisen ihrer Vertreter. Das gemeinsame Ziel einer umfassenden Synthese wird hervorgehoben, die die problematische Zeitsituation überwinden soll. Es wird außerdem darauf eingegangen, dass die Bezeichnung „romantisch“ um 1800 noch auf alle nachantike Kunst bezogen wurde, im Gegensatz zur allein als klassisch bezeichneten Antike. Friedrich Schlegels Versuch, Klassisches und Romantisches in einer umfassenderen Einheit zu verbinden, wird erwähnt.
Schlüsselwörter
Romantik, Frühromantik, Friedrich Schlegel, Goethe, Wilhelm Meister, Ästhetik, Universalpoesie, Klassik, Moderne, Religion, Athenäums-Fragmente.
Häufig gestellte Fragen zu: Frühromantische Kunstanschauung im Kontext von Goethes Wilhelm Meister
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht Friedrich Schlegels frühromantische Kunstanschauung im Kontext von Goethes Wilhelm Meister. Das Hauptziel ist es, Schlegels Ästhetik zu beleuchten und den Begriff der Romantik im frühen 19. Jahrhundert zu erörtern, wobei der Fokus auf Schlegels theoretischen Abhandlungen liegt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt zentrale Themen der Frühromantik, darunter Schlegels Ästhetik und ihre Kernbegriffe, das Konzept der progressiven Universalpoesie, den Roman als literarische Gattung der Moderne, die Rezeption von Goethes Wilhelm Meister durch Schlegel und einen Vergleich zwischen Klassik und Romantik.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Eine Einleitung, die den Begriff „Romantik“ kontextualisiert; ein Kapitel zur Definition von Romantik mit verschiedenen Interpretationen; ein Kapitel zu Schlegels Ästhetik der Frühromantik; ein Kapitel über Goethes Wilhelm Meister; und abschließend ein Literaturverzeichnis.
Was ist der methodische Ansatz der Arbeit?
Der methodische Ansatz konzentriert sich auf ausgewählte Texte der frühen Romantik, insbesondere Friedrich Schlegels, um ein tiefergehendes Verständnis des Begriffs „Romantik“ zu entwickeln. Die Arbeit analysiert Schlegels Schriften und untersucht die Rezeption von Goethes Wilhelm Meister als zusätzlichen Einblick in die ästhetischen Auffassungen der Zeit.
Wie wird der Begriff „Romantik“ definiert?
Die Arbeit differenziert zwischen Romantik als Epoche und Geisteshaltung. Sie untersucht verschiedene Interpretationen des Begriffs, von Goethe's Beschreibung bis hin zu Novalis' Betonung des Geheimnisvollen. Die Entwicklung des Begriffs von der Bezeichnung für den romanischen Sprachraum bis zu einem Leitbegriff der Frühromantik wird nachgezeichnet.
Welche Rolle spielt Friedrich Schlegel?
Friedrich Schlegel steht im Mittelpunkt der Arbeit. Seine ästhetischen und philosophischen Arbeiten werden analysiert, um seine Poesiekonzeption im Kontext der Frühromantik zu verstehen. Seine Versuche, Klassisches und Romantisches zu verbinden, werden ebenfalls beleuchtet.
Welche Bedeutung hat Goethes Wilhelm Meister?
Goethes Wilhelm Meister dient als Fallstudie, um Schlegels ästhetische Auffassungen und die Rezeption der Romantik zu beleuchten. Die Arbeit untersucht, wie Schlegel Goethes Werk rezipierte und in seine eigene ästhetische Theorie integrierte.
Welche Schlüsselbegriffe werden verwendet?
Schlüsselbegriffe sind: Romantik, Frühromantik, Friedrich Schlegel, Goethe, Wilhelm Meister, Ästhetik, Universalpoesie, Klassik, Moderne, Religion und Athenäums-Fragmente.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält Kapitelzusammenfassungen, die die einzelnen Kapitel und deren Inhalte kurz beschreiben. Diese Zusammenfassungen bieten einen Überblick über die wichtigsten Punkte jedes Kapitels.
- Quote paper
- Fritz Hubertus Vaziri (Author), 2008, Im Anfang war die Poesie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119495