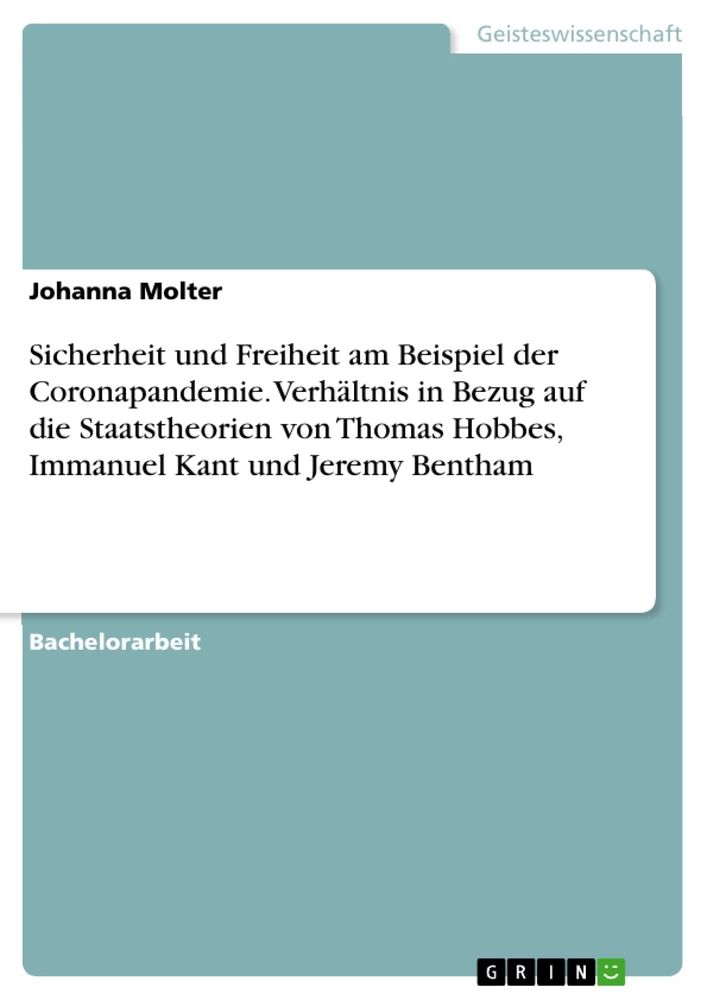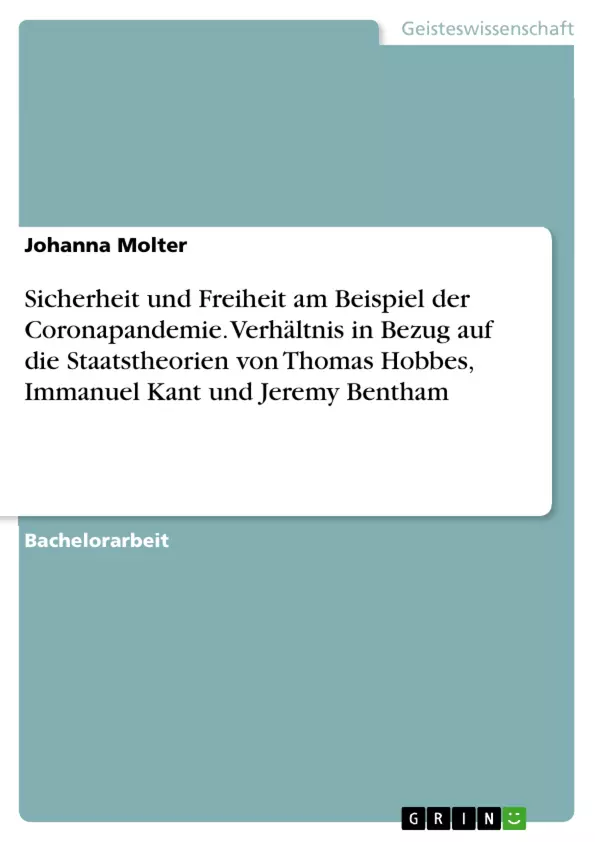Seit Beginn der Pandemie werfen Verordnungen immer wieder die Frage nach der Verhältnismäßigkeit zwischen Freiheit und Sicherheit auf. Mit genau diesem Dilemma beschäftigt sich die vorliegende Arbeit. Es wird untersucht, recherchiert, hinterfragt, kritisiert. Nach einer grundlegenden Begriffsbetrachtung von Freiheit und Sicherheit wird anschließend das Verhältnis beider in Bezug auf die Staatstheorien von Thomas Hobbes, Immanuel Kant und Jeremy Bentham gesetzt. Ausgehend von den grundlegenden Staatstheorien soll versucht werden eine Antwort zu finden, ob der Staat überhaupt in der Lage ist, Sicherheit und Freiheit zu vereinen, oder ob sich eben diese in einem gewissen Grad auf natürliche Weise ausschließen.
Die gesamte Diskussion orientiert sich dabei an dem Praxisbeispiel der Coronapandemie und erläutert anhand durch die Regierung beschlossenen Maßnahmen das Dilemma zwischen Sicherheit und Freiheit. Abschließend wird die aktuelle Thesenformulierung des Ethikrates hinzugefügt und in Verhältnis zu den Philosophen Hobbes, Kant und Bentham gesetzt. Am 28. Januar 2020 berichten die deutschen Nachrichten von einer Infektion eines Staatsbürger der Bundesrepublik Deutschland mit der Infektionskrankheit COVID. Eine Krankheit, derer Auswirkungen sich zu diesem Zeitpunkt noch kaum ein Zuschauer bewusst ist. Eine Krankheit, die eine gesellschaftliche und staatliche Krise auslösen wird, wie sie es bisher noch nie gegeben hat.
Eine Krankheit, derer Existenz zu einer Spaltung der Gesellschaft führen und die Politik vor moralisches Abwägen zwischen Sicherheit und Freiheit stellen wird. Die Coronakrise ist eine bis heute anhaltende Krise, derer Diskurs weit über die Medizin hinaus bestimmt wird. Unter anderem findet auch die Philosophie ihren Platz und muss demnach an politischen Entscheidungen teilhaben und die Lage analysieren. Vertreten durch den deutschen Ethikrat liegt der Forschungsschwerpunkt in diesem Bereich in besonderem auf dem moralischen Abwägen der politischen Verordnungen im Zuge der Pandemie.
Inhaltsverzeichnis
- Untersuchungsgegenstand
- Definitionen
- Der Versuch einer Definition: Freiheit
- Der Versuch einer Definition: Sicherheit
- Theorien in Bezug auf Sicherheit und Freiheit
- Thomas Hobbes
- Immanuel Kant
- Jeremy Bentham
- Vergleich der Theorien von Hobbes, Kant und Bentham
- Der erste Lockdown
- Das Dilemma des Kontaktverbotes
- Sichtweise des Thomas Hobbes
- Sichtweise des Jeremy Bentham
- Sichtweise des Immanuel Kant
- Empfehlung des Ethikrates
- Lösungsansatz: Freiheit und Sicherheit vereinen
- Möglichkeiten, der Coronakrise moralisch gerecht zu werden
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Spannungsfeld zwischen Freiheit und Sicherheit im Kontext der Coronapandemie. Sie analysiert, wie politische Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie die individuellen Freiheiten einschränken und gleichzeitig die Sicherheit der Bevölkerung gewährleisten sollen. Die Arbeit befasst sich mit der ethischen Dimension dieser Abwägung und hinterfragt die Vereinbarkeit von Freiheit und Sicherheit anhand philosophischer Theorien.
- Definition und Abgrenzung der Begriffe „Freiheit“ und „Sicherheit“
- Analyse der ethischen Positionen von Hobbes, Kant und Bentham zum Thema Freiheit und Sicherheit
- Bewertung der staatlichen Maßnahmen im ersten Lockdown unter ethischen Gesichtspunkten
- Untersuchung des Dilemmas zwischen Freiheit und Sicherheit in der Coronakrise
- Suche nach einem Lösungsansatz zur Vereinbarkeit von Freiheit und Sicherheit
Zusammenfassung der Kapitel
Untersuchungsgegenstand: Die Arbeit untersucht das ethische Dilemma zwischen Freiheit und Sicherheit, ausgelöst durch die Coronapandemie und die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus. Sie fokussiert sich auf den ersten Lockdown und die damit verbundenen Einschränkungen der individuellen Freiheit. Die Autorin analysiert die Problematik anhand philosophischer Theorien und der Stellungnahme des Deutschen Ethikrates.
Definitionen: Dieses Kapitel widmet sich der Definition von "Freiheit" und "Sicherheit". Es beleuchtet verschiedene philosophische und gesellschaftliche Perspektiven auf den Begriff der Freiheit, unterscheidet zwischen negativer und positiver Freiheit, und thematisiert die Komplexität des Begriffs. Die Definition von Sicherheit wird ebenfalls erörtert, unter Berücksichtigung von objektiven und subjektiven Sicherheitsbedrohungen. Die Kapitel diskutiert verschiedene Studien und Definitionen zu den beiden Begriffen und veranschaulicht deren Vielschichtigkeit und Uneindeutigkeit.
Theorien in Bezug auf Sicherheit und Freiheit: Dieses Kapitel stellt die ethischen Theorien von Thomas Hobbes, Immanuel Kant und Jeremy Bentham vor und analysiert deren jeweilige Positionen bezüglich der Beziehung zwischen Freiheit und Sicherheit. Die unterschiedlichen Ansätze der drei Denker werden im Detail erläutert und miteinander verglichen, um ein breites Spektrum an ethischen Perspektiven auf das zentrale Thema zu bieten.
Der erste Lockdown: Dieses Kapitel beleuchtet die konkreten Maßnahmen des ersten Lockdowns und deren Auswirkungen auf die Bevölkerung. Es analysiert die politischen Entscheidungen und stellt diese in den Kontext der vorhergehenden Kapitel.
Das Dilemma des Kontaktverbotes: Hier werden die staatlichen Maßnahmen des ersten Lockdowns, speziell das Kontaktverbot, unter dem Blickwinkel der ethischen Positionen von Hobbes, Kant und Bentham analysiert. Die verschiedenen philosophischen Perspektiven ermöglichen eine differenzierte Beurteilung der Verhältnismäßigkeit und der ethischen Tragweite dieser Maßnahmen.
Empfehlung des Ethikrates: Das Kapitel stellt die Stellungnahme des Deutschen Ethikrates zum Thema Freiheit und Sicherheit in der Pandemie dar und analysiert dessen Empfehlungen im Lichte der zuvor präsentierten philosophischen Theorien. Es bewertet die konkreten Vorschläge und deren Auswirkung auf die Abwägung von Freiheit und Sicherheit.
Schlüsselwörter
Freiheit, Sicherheit, Coronakrise, Lockdown, Ethik, Thomas Hobbes, Immanuel Kant, Jeremy Bentham, Deutscher Ethikrat, Verhältnismäßigkeit, Pandemie, Grundrechte, ethische Abwägung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Spannungsfeld Freiheit und Sicherheit in der Coronakrise
Was ist der Untersuchungsgegenstand der Arbeit?
Die Arbeit untersucht das ethische Dilemma zwischen Freiheit und Sicherheit, welches durch die Coronapandemie und die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus entstanden ist. Der Fokus liegt dabei auf dem ersten Lockdown und den damit verbundenen Einschränkungen der individuellen Freiheit. Die Analyse erfolgt anhand philosophischer Theorien und der Stellungnahme des Deutschen Ethikrates.
Welche Begriffe werden definiert und abgegrenzt?
Die Arbeit definiert und grenzt die Begriffe "Freiheit" und "Sicherheit" ab. Sie beleuchtet verschiedene philosophische und gesellschaftliche Perspektiven auf den Begriff der Freiheit (inklusive negativer und positiver Freiheit), und thematisiert die Komplexität des Begriffs. Die Definition von Sicherheit wird ebenfalls erörtert, unter Berücksichtigung von objektiven und subjektiven Sicherheitsbedrohungen. Verschiedene Studien und Definitionen werden diskutiert, um die Vielschichtigkeit und Uneindeutigkeit der Begriffe zu veranschaulichen.
Welche philosophischen Theorien werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert die ethischen Theorien von Thomas Hobbes, Immanuel Kant und Jeremy Bentham bezüglich der Beziehung zwischen Freiheit und Sicherheit. Die unterschiedlichen Ansätze der drei Denker werden detailliert erläutert und miteinander verglichen, um ein breites Spektrum an ethischen Perspektiven zu bieten.
Wie werden die Maßnahmen des ersten Lockdowns bewertet?
Die konkreten Maßnahmen des ersten Lockdowns und deren Auswirkungen auf die Bevölkerung werden beleuchtet. Die politischen Entscheidungen werden analysiert und in den Kontext der vorhergehenden Kapitel gestellt. Besonders das Kontaktverbot wird unter dem Blickwinkel der ethischen Positionen von Hobbes, Kant und Bentham analysiert, um die Verhältnismäßigkeit und ethische Tragweite zu beurteilen.
Welche Rolle spielt der Deutsche Ethikrat?
Die Stellungnahme des Deutschen Ethikrates zum Thema Freiheit und Sicherheit in der Pandemie wird dargestellt und im Lichte der präsentierten philosophischen Theorien analysiert. Die konkreten Vorschläge des Ethikrates und deren Auswirkung auf die Abwägung von Freiheit und Sicherheit werden bewertet.
Welchen Lösungsansatz bietet die Arbeit?
Die Arbeit sucht nach einem Lösungsansatz zur Vereinbarkeit von Freiheit und Sicherheit und untersucht Möglichkeiten, der Coronakrise moralisch gerecht zu werden. Die detaillierten Lösungsansätze sind im Text selbst nachzulesen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Freiheit, Sicherheit, Coronakrise, Lockdown, Ethik, Thomas Hobbes, Immanuel Kant, Jeremy Bentham, Deutscher Ethikrat, Verhältnismäßigkeit, Pandemie, Grundrechte, ethische Abwägung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet Kapitel zu folgenden Themen: Untersuchungsgegenstand, Definitionen (Freiheit und Sicherheit), Theorien (Hobbes, Kant, Bentham), Der erste Lockdown, Das Dilemma des Kontaktverbotes (unter Berücksichtigung der drei Philosophen), Empfehlung des Ethikrates, Lösungsansatz: Freiheit und Sicherheit vereinen, und Möglichkeiten, der Coronakrise moralisch gerecht zu werden.
- Citar trabajo
- Johanna Molter (Autor), 2022, Sicherheit und Freiheit am Beispiel der Coronapandemie. Verhältnis in Bezug auf die Staatstheorien von Thomas Hobbes, Immanuel Kant und Jeremy Bentham, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1194966