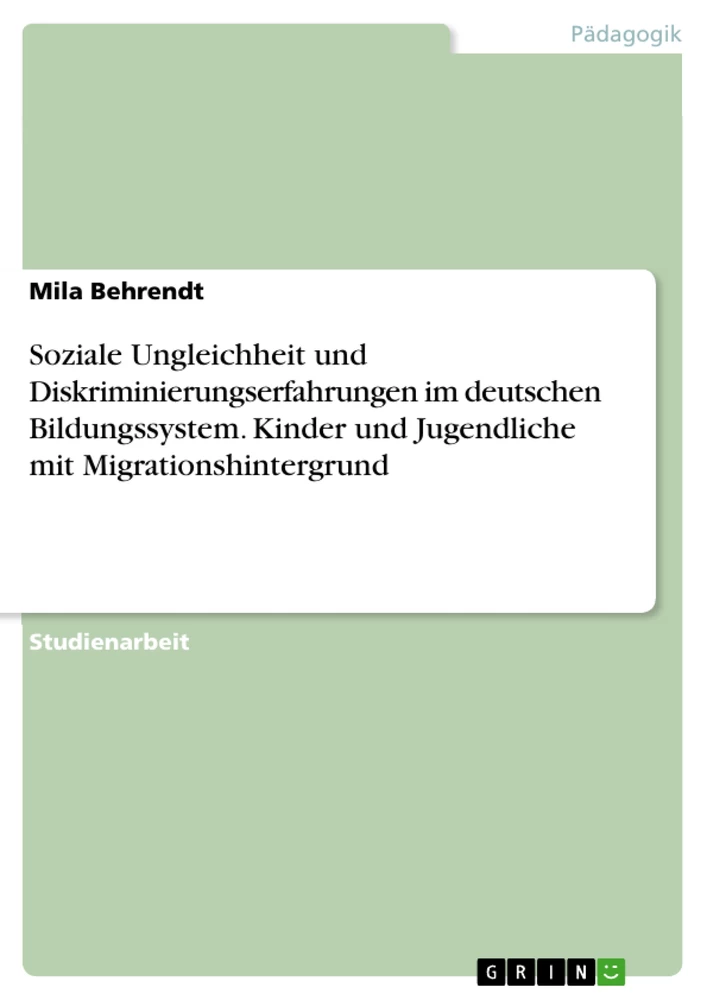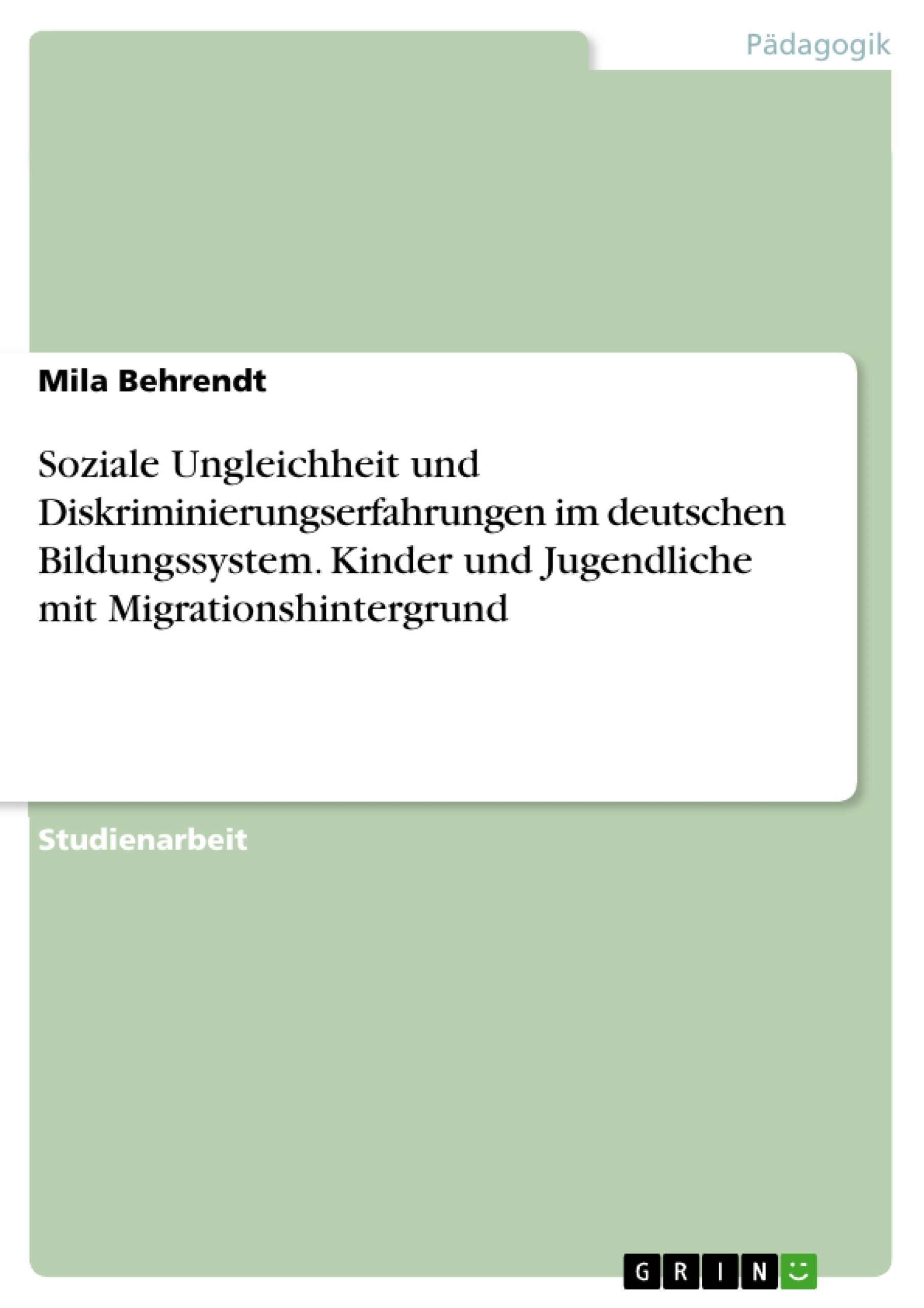Diese Ausarbeitung befasst sich mit der Situation von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem. Wie sind Migrantenkinder im Schulsystem positioniert? Was sind mögliche Gründe für die in Studien aufgezeigte Bildungsbenachteiligung? Welche Bildungsaufträge und Handlungsmöglichkeiten liegen in der Hand der Lehrkräfte? Im Rahmen dieser Ausarbeitung werden diese Fragen behandelt.
Hierzu werden zunächst einige relevante Begriffe erläutert, um danach die Situation von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem anhand von unterschiedlichen Daten darzustellen. Weiterhin werden unterschiedliche Erklärungsansätze für die Bildungsbenachteiligung aufgeführt, auf deren Grundlage Bildungsaufträge und Handlungsmöglichkeiten für Pädagogen hinsichtlich des Abbaus von Chancenungleichheiten aufzeigt werden. Anschließend wird auf die Chancen des Konzeptes der Ganztagsschule anhand der Vorstellung des Genoveva- Gymnasiums in Köln eingegangen. Die Ausarbeitung schließt mit einem persönlichen Fazit ab.
Spätestens seit der Veröffentlichung der für Deutschland mangelhaft ausgefallenen PISA-Ergebnisse im Jahr 2000 ist die Situation von Kindern und Jugendlichen im deutschen Bildungssystem zum relevanten Thema der Bildungspolitik geworden. Ursachen und Erklärungen für die Benachteiligung bestimmter Gruppen im Schulsystem werden zunehmend diskutiert, um Lösungen für das Problem „Bildungsbenachteiligung“ zu finden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsklärungen
- 2.1 Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund
- 2.2 Soziale Ungleichheit
- 2.3 Bildungsbeteiligung
- 2.4 Institutionelle Diskriminierung
- 3. Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund im Bildungssystem
- 4. Erklärungen für die Bildungsbenachteiligung
- 4.1 Bildungsbenachteiligung aufgrund der sozialen Herkunft
- 4.2 Bildungsbenachteiligung aufgrund von kulturellen Defiziten
- 4.3 Bildungsbenachteiligung aufgrund von mangelnden Sprachkenntnissen
- 4.4 Bildungsbenachteiligung aufgrund von institutionellen Bedingungen
- 5. Bildungsaufträge und Handlungsmöglichkeiten für Pädagogen
- 6. Chance: Ganztagsschule - Das Genoveva-Gymnasium in Köln
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Situation von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem. Die Arbeit untersucht mögliche Ursachen für die Bildungsbenachteiligung dieser Gruppe und beleuchtet die Rolle von Pädagogen im Kampf gegen Chancenungleichheiten.
- Definition von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
- Bildungsbenachteiligung im Kontext von sozialer Ungleichheit
- Analyse verschiedener Erklärungsansätze für Bildungsbenachteiligung
- Bildungsaufträge und Handlungsmöglichkeiten für Pädagogen
- Die Ganztagsschule als Chance für Chancengleichheit
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung Die Einleitung beleuchtet die Relevanz der Thematik Bildungsbenachteiligung im Kontext der PISA-Studien und stellt die Forschungsfrage nach der Situation von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem in den Vordergrund. Die Einleitung skizziert den Aufbau und die zentralen Themen der Hausarbeit.
- Kapitel 2: Begriffsklärungen Dieses Kapitel erläutert verschiedene relevante Begriffe, die für das Verständnis der Hausarbeit essenziell sind, wie zum Beispiel „Migrationshintergrund“, „soziale Ungleichheit“, „Bildungsbeteiligung“ und „institutionelle Diskriminierung“. Diese Definitionen schaffen ein gemeinsames Verständnis für die weiteren Ausführungen der Hausarbeit.
- Kapitel 3: Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund im Bildungssystem Dieses Kapitel beschreibt die Situation von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem anhand von unterschiedlichen Daten und Statistiken. Es beleuchtet die Positionierung dieser Schülergruppe im Schulsystem und zeigt mögliche Gründe für die beobachtete Bildungsbenachteiligung auf.
- Kapitel 4: Erklärungen für die Bildungsbenachteiligung Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Erklärungsansätze für die Bildungsbenachteiligung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Dabei werden Faktoren wie die soziale Herkunft, kulturelle Defizite, mangelnde Sprachkenntnisse und institutionelle Bedingungen analysiert.
- Kapitel 5: Bildungsaufträge und Handlungsmöglichkeiten für Pädagogen Das fünfte Kapitel untersucht die Bildungsaufträge und Handlungsmöglichkeiten von Pädagogen im Hinblick auf den Abbau von Chancenungleichheiten. Es geht auf die Möglichkeiten und Herausforderungen ein, die Pädagogen im Umgang mit Bildungsbenachteiligung im Schulalltag erleben.
- Kapitel 6: Chance: Ganztagsschule - Das Genoveva-Gymnasium in Köln Dieses Kapitel stellt das Genoveva-Gymnasium in Köln als Beispiel für eine Ganztagsschule vor und untersucht, inwiefern dieses Konzept eine Chance für Chancengleichheit bietet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen wie Bildungsbenachteiligung, Migrationshintergrund, soziale Ungleichheit, institutionelle Diskriminierung, Inklusion und Exklusion, interkulturelle Pädagogik und Ganztagsschule.
Häufig gestellte Fragen
Warum sind Kinder mit Migrationshintergrund im Bildungssystem oft benachteiligt?
Gründe liegen oft in der sozialen Herkunft, mangelnden Sprachkenntnissen, kulturellen Barrieren und institutionellen Bedingungen innerhalb des Schulsystems.
Was bedeutet „institutionelle Diskriminierung“?
Dies bezeichnet Benachteiligungen, die durch die Regeln, Strukturen und Routinen von Institutionen (wie Schulen) entstehen, unabhängig von individuellen Vorurteilen.
Welchen Einfluss hatte die PISA-Studie auf die Bildungsdebatte?
Seit PISA 2000 wurde deutlich, dass der Bildungserfolg in Deutschland stark von der sozialen Herkunft abhängt, was eine intensive Suche nach Reformen auslöste.
Wie kann eine Ganztagsschule zur Chancengleichheit beitragen?
Ganztagsschulen bieten mehr Zeit für individuelle Förderung und können Defizite, die im Elternhaus entstehen, besser kompensieren, wie das Beispiel des Genoveva-Gymnasiums zeigt.
Welche Handlungsmöglichkeiten haben Pädagogen?
Lehrkräfte können durch interkulturelle Pädagogik, gezielte Sprachförderung und eine Reflexion über institutionelle Barrieren zum Abbau von Ungleichheiten beitragen.
- Quote paper
- Mila Behrendt (Author), 2015, Soziale Ungleichheit und Diskriminierungserfahrungen im deutschen Bildungssystem. Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1194978