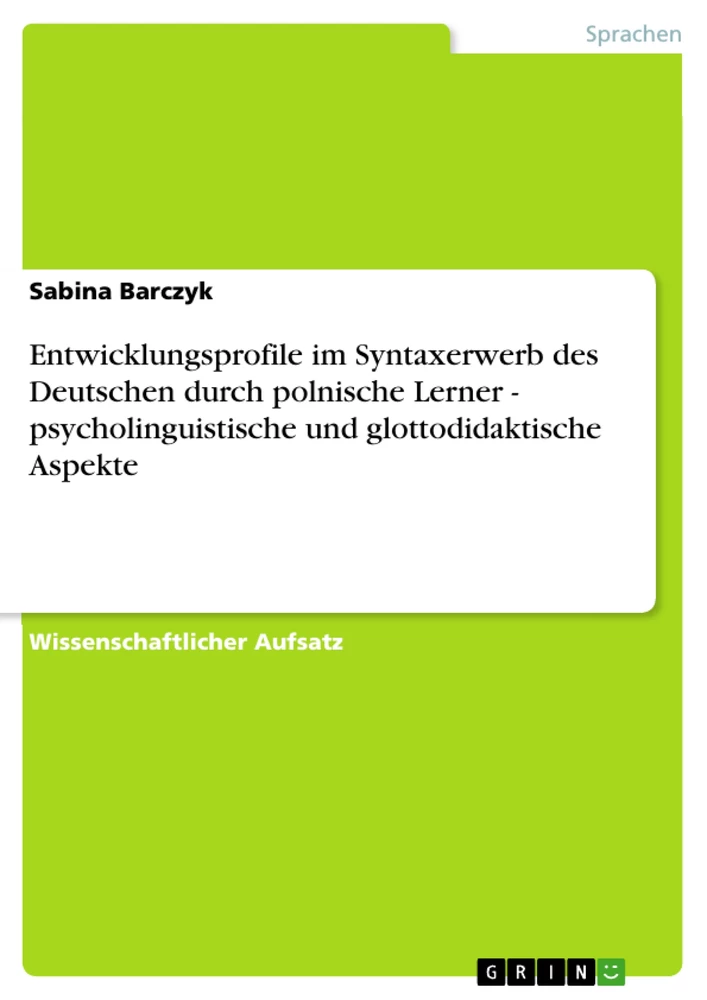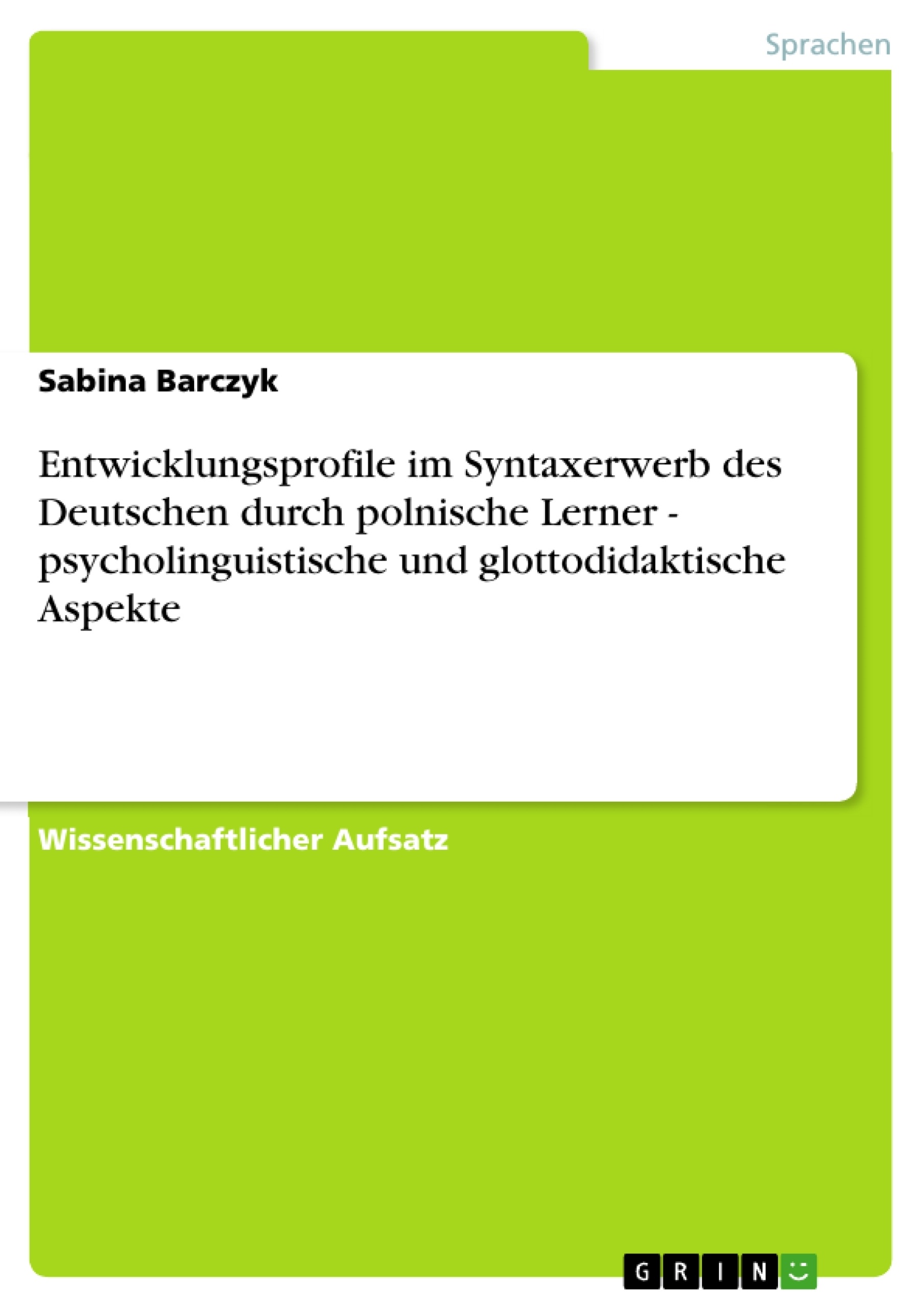In Untersuchungen zum Erwerb deutscher Syntax konnten bereits bestimmte reguläre Muster in Form von Erwerbssequenzen in der sprachlichen Entwicklung aufgedeckt werden, die sich in Form einer Erwerbssequenz festhalten lassen (vgl. z.B. Clahsen et.al. 1983; Jordens 1988; Pienemann 1998; Ellis 1989; Deihl et al. 2000; Schulz 2002; Terrasi-Haufe 2004). Dieser Befund veranlasst zur Überprüfung dessen, inwieweit sich die aufgedeckten Regularitäten im natürlichen Erwerb der deutschen Syntax, auch in deren Erwerb unter institutionellen Bedingungen, d.h. im Fremdsprachenunterricht, durchsetzen. Dieser Frage wird in dem vorliegenden Beitrag am Beispiel eigener Longitudinalstudie mit polnischen Deutschlernern nachgegangen. Durch die Analyse eigener empirischer Daten soll ermittelt werden, ob sich auch im unterrichtlichen Erwerb deutscher Verbstellung durch polnische Lerner eine Erwerbssequenz festhalten lässt. Vor diesem Hintergrund wird ferner die Frage erörtert, inwieweit der Erwerb syntaktischer Eigenschaften des Deutschen durch polnische Lernern einer didaktischen Beeinflussung unterliegt und als wie autonom sich dabei die natürlichen Erwerbsprozesse erweisen.
1. Spracherwerb als Forschungsgegenstand der Glottodidaktik
Die Fremdsprachendidaktik hat mehrfache Versuche unternommen, die Aneignung fremder Sprachen unter Einsatz bestimmter methodischer Verfahren zu optimieren. Die Vermittlung von Fremdsprachen im Unterricht, insbesondere das Problem, wie der Sprachlehrer die fremde Sprache am effektivsten unterrichten kann, stand im Mittelpunkt sowohl ihrer theoretischen als auch praxisbezogenen Erwägungen.[*]
In den 70er Jahren des 20. Jhs. wurde das Interesse der wissenschaftlichen Fremdsprachendidaktik um eine neue Erkenntnis bereichert, dass die Aneignung sprachlicher Strukturen durch den einzelnen Sprachlerner das wesentliche Problem darstellt, mit dem die Sprachlehrer im Fremdsprachenunterricht konfrontiert sind. In Polen hat v.a. Franciszek Grucza deutlich darauf hingewiesen, dass die Sprache als eine konstitutive Eigenschaft des Menschen nicht lediglich mit Hilfe bestimmter methodischer Verfahren vermittelt werden kann, sondern vom Lerner selbst mental verarbeitet und in seinem Inneren rekonstruiert werden muss (vgl. z.B. Grucza 1978, 1979). Die von der polnischen Glottodidaktik vorgeschlagene Hinwendung zum konkreten Sprachlerner, bereicherte die traditionelle Fremdsprachendidaktik. Während die letzte ihr Augenmerk auf den Beitrag des Lehrers zum Erfolg des Schülers richtete (Vermittlungsperspektive), begann sich die Glottodidaktik auch für die Perspektive des Spracherwerbs zu interessieren. Der Sprachlerner wird somit als aktiver Teilhaber am Lernprozess verstanden, der die Eigenschaften der zu lernenden Sprache zu durchschauen, zu verarbeiten und zu verinnerlichen hat. In Anbetracht dieser Erkenntnisse wird seit den 90er Jahren des 20. Jhs. in der Glottodidaktik für eine stärkere Hinwendung zum Komplex des Lernperspektive von Sprachen plädiert. Der Spracherwerb, insbesondere der Fremdsprachenerwerb in allen seinen Ausprägungen bildet somit den Ausgangspunkt und zugleich das primäre Erkenntnisinteresse glottodidaktischer und psycholinguistischer Bemühungen. Die Erhellung dessen, nach welchen Prinzipien der Spracherwerb verläuft und mit Hilfe welcher Strategien die Lerner im Fremdsprachenunterricht den Prozess der sprachlichen Entwicklung bewältigen, kann nämlich effektiv zur Optimierung des Fremdsprachenunterrichts beitragen.
2. Erwerb der deutschen Syntax
Der Frage, worauf der Spracherwerb beruht und wie er zu beschreiben ist, wird mehr oder weniger explizit in zahlreichen psycholinguistisch orientierten empirischen Studien zum Erwerb deutscher Syntax nachgegangen. Der Aneignungsprozess syntaktischer Eigenschaften des Deutschen gehört zu den meistuntersuchten Phänomenen, für den bestimmte reguläre Muster bereits aufgedeckt wurden. Sie lassen sich in Form von Stadien oder Stufen erfassen und weisen eine invariable Erwerbssequenz auf (vgl. z.B. Clahsen et.al. 1983; Jordens 1988; Ellis 1989; Müller 1993; Rothweiler 1993; Pienemann 1998; Diehl et al. 2000; Schulz 2002; Terrasi-Haufe 2004). Dieser Forschungsrichtung schließt sich auch eine eigene Longitudinalstudie zum Erwerb syntaktisch- topologischer Regularitäten des Deutschen durch polnische Lerner im Fremdsprachenunterricht an.1 Ihr Hauptanliegen war die Überprüfung dessen, inwieweit die im natürlichen Erwerb der deutschen Syntax aufgedeckten Gesetzmäßigkeiten sich auch in deren Erwerb unter institutionellen Bedingungen, d.h. im Fremdsprachenunterricht durchsetzen.
3. Eine Studie zum Erwerb der Verbstellungsregeln im deutschen Satz
3.1. Ziele der Untersuchung
Durch die Analyse gewonnener Daten soll ermittelt werden, wie der unterrichtliche Erwerb deutscher Verbstellungsregeln verläuft und ob sich hier auch eine invariante Erwerbssequenz festhalten lässt, die für den L2-Erwerb Deutsch in der Teachability-Hypothese (vgl. Clahsen et.al. 1983, Pienemann 1984) und erneut in der Processability Theory von Pienemann (1998) postuliert wurde. Die Beantwortung dieser Frage impliziert die Aufdeckung dessen, welche entwicklungsspezifischen Strukturen und spracherwerblichen Strategien sich im Erwerb der Verbstellung im deutschen Satz aufdecken lassen. Ferner wird die Frage erörtert, inwieweit der Erwerb syntaktischer Eigenschaften des Deutschen durch polnische Lernern einer didaktischen Beeinflussung unterliegt und als wie autonom sich dabei die natürlichen Erwerbsprozesse erweisen.
Den Ausgangpunkt für die so begriffene Forschungsaufgaben bilden das umfangreiche Studium der Literatur zum Grammatikerwerb sowie Impulse aus der fremdsprachendidaktischen Praxis, die einstimmig auf die Tatsache verweisen, dass der Erwerb syntaktischer Eigenschaften der deutschen Sprache ein langwieriger Prozess ist. Trotz expliziter Grammatikerklärungen (Grammatikunterricht) oder der Möglichkeit, das Gelernte in natürlicher Kommunikation anzuwenden, erreichen viele Deutschlerner die fremdsprachliche Kompetenz, wenn überhaupt, dann in einem nur muttersprachlernahen Grad. Grammatische Kognitivierungsverfahren führen nicht direkt zur Entwicklung der zielsprachlichen Kompetenz und nicht jede grammatische Form ist jederzeit lehrbar. Es scheint vielmehr, dass der Intake, also das, was wirklich aufgenommen und später internalisiert wird, im Vergleich zu der vorgenommenen didaktischen Steuerung in einem Missverhältnis steht. Mit anderen Worten: nicht alles, was im Fremdsprachenunterricht als Material (Input) dargeboten wird, wird zugleich von den Sprachlernern aufgenommen, verarbeitet und mental verankert. Die von Allwright bereits im Jahre 1984 gestellte Frage „Why don’t learners learn what teachers teach?“ verliert auch heutzutage nicht an Aktualität.
3.2. Involvierte Sprachen
An dieser Stelle empfiehlt es sich kurz darauf hinzuweisen, dass die Verbstellungsregularitäten des Deutschen für polnischsprachige Lerner einen besonderen Erwerbsproblem auf Grund typologischer Unterschiede der beiden Sprachen darstellen. Im Gegensatz zur deutschen Syntax ist das Verb im Polnischen nicht an bestimmte Positionen im Satz gebunden; die polnischen Sätze werden topologisch nicht nach Verbpositionen klassifiziert. Für das Deutsche gibt es hingegen grundsätzlich drei Verbpositionen im Satz: V2-, V1- und V-Endstellung, und alle anderen Stellungsmuster ergeben sich aus den vorwiegend syntaktischen Bedingungen einzelner Satztypen, wie z.B. das Stellungsmuster mit einem Modalverb oder Auxiliar im Finitumfeld und einem infinitem Verbalteil im Endfeld (Verbalklammer) oder auch das Phänomen der Subjekt-Verb-Inversion.
Angesichts dieser typologischen Differenzen der involvierten Sprachen erschient die Verifikation der in der Teachability-Hypothese postulierten invarianten ZISA-Erwerbssequenz besonders interessant. Dies wurde in der hier referierten Longitudinalstudie anhand schriftlicher Lerneräußerungen vorgenommen.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Text?
Der Text befasst sich mit dem Thema Spracherwerb, insbesondere dem Fremdsprachenerwerb, als Forschungsgegenstand der Glottodidaktik. Er untersucht, wie der Erwerb syntaktischer Eigenschaften der deutschen Sprache durch polnische Lerner im Fremdsprachenunterricht verläuft.
Was ist das Hauptanliegen der Glottodidaktik bezüglich des Spracherwerbs?
Die Glottodidaktik interessiert sich für die Perspektive des Spracherwerbs und betrachtet den Sprachlerner als aktiven Teilhaber am Lernprozess. Sie versucht zu erhellen, nach welchen Prinzipien der Spracherwerb verläuft und mit Hilfe welcher Strategien die Lerner im Fremdsprachenunterricht den Prozess der sprachlichen Entwicklung bewältigen.
Was wird über den Erwerb der deutschen Syntax gesagt?
Der Text erwähnt, dass der Aneignungsprozess syntaktischer Eigenschaften des Deutschen zu den meistuntersuchten Phänomenen gehört und bestimmte reguläre Muster in Form von Stadien oder Stufen mit einer invarianten Erwerbssequenz bereits aufgedeckt wurden.
Was war das Ziel der in dem Text erwähnten Studie?
Ziel der Studie war es, zu ermitteln, wie der unterrichtliche Erwerb deutscher Verbstellungsregeln verläuft und ob sich hier auch eine invariante Erwerbssequenz festhalten lässt, die für den L2-Erwerb Deutsch in der Teachability-Hypothese postuliert wurde.
Welches Problem haben polnische Lerner beim Erwerb der deutschen Verbstellungsregeln?
Die Verbstellungsregularitäten des Deutschen stellen für polnischsprachige Lerner ein besonderes Erwerbsproblem dar, da das Verb im Polnischen nicht an bestimmte Positionen im Satz gebunden ist, im Gegensatz zum Deutschen mit seinen V2-, V1- und V-Endstellungen.
Was ist die Teachability-Hypothese und wie hängt sie mit der Studie zusammen?
Die Teachability-Hypothese postuliert eine invariante ZISA-Erwerbssequenz beim Spracherwerb. Die Studie, die im Text erwähnt wird, hat die Verifikation dieser Hypothese anhand schriftlicher Lerneräußerungen im Kontext des Erwerbs deutscher Verbstellungsregeln durch polnische Lerner vorgenommen.
Warum lernen Lerner nicht immer, was Lehrer unterrichten?
Der Text zitiert die Frage von Allwright: "Why don’t learners learn what teachers teach?" und deutet an, dass nicht alles, was im Fremdsprachenunterricht als Input dargeboten wird, von den Sprachlernern aufgenommen, verarbeitet und mental verankert wird.
- Quote paper
- Dr. Sabina Barczyk (Author), 2007, Entwicklungsprofile im Syntaxerwerb des Deutschen durch polnische Lerner - psycholinguistische und glottodidaktische Aspekte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119532