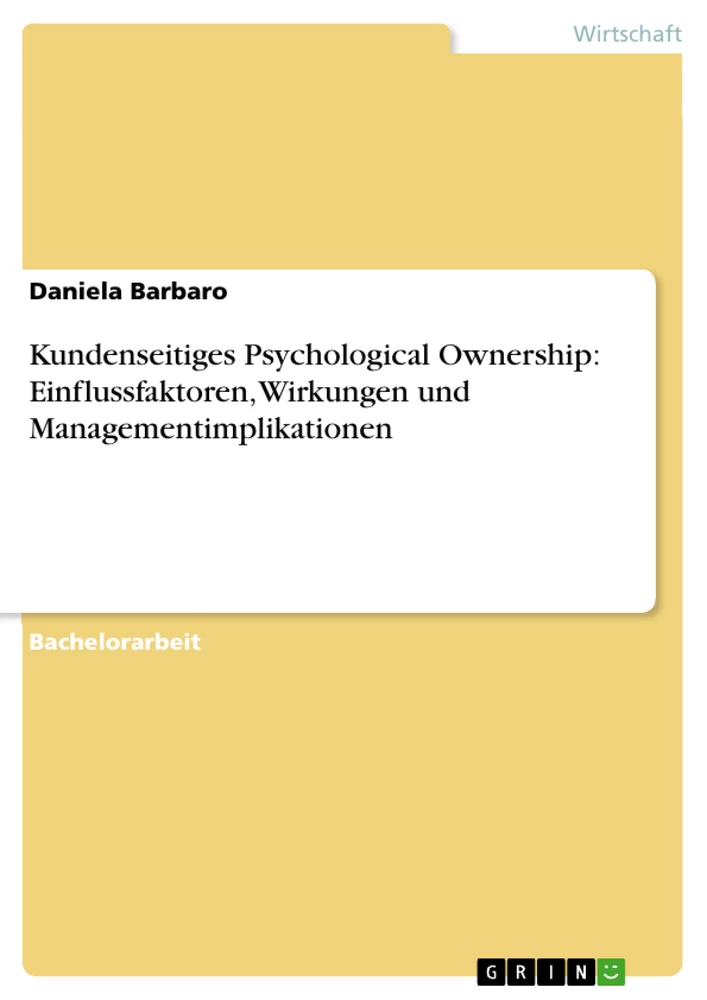Wie lassen sich die bestehenden theoretischen und empirischen Erkenntnisse von Psychological Ownership bei Kunden systematisieren? Welche Faktoren haben Einfluss auf die Entstehung von Psychological Ownership bei Kunden und inwieweit lassen sich diese aus einem organisationalen Kontext auf Kunden übertragen?
Die psychologische Bedeutung von Besitz beziehungsweise Eigentum war bereits in den unterschiedlichsten Forschungsrichtungen, zum Beispiel in der Anthropologie oder der Sozial- und Entwicklungspsychologie, Gegenstand von theoretischen und empirischen Arbeiten. Schon früh wurde dabei vermutet, dass Eigentumsobjekte bei der Identitätsbildung von Individuen eine erhebliche Rolle spielen. Sartre sagt in seiner Abhandlung „Being and Nothingness“: „The totality of my possessions reflects the totality of my being (...) I am what I have (...) What is mine is myself“. Hiermit definiert sich Sartre über die Gesamtheit seines Besitzes, da diese seine Identität widerspiegelt. Erhält man das formale Eigentum an einem Objekt (z.B. an einem Haus), dann ist dieses von Rechts wegen geschützt und somit vom Staat und der Gesellschaft anerkannt. Folglich wird das formale Eigentum vom Individuum auf einer objektiven Ebene wahrgenommen. Betrachtet ein Individuum ein Objekt jedoch als „sein Eigentum“, ohne das formale Eigentum an diesem zu halten, wird das Eigentum auf einer rein subjektiven Ebene wahrgenommen. Mit dieser Thematik setzt sich das Konzept von Psychological Ownership (PO) auseinander, das besonders auf Jon L. Pierce zurückgeht, der PO in einem organisationalen Zusammenhang untersucht hat. Dabei geht es darum, inwieweit Mitarbeiter (MA) einer Organisation diese als ihr Eigentum betrachten, obwohl sie nicht die rechtmäßigen Eigentümer sind. Der Großteil der späteren Studien zu PO, hat das Konzept ebenfalls in diesem Kontext untersucht, wobei sowohl positive Wirkungen auf die Einstellungen als auch auf die Verhaltensweisen der MA im Hinblick auf die Organisation belegt werden konnten. Aus diesem Grund gilt das Konzept in der Organisationsforschung als essenziell.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffliche Grundlagen zu Psychological Ownership
- 3 Entstehung von Psychological Ownership
- 3.1 Motivationale Grundlagen
- 3.2 Objektbezogene Grundlagen
- 4 Einflussfaktoren der Entstehung von Psychological Ownership
- 4.1 Theoretische Grundlagen zu den Einflussfaktoren von Psychological Ownership
- 4.2 Mitarbeiterseitige empirische Befunde
- 4.3 Kundenseitige empirische Befunde
- 4.4 Fazit zu den kundenseitigen Erkenntnissen
- 5 Wirkungen von Psychological Ownership
- 5.1 Theoretische Grundlagen zu den Wirkungen von Psychological Ownership
- 5.2 Mitarbeiterseitige empirische Befunde
- 5.3 Kundenseitige empirische Befunde
- 5.4 Fazit zu den kundenseitigen Erkenntnissen
- 6 Managementimplikationen
- 7 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht das kundenseitige Psychological Ownership (PO), seine Entstehung, Auswirkungen und daraus resultierende Management-Implikationen. Der Fokus liegt auf der Erforschung der Einflussfaktoren auf die Entwicklung von PO bei Kunden und der Analyse der daraus resultierenden Wirkungen. Die Arbeit vergleicht kundenseitige Befunde mit bestehenden Erkenntnissen aus der Mitarbeiterforschung zu diesem Thema.
- Begriffliche Klärung und Einordnung von Psychological Ownership
- Analyse der Einflussfaktoren auf die Entstehung von kundenseitigem Psychological Ownership
- Untersuchung der Wirkungen von kundenseitigem Psychological Ownership
- Ableitung von Managementimplikationen für die Praxis
- Vergleich zwischen Mitarbeiter- und Kundenperspektive bezüglich Psychological Ownership
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Psychological Ownership (PO) ein und stellt die Relevanz des Konzepts im Kontext der Marketingforschung heraus. Sie hebt die Bedeutung von PO für die Kundenloyalität hervor und positioniert die Arbeit innerhalb des bestehenden Forschungsstands. Die Arbeit fokussiert sich auf die kundenseitige Perspektive, im Gegensatz zum bisher stärker untersuchten Mitarbeiter-bezogenen PO.
2 Begriffliche Grundlagen zu Psychological Ownership: Dieses Kapitel klärt den Begriff Psychological Ownership (PO) und seine Bedeutung. Es differenziert zwischen formalem und subjektivem Eigentum und positioniert PO als ein subjektives Empfinden von Besitz an einem Objekt, unabhängig vom formalen Eigentum. Die Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die folgenden Kapitel dar und grenzt PO von ähnlichen Konzepten ab.
3 Entstehung von Psychological Ownership: Dieses Kapitel befasst sich mit den Ursachen und Faktoren, die zur Entstehung von Psychological Ownership beitragen. Es werden sowohl motivationale als auch objektbezogene Grundlagen diskutiert, die die Entwicklung von PO beeinflussen. Der Abschnitt untersucht die psychologischen Prozesse, die zu dem Gefühl des „Besitzes“ führen und legt die Basis für das Verständnis der Einflussfaktoren in Kapitel 4.
4 Einflussfaktoren der Entstehung von Psychological Ownership: Dieses Kapitel analysiert die Faktoren, die die Entstehung von PO beeinflussen. Es werden sowohl theoretische Grundlagen als auch empirische Befunde aus der Mitarbeiter- und Kundenforschung vorgestellt und verglichen. Der Fokus liegt auf dem Vergleich von Befunden im Mitarbeiter- und Kundenkontext und auf der Identifizierung relevanter Unterschiede. Es werden konkrete Beispiele für Einflussfaktoren genannt und deren Wirkungsweise erklärt.
5 Wirkungen von Psychological Ownership: Dieses Kapitel widmet sich den Folgen von PO. Es werden sowohl theoretische Überlegungen als auch empirische Ergebnisse aus der Mitarbeiter- und Kundenforschung präsentiert und diskutiert, um die Auswirkungen von PO auf Einstellungen und Verhalten zu beleuchten. Die Kapitel analysiert den Zusammenhang zwischen PO und relevanten Marketing-Phänomenen, wie z.B. Kundenloyalität, und betont die Bedeutung dieser Ergebnisse für die Praxis.
6 Managementimplikationen: Dieses Kapitel leitet aus den vorangegangenen Kapiteln praktische Handlungsempfehlungen für das Management ab. Es zeigt auf, wie Unternehmen das Verständnis und die Entstehung von kundenseitigem PO fördern können, um positive Wirkungen auf Kundenbeziehungen und -verhalten zu erzielen. Konkrete Strategien und Maßnahmen werden vorgestellt und diskutiert.
Schlüsselwörter
Psychological Ownership, Kundenloyalität, Einflussfaktoren, Wirkungen, Managementimplikationen, Kundenbeziehung, Marketing, empirische Forschung, Mitarbeiter, Besitzgefühl, subjektives Eigentum.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Kundenseitiges Psychological Ownership
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht das kundenseitige Psychological Ownership (PO), seine Entstehung, Auswirkungen und daraus resultierende Management-Implikationen. Der Fokus liegt auf der Erforschung der Einflussfaktoren auf die Entwicklung von PO bei Kunden und der Analyse der daraus resultierenden Wirkungen. Ein wichtiger Aspekt ist der Vergleich kundenseitiger Befunde mit bestehenden Erkenntnissen aus der Mitarbeiterforschung.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Begriffliche Klärung und Einordnung von Psychological Ownership; Analyse der Einflussfaktoren auf die Entstehung von kundenseitigem Psychological Ownership; Untersuchung der Wirkungen von kundenseitigem Psychological Ownership; Ableitung von Managementimplikationen für die Praxis; Vergleich zwischen Mitarbeiter- und Kundenperspektive bezüglich Psychological Ownership.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert: Einleitung; Begriffliche Grundlagen zu Psychological Ownership; Entstehung von Psychological Ownership (inkl. motivationaler und objektbezogener Grundlagen); Einflussfaktoren der Entstehung von Psychological Ownership (inkl. theoretischer Grundlagen, Mitarbeiter- und Kundenseitigen empirischen Befunden); Wirkungen von Psychological Ownership (inkl. theoretischer Grundlagen, Mitarbeiter- und Kundenseitigen empirischen Befunden); Managementimplikationen; Fazit und Ausblick. Jedes Kapitel enthält eine Zusammenfassung.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit kombiniert theoretische Grundlagen mit empirischen Befunden aus der Mitarbeiter- und Kundenforschung. Es wird ein Vergleich zwischen Mitarbeiter- und Kundenperspektive bezüglich Psychological Ownership durchgeführt, um relevante Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufzuzeigen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Psychological Ownership, Kundenloyalität, Einflussfaktoren, Wirkungen, Managementimplikationen, Kundenbeziehung, Marketing, empirische Forschung, Mitarbeiter, Besitzgefühl, subjektives Eigentum.
Welche praktischen Implikationen ergeben sich aus der Arbeit?
Die Arbeit leitet aus den Forschungsergebnissen praktische Handlungsempfehlungen für das Management ab. Es werden Strategien und Maßnahmen vorgestellt, wie Unternehmen das Verständnis und die Entstehung von kundenseitigem PO fördern können, um positive Wirkungen auf Kundenbeziehungen und -verhalten zu erzielen.
Was ist das Fazit der Arbeit?
(Das Fazit ist im Kapitel 7 "Fazit und Ausblick" detailliert beschrieben und kann hier nicht vollständig wiedergegeben werden. Es fasst die zentralen Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf weiterführende Forschungsfragen.)
Wo finde ich detailliertere Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Detailliertere Informationen zu den einzelnen Kapiteln finden Sie in den jeweiligen Kapitelzusammenfassungen innerhalb der Arbeit selbst. Diese Zusammenfassungen bieten einen Überblick über die Inhalte und die zentralen Ergebnisse jedes Kapitels.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich mit Kundenbeziehungen, Marketing und dem Thema Psychological Ownership beschäftigen, insbesondere für Studierende, Wissenschaftler und Praktiker im Bereich Marketing und Management.
- Quote paper
- Daniela Barbaro (Author), 2017, Kundenseitiges Psychological Ownership: Einflussfaktoren, Wirkungen und Managementimplikationen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1195756