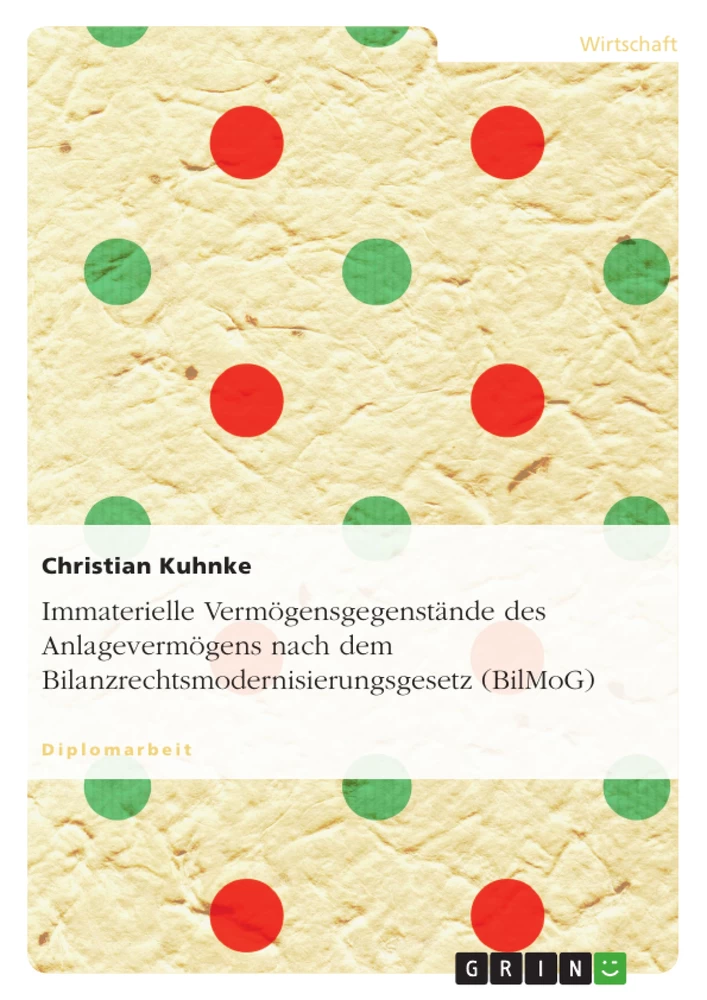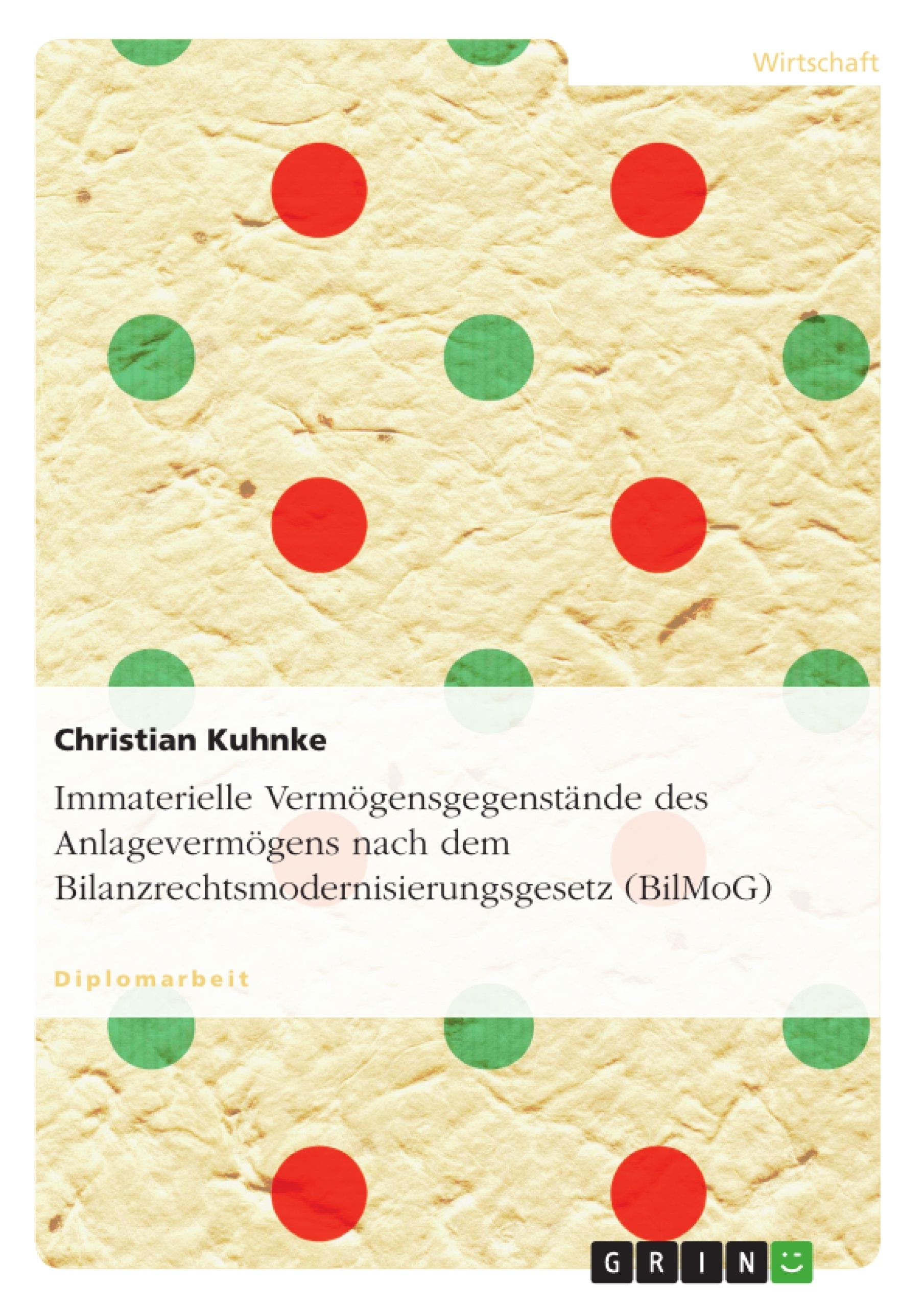In einem viel zitierten Aufsatz von 1979 bezeichnete Moxter die immateriellen Vermögensgegenstände als „ewige Sorgenkinder des Bilanzrechts“ . Zwar ermatteten zumindest im deutschen Sprachraum die Diskussionen um die immateriellen Vermögensgegenstände eine Zeit lang, heute besitzt dieses Zitat jedoch wieder eine große Aktualität. Bereits durch die im Zuge des Höhenflugs der sogenannten New Economy verstärkt wahrgenommene Lücke zwischen Bilanzwert und Kapitalmarktbewertung war gegen Ende des letzten Millenniums die Debatte um die Darstellung der intangibles sowohl in Deutschland als auch international neu entfacht. Als Lösungsansätze der im Spannungsfeld zwischen Verlässlichkeit und Relevanz stehenden Problematik wurden neben einer erweiterten bilanziellen Ansatzkonzeption verschiedene Modelle zur außerbilanziellen Berichterstattung diskutiert. Die außerbilanziellen Konzepte blieben jedoch auf die freiwillige Berichterstattung beschränkt und aktuelle Studien deuten darauf hin, dass sie sich in der Praxis bis heute nicht durchsetzten konnten.
Durch eine grundsätzliche Qualitätsdiskussion im Hinblick auf das Phänomen des earnings managements trat die Diskussion um die Behandlung der immateriellen Vermögensgegenstände zeitweise erneut in den Hintergrund. Dies wird sich ändern. Durch das im Entwurf befindliche BilMoG steht das Aktivierungsverbot immaterieller Vermögensgegenstände kurz davor, von einem Monument der deut-schen Rechnungslegung zu einem historischen Denkmal zu werden. Der Gesetzgeber hat dem Druck von Teilen der Fachwelt nachgegeben und will den § 248 Abs. 2 HGB in seiner bisherigen Fassung streichen. Dies zum Anlass nehmend ist das Ziel dieser Arbeit die meist abstrakt gehaltene Diskussion um das earnings management auf die selbst erstellten immateriellen Güter zu fokussieren. Zu diesem Zweck werden zunächst die de lege lata und de lege ferenda Regelungen des deutschen Handelsrechts vorgestellt und auf Möglichkeiten des earnings managements überprüft. Da um bewerten zu können verglichen werden muss, werden zudem die Regelungen der IFRS vorgestellt und ebenfalls im Hinblick auf die Möglichkeiten der Gewinnsteuerung beurteilt. Zudem werden in diesem Zusammenhang Studien vorgestellt, die die Bilanzierungspraxis von Entwicklungskosten deutscher IFRS-Anwender untersuchen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Problemstellung
- 2 Grundlagen der Rechnungslegung
- 2.1 Zwecke der Rechnungslegung
- 2.1.1 Bisherige Zwecke des deutschen Handelsrechts
- 2.1.2 Zwecke des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes
- 2.1.3 Zwecke der IFRS-Rechnungslegung
- 2.2 Beeinflussung der Rechnungslegung durch das earnings management
- 2.2.1 Definition und Ziele des earnings managements
- 2.2.2 Methoden des earnings managements
- 2.2.3 Problematik des earnings managements
- 3 Bilanzierung selbst erstellter immaterieller Vermögensgegenstände im deutschen Handelsrecht
- 3.1 Grundlagen der Bilanzierung immaterieller Vermögensgegenstände
- 3.1.1 Begriff des Vermögensgegenstandes
- 3.1.2 Abgrenzung zwischen Anlage- und Umlaufvermögen
- 3.1.3 Begriff und Charakterisierung immaterieller Vermögensgegenstände
- 3.2 Bilanzierung selbst erstellter immaterieller Vermögensgegenstände de lege lata
- 3.2.1 Ansatzverbot selbst erstellter Vermögensgegenstände nach § 248 Abs. 2 HGB
- 3.2.2 Bilanzierung des Geschäfts- oder Firmenwertes nach § 255 Abs. 4 HGB
- 3.2.3 Würdigung der de lege lata Regelungen des deutschen Handelsrechtes
- 3.3 Bilanzierung selbst erstellter immaterieller Vermögensgegenstände de lege ferenda
- 3.3.1 Streichung des § 248 Abs. 2 HGB
- 3.3.2 Abweichende Definition des Begriffs des Vermögensgegenstandes
- 3.3.3 Trennung der Forschungs- und Entwicklungsphase
- 3.3.4 Bilanzierung von Entwicklungsaufwendungen
- 3.3.5 Bilanzierung des Geschäfts- oder Firmenwertes
- 3.3.6 Nutzung der IFRS als Auslegungsmaßstab für das HGB
- 3.3.7 Würdigung der de lege ferenda Regelungen des deutschen Handelsrechtes
- 4 Bilanzierung selbst erstellter immaterieller Vermögenswerte nach den International Financial Reporting Standards
- 4.1 Begriff des Vermögenswertes als allgemeines Ansatzkriterium
- 4.2 Abgrenzung materieller und immaterieller Vermögenswerte
- 4.3 Ergänzende Ansatzkriterien für selbst geschaffene immaterielle Güter
- 4.3.1 Trennung der Forschungs- und Entwicklungsphase
- 4.3.2 Ergänzende Ansatzkriterien während der Entwicklungsphase
- 4.4 Folgebewertung und Angabepflichten immaterieller Güter
- 4.5 Bilanzierung des Geschäfts- oder Firmenwertes
- 4.6 Bilanzierungspraxis von Entwicklungskosten in den Konzernabschlüssen deutscher Unternehmen
- 4.7 Würdigung der Regelungen der International Financial Reporting Standards
- 5 Kritische Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Bilanzierung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG). Die Arbeit analysiert die bestehenden Regelungen im deutschen Handelsrecht und vergleicht diese mit den International Financial Reporting Standards (IFRS).
- Bilanzierung immaterieller Vermögensgegenstände nach HGB
- Vergleich der Bilanzierung nach HGB und IFRS
- Analyse der Rechtslage vor und nach dem BilMoG
- Bewertung von Entwicklungsaufwendungen
- Problematik des Earnings Management
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 beschreibt die Problemstellung der Arbeit. Kapitel 2 legt die Grundlagen der Rechnungslegung dar, einschließlich der Zwecke der Rechnungslegung nach deutschem Handelsrecht, BilMoG und IFRS, sowie die Problematik des Earnings Management. Kapitel 3 befasst sich mit der Bilanzierung selbst erstellter immaterieller Vermögensgegenstände im deutschen Handelsrecht, sowohl de lege lata als auch de lege ferenda. Kapitel 4 behandelt die Bilanzierung nach IFRS, inklusive der Ansatzkriterien und der Bilanzierungspraxis deutscher Unternehmen.
Schlüsselwörter
Immaterielle Vermögensgegenstände, Anlagevermögen, Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG), International Financial Reporting Standards (IFRS), Handelsgesetzbuch (HGB), Entwicklungskosten, Forschungsaufwendungen, Earnings Management, Bewertung.
Häufig gestellte Fragen
Was änderte das BilMoG bei immateriellen Vermögensgegenständen?
Mit dem BilMoG wurde das strikte Aktivierungsverbot für selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens aufgehoben. Unternehmen erhielten ein Aktivierungswahlrecht für Entwicklungskosten.
Was ist der Unterschied zwischen Forschungs- und Entwicklungskosten?
Forschungskosten unterliegen weiterhin einem Aktivierungsverbot, da sie der Gewinnung neuer Erkenntnisse dienen. Entwicklungskosten dürfen aktiviert werden, wenn die technische Realisierbarkeit und die künftige Nutzbarkeit belegt sind.
Was versteht man unter „Earnings Management“ in diesem Kontext?
Es beschreibt die gezielte Beeinflussung des Jahresergebnisses. Durch das Wahlrecht bei der Aktivierung von Entwicklungskosten können Unternehmen ihren Gewinn steuern (z.B. durch Erhöhung der Aktivposten).
Wie unterscheiden sich HGB und IFRS bei immateriellen Werten?
Während das HGB nach dem BilMoG ein Wahlrecht einräumte, schreiben die IFRS unter bestimmten Bedingungen eine Aktivierungspflicht für Entwicklungskosten vor.
Warum werden immaterielle Güter als „Sorgenkinder des Bilanzrechts“ bezeichnet?
Da sie schwer greifbar sind und ihre Bewertung oft auf subjektiven Schätzungen beruht, stehen sie im Spannungsfeld zwischen Verlässlichkeit (Gläubigerschutz) und Relevanz (Informationsfunktion).
- Quote paper
- Christian Kuhnke (Author), 2008, Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119608