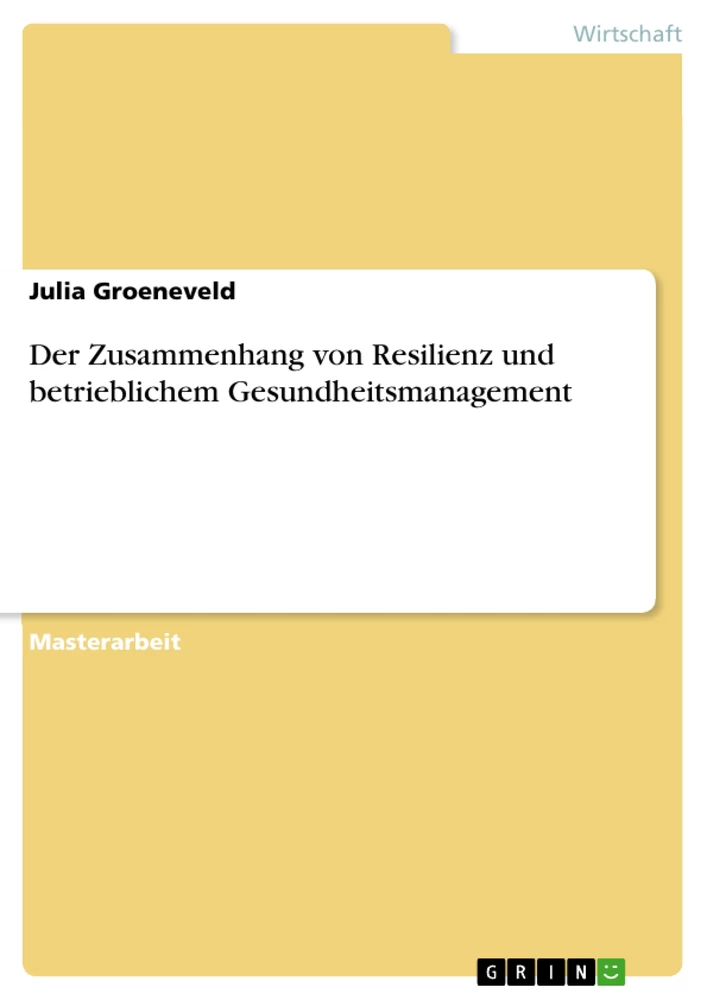In dieser Arbeit werden Aspekte systematischer BGM aufgezeigt und weiterentwickelt, um den Rahmen der Resilienzförderung zu erweitern, die Unternehmen leisten können, um eben diese Belastungen zu reduzieren, und die sich sowohl für Unternehmen als auch Arbeitnehmende positiv nutzen lassen. In der älteren Literatur hat dies wenig Berücksichtigung gefunden, jedoch innerhalb der letzten fünfzehn Jahre wurden die positiven Effekte des BGM verstärkt beachtet und haben an Bedeutung gewonnen.
Die Arbeit gliedert sich wie folgt: Zu Beginn wird sich mit dem Begriff der Salutogenese nach Antonovsky, der neuronalen Plastizität und dem Begriff der Resilienz auseinandergesetzt. Dies erfolgt in Vorbereitung auf die Beschäftigung mit den drei bekanntesten Theorien der Resilienz. Aus aktuellem Stand lässt sich der Zusammenhang der Salutogenese, der neuronalen Plastizität und der Resilienz eines Menschen daher ableiten, dass die neuronale Plastizität wissenschaftlich bestätigt, dass das Gehirn bis zum Zeitpunkt des Todes in der Lage ist, Neues zu erlernen. Somit ist im Prinzip jeder Mensch in der Lage, selbst im fortgeschrittenen Alter noch Resilienz zu erlernen. Die Salutogenese setzt sich ergänzend dazu mit der Erhaltung der Gesundheit auseinander.
Anschließend wird auf die drei größten Theorien der Resilienz und auf die Thematik des BGM eingegangen. Aus diesen theoretischen Erkenntnissen wird im Zwischenfazit eine leitende Fragestellung gebildet, um diese anschließend im praktischen Teil behandeln zu können. In diesem Prozess wurde sich für eine qualitative Inhaltsanalyse entschieden, da eine quantitative Datenerhebung zur Beantwortung der leitenden Fragestellung nicht ausreichend ist. Aufgrund dessen wird sich im Rahmen dieser Arbeit zusätzlich mit der Thematik der leitfadengestützten Interviews nach Kallus und der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring befasst. Anschließend folgt die Auswertung der Fragebögen, worauf der Punkt der Mitarbeitenden in partizipativen Prozessen der Veränderung folgt. Veränderungsprozesse sind notwendig, um eine Resilienzförderung in Unternehmen zu ermöglichen, da Veränderungen stets auf Widerstände stoßen können. Im Fazit wird aufgezeigt, was Unternehmen leisten könnten und müssten, um die Mitarbeiterstabilität zu fördern und die Fluktuation zu verringern. Zudem wird ein alternativer Ausblick gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Zusammenhang von neuronaler Plastizität und Resilienz
- Definition der Salutogenese nach Aaron Antonovsky
- Definition Neuronale Plastizität
- Definition Resilienz
- Erkenntnisse aus den Definitionen
- Resilienzstudien
- Kauai-Längenschnittstudie
- Mannheimer Risikokinderstudie
- Bielefelder Invulnerabilitätsstudie
- Erkenntnisse aus den Studien
- Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Definition von Gesundheit
- Rechtliche Grundlagen für Prävention und Gesundheitsförderung
- Gründe für ein betriebliches Gesundheitsmanagement
- Strategische Einbettung des betrieblichen Gesundheitsmanagements im Unternehmen
- Gesundheitsförderliche Angebote durch den Arbeitgeber
- Betriebliches Eingliederungsmanagement
- Work-Life-Balance
- Personalpflege
- Zwischenfazit – zur Entwicklung der leitenden Fragestellung
- Einführung in die leitfadengestützten Interviews
- Welche Vorbereitungen müssen für ein leitfadengestütztes Interview getroffen werden?
- Die Entwicklung von Items
- Die Formulierung des Frage-Aussage-Teils von Items
- Die Skalierung der Items
- Die Fragebogenentwicklung
- Die Endfassung des Fragebogens und Auswertung
- Die Qualität der Endfassung des Fragebogens
- Vorbereitung des Fragebogens
- Beschreibung der Probanden und Ziel der Befragung
- Aufbau des Fragebogens
- Qualitative Inhaltsanalyse im Rahmen der Auswertung der Fragebögen nach Mayring
- Die Techniken qualitativer Inhaltsanalyse
- Die Grundformen des Interpretierens und die Interpretationsregeln
- Induktive und deduktive Kategorienbildung
- Leistungen und Grenzen qualitativer Inhaltsanalyse
- Erkenntnisse der Befragung
- Mitarbeitende in partizipativen Prozessen der Veränderung
- Change-Management
- Definition, Change-Management
- Ebenen der Veränderungen
- Mitarbeitende in Veränderungsprozessen
- Die sieben Typen der Mitarbeitenden in Veränderungsprozessen
- Die Bedeutung von Veränderungen und die Phasenmodelle
- Umgang mit Widerstand
- Partizipation der Mitarbeitenden in Veränderungsprozessen
- Voraussetzungen für partizipatives Handeln
- Formen der Partizipation
- Risiken partizipativen Handelns
- Change-Management
- Fazit
- Zusammenfassung
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterthesis befasst sich mit der Thematik der Resilienzförderung im Kontext des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) in sozialen Unternehmen. Ziel ist es, die Möglichkeiten und Grenzen der Resilienzförderung in Bezug auf die psychische und körperliche Belastung von Mitarbeiter*innen im Arbeitsumfeld der Sozialwirtschaft zu erforschen.
- Definition und Bedeutung von Resilienz im Zusammenhang mit neuronaler Plastizität und Salutogenese
- Bedeutung des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) für die Mitarbeiter*innen in sozialen Unternehmen
- Analyse der Arbeitsbelastung und Stressoren im Arbeitsumfeld der Sozialwirtschaft
- Entwicklung und Durchführung einer leitfadengestützten Befragung zur Resilienzförderung im BGM
- Bewertung der Ergebnisse der Befragung und Ableitung von Handlungsempfehlungen für die Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz der Thematik im Kontext des stetig steigenden Krankenstands in sozialen Berufen dar und beleuchtet die besonderen Herausforderungen der Arbeitswelt im pädagogischen Bereich. Anschließend werden in Kapitel 2 die zentralen Begriffe der Salutogenese, neuronalen Plastizität und Resilienz definiert und deren Bedeutung für die Arbeitswelt im Kontext des BGM erläutert. Kapitel 3 befasst sich mit der Vorstellung und Analyse verschiedener Resilienzstudien und deren Erkenntnisse für die Förderung von psychischer und körperlicher Widerstandsfähigkeit.
Kapitel 4 widmet sich dem betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) und erläutert dessen Bedeutung, rechtliche Grundlagen und konkrete Möglichkeiten zur Gesundheitsförderung im Unternehmen. In Kapitel 5 erfolgt ein Zwischenfazit und die Entwicklung der leitenden Fragestellung der Masterthesis. Kapitel 6 gibt einen Überblick über die Methode der leitfadengestützten Interviews und deren Anwendung im Rahmen der Forschungsarbeit. Kapitel 7 beschreibt die Vorbereitung des Fragebogens, die Durchführung der Befragung und die Anwendung der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring zur Auswertung der Daten.
Kapitel 8 untersucht die Rolle der Mitarbeitenden in Veränderungsprozessen und die Bedeutung partizipativen Handelns für die erfolgreiche Implementierung von Resilienzförderung im BGM. Schließlich fasst das Fazit der Masterthesis die Ergebnisse zusammen, bietet einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen und gibt Handlungsempfehlungen für die Praxis ab.
Schlüsselwörter
Die Masterthesis beschäftigt sich mit den Themen Resilienzförderung, Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM), soziale Unternehmen, Arbeitsbelastung, Stress, psychische und körperliche Gesundheit, qualitative Inhaltsanalyse, Veränderungsprozesse, Partizipation und Handlungsempfehlungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Zusammenhang zwischen neuronaler Plastizität und Resilienz?
Die neuronale Plastizität belegt, dass das Gehirn lebenslang lernfähig ist. Dies bedeutet, dass Menschen auch im fortgeschrittenen Alter noch Resilienz – also psychische Widerstandsfähigkeit – erlernen und entwickeln können.
Was versteht man unter Salutogenese nach Antonovsky?
Die Salutogenese ist ein Konzept, das sich nicht mit der Entstehung von Krankheiten befasst, sondern mit den Faktoren, die die Gesundheit erhalten und fördern.
Welche Rolle spielt das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM)?
BGM dient dazu, Belastungen am Arbeitsplatz zu reduzieren und die Gesundheit der Mitarbeiter systematisch zu fördern, was besonders in sozialen Unternehmen zur Verringerung der Fluktuation beiträgt.
Welche Resilienzstudien werden in der Arbeit herangezogen?
Die Arbeit analysiert klassische Studien wie die Kauai-Längsschnittstudie, die Mannheimer Risikokinderstudie und die Bielefelder Invulnerabilitätsstudie.
Wie können Mitarbeiter in Veränderungsprozesse einbezogen werden?
Durch Partizipation und Change-Management-Methoden können Widerstände abgebaut und die Akzeptanz für gesundheitsfördernde Maßnahmen im Unternehmen erhöht werden.
- Quote paper
- Julia Groeneveld (Author), 2022, Der Zusammenhang von Resilienz und betrieblichem Gesundheitsmanagement, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1196171