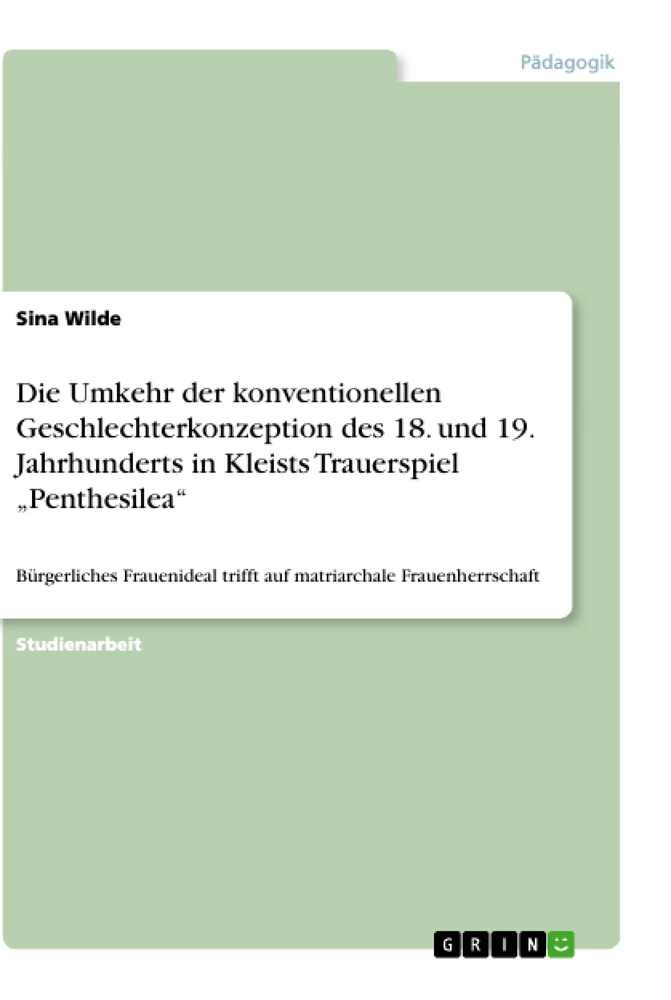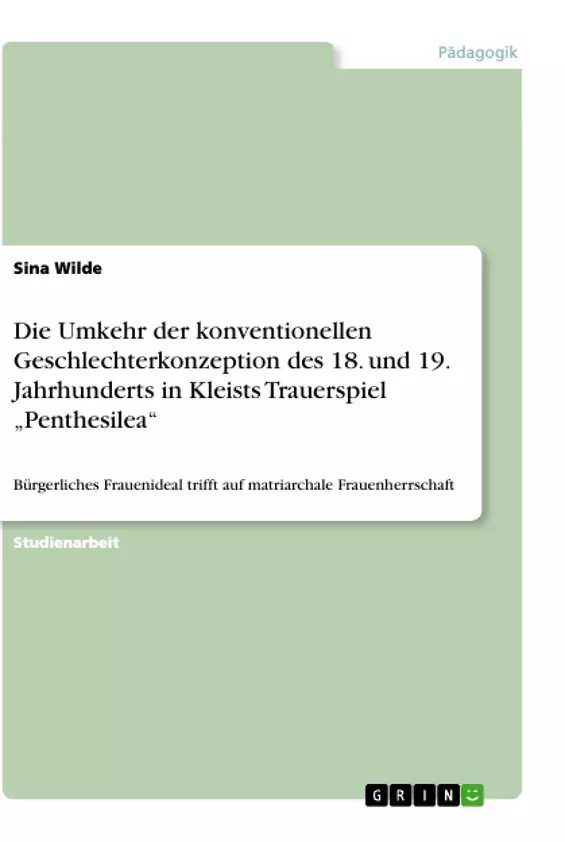Diese Arbeit wird der Frage nachgehen, welche Weiblichkeits- bzw. Geschlechterkonzeption der bürgerlichen Gesellschaft des 18. und 19. Jahrhundert zugrunde lag und warum diese Rollenkonzeption mit Kleists Konzept eines autonomen Frauenstaates unweigerlich kollidieren muss.
Die im 19. Jahrhundert und weit bis ins 20. Jahrhundert herrschende Dichotomie der Geschlechter, hob Kleist immer wieder in seinen Stücken auf. Meist nur minimal, in seiner "Penthesilea" hingegen geradezu brachial. Kleists Königin der Amazonen entspricht ganz und gar nicht dem im 19. Jahrhundert gängigen Weiblichkeitsideal, welches das Glück der Frau in der privaten, häuslichen Sphäre verortet, wohingegen der Platz des Mannes die öffentliche Sphäre ist, in welcher er sein Glück in der Anerkennung für seine geleistete Arbeit finden sollte.
Mit seiner Protagonistin Penthesilea, welche in einem Staat geboren und sozialisiert wurde, in dem Männer nur Kriegsbeute sind und ausschließlich der Fortpflanzung dienen, verkehrt Kleist die gängigen Geschlechterrollen ins Gegenteil. Im Laufe der Tragödie gerät Penthesilea mit der ihr von der Amazonengesellschaft zugewiesenen Rolle und der von ihr, nach dem Entflammen ihrer Liebe zu Achill, ersehnten Rolle in einen Konflikt, dessen Ende aufgrund seiner bestialischen Grausamkeit für den bürgerlichen Rezipientenkreis des 19. Jahrhunderts derart erschreckend wirkte, dass man zunächst äußerst ablehnend auf sein Werk reagiert hat.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Weiblichkeitskonzeption in der bürgerlichen Gesellschaft des 18. und 19. Jahrhunderts - Die seichte Frau als neues Ideal
- 2.1. „Und bist Du nicht willig, so brauch ich Gewalt...“ - Transformation der Frauenrolle im 19. Jahrhundert
- 3. Der Amazonenstaat in Kleists Drama, Penthesilea‘
- 3.1. Kleists Amazonenstaat - Wahrheit oder Mythos?
- 3.2. Die Staatsgründung als Akt der weiblichen Emanzipation - Zur ,Widernatürlichkeit der Frauenherrschaft in Kleists Tragödie
- 3.3. Die Konstitution des Amazonenstaates als vermeintlich matriarchale Utopie - Die Freiheit der Amazonen wird Penthesilea zum Verhängnis
- 4. Penthesileas Konflikt - Kumulation der Affekte
- 4.1. Penthesileas falscher Sieg und Achills Verrat - „Da werden Weiber zu Hyänen (gemacht)...“
- 4.2. Penthesilea im berserk state -,Anmut' trifft auf martialischen Zivilisationsbruch
- 4.3. Die Königin ist tot - Penthesileas Verzweiflungstat führt zur Auflösung des Amazonenstaats
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, wie Kleist in seiner Tragödie „Penthesilea“ die Geschlechterrollen des 18. und 19. Jahrhunderts konterkariert. Es soll analysiert werden, welche konventionelle Weiblichkeits- und Geschlechterkonzeption der bürgerlichen Gesellschaft zugrunde lag und warum diese mit Kleists Konzept eines autonomen Frauenstaates unvereinbar ist.
- Die konventionelle Geschlechterkonzeption des 18. und 19. Jahrhunderts
- Die Transformation der Frauenrolle im 19. Jahrhundert
- Die Konstruktion des Amazonenstaates in Kleists „Penthesilea“
- Die vermeintliche „Widernatürlichkeit“ der Frauenherrschaft in Kleists Tragödie
- Penthesileas Konflikt mit der ihr zugewiesenen Rolle in der Amazonengesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt mit einem Zitat aus „Penthesilea“ in die Thematik des Frauenstaates ein und stellt die zentrale Frage nach der "Widernatürlichkeit" weiblicher Herrschaft in Kleists Tragödie. Anschließend werden die zentralen Zielsetzungen und Themen der Arbeit erläutert.
Kapitel 2 beleuchtet die traditionelle Weiblichkeitskonzeption der bürgerlichen Gesellschaft des 18. und 19. Jahrhunderts. Es wird dargelegt, wie Frauen in der öffentlichen Sphäre marginalisiert und auf die private Sphäre beschränkt wurden.
Kapitel 3 befasst sich mit der Konzeption des Amazonenstaates in Kleists „Penthesilea“. Hier werden die historischen und literarischen Grundlagen des Frauenstaates untersucht sowie die scheinbare „Widernatürlichkeit“ der Staatsgründung analysiert. Es wird außerdem auf die Grenzen der vermeintlich matriarchalen Utopie des Amazonenstaates hingewiesen.
Kapitel 4 untersucht den inneren Konflikt Penthesileas, der sich aus der Kumulation von verschiedenen Affekten speist. Es wird analysiert, wie Penthesileas falscher Sieg und Achills Verrat zur Auflösung des Amazonenstaates führen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselbegriffe dieser Arbeit sind: Geschlechterrollen, Weiblichkeitskonzeption, bürgerliche Gesellschaft, Frauenherrschaft, Amazonenstaat, „Penthesilea“, Heinrich von Kleist, Matriarchat, Emanzipation, „Widernatürlichkeit“, Konflikt, Affekte, Auflösung, Tragödie.
Häufig gestellte Fragen
Wie bricht Kleist in „Penthesilea“ mit Geschlechterrollen?
Er verkehrt die Rollen des 19. Jahrhunderts ins Gegenteil: Frauen sind kriegerische Herrscherinnen, während Männer nur als Kriegsbeute und zur Fortpflanzung dienen.
Was war das Weiblichkeitsideal des 18. und 19. Jahrhunderts?
Frauen wurden primär in der häuslichen, privaten Sphäre verortet und als sanft und passiv idealisiert, während der Mann die öffentliche Sphäre dominierte.
Warum scheitert Penthesilea am Ende?
Sie gerät in einen unlösbaren Konflikt zwischen ihrer Rolle als Amazonenkönigin und ihrer individuellen Liebe zu Achill, was in Wahnsinn und Zerstörung endet.
Was ist das Besondere am Amazonenstaat bei Kleist?
Es ist eine matriarchale Utopie, die als Akt der Emanzipation gegründet wurde, aber durch ihre strengen Gesetze die individuelle Freiheit unterdrückt.
Wie reagierte das zeitgenössische Publikum auf das Stück?
Das bürgerliche Publikum war schockiert über die bestialische Grausamkeit und den Bruch mit allen gängigen Moralvorstellungen der Zeit.
Was bedeutet „Widernatürlichkeit“ in diesem Kontext?
Zeitgenossen empfanden die Vorstellung einer Frauenherrschaft und die kriegerische Natur der Amazonen als Verstoß gegen die „natürliche“ Ordnung der Geschlechter.
- Quote paper
- Bachelor of Education Sina Wilde (Author), 2020, Die Umkehr der konventionellen Geschlechterkonzeption des 18. und 19. Jahrhunderts in Kleists Trauerspiel „Penthesilea“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1196247