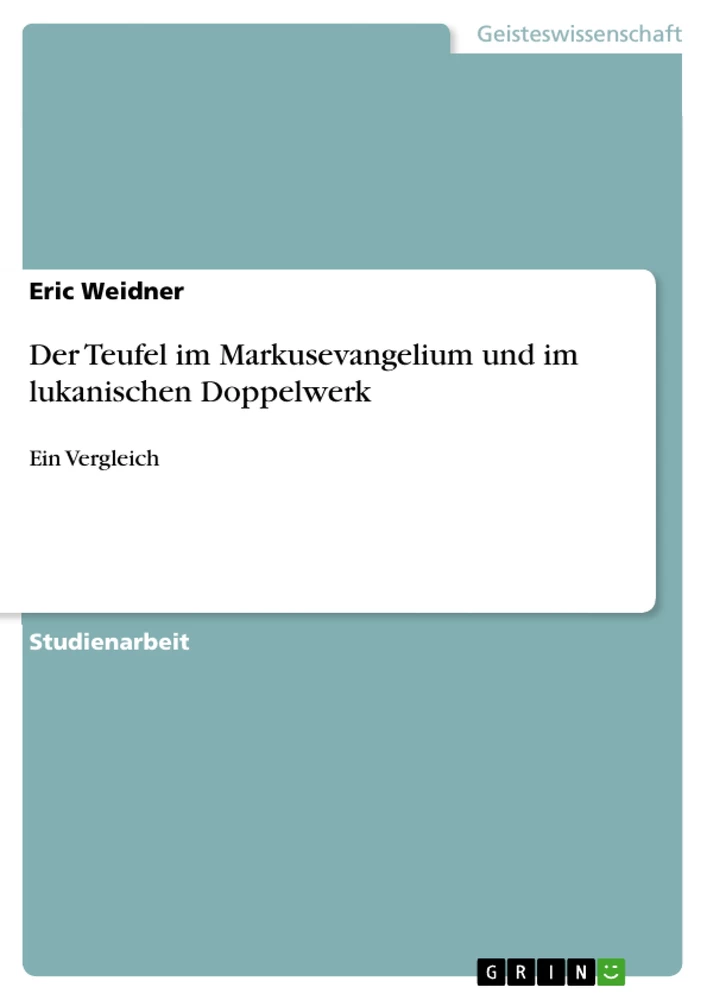„Das hat dir der Teufel gesagt!“ – So erklärt in Grimms Märchen das Rumpelstilzchen die eigentlich unerklärliche Tatsache, dass die Königstochter plötzlich seinen Namen weiß. Der Hörer des Märchens weiß es natürlich besser, da die Information schlicht und ergreifend von einem Boten erlauscht wurde. Die Frage ist nun für die neutestamentlichen Schriften, ob dort auch wie im o. g. Märchen unerklärliche Phänomene von Autoren oder Zeitzeugen pauschal dem Teufel zugeschrieben wurden. Das würde bedeuten, dass nach dem dazu gewonnen Wissen die Rede vom Teufel heute wohl völlig zu entmythologisieren wäre.
Ich möchte in dieser Arbeit untersuchen, welche Sicht auf den Teufel das Markus-Evangelium und das lukanische Doppelwerk widerspiegeln. Dazu werde ich zunächst in einem sprachlichen Befund darstellen, mit welcher Terminologie Markus und Lukas vom Teufel reden.
Danach folgen die beiden Hauptteile der Arbeit, in denen zuerst das Markus-Evangelium, dann das lukanische Doppelwerk untersucht wird. Dabei wird jeweils in einem ersten Schritt eine mögliche Verbindung des Teufels mit anderen Zwischenwesen erwogen. Ist eine Zusammengehörigkeit der beiden nachzuweisen, so ergibt sich aus den Eigenschaften der Zwischenwesen die mittelbare Wirkweise des Teufels. Im zweiten Schritt prüfe ich, inwieweit dem Teufel selbst eine unmittelbare Wirkweise zugesprochen wird, wie er also konkret auf die Menschen einwirkt. Den dritten Schritt bildet dann die Einordnung der Beobachtungen in den theologischen Zusammenhang des jeweiligen Werkes.
Bei der Untersuchung des lukanischen Doppelwerkes wird es schon vergleichende Rückverweise auf Mk geben. Diese vergleichenden Elemente werden im anschließenden Kapitel noch einmal auf die wichtigsten Punkte zusammengefasst und überblicksartig dargestellt.
Vor dem Ausblick auf eine mögliche weitergehende Beschäftigung mit dem Thema steht dann der Ertrag aus der vorangegangenen exegetischen Arbeit. Dort werde ich auch eine Antwort auf die Frage versuchen, inwieweit der Teufel oder die Rede von ihm zumindest nach der Beschäftigung mit Mk und dem lukanischen Doppelwerk zu entmythologisieren ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zur Terminologie des Teufels
- 2.1. Eigennamen des Teufels
- 2.2. Nebenbegriffe für den Teufel
- 2.3. Terminologie des Teufels
- 3. Der Teufel im Markus-Evangelium
- 3.1. Die mittelbare Wirkweise des Teufels im Markus-Evangelium
- 3.1.1. Die Trennung von pneu/mata und daimo/nia
- 3.1.2. Die Verbindung des Teufels mit daimo/nia
- 3.1.3. Die mittelbare Wirkweise des Teufels durch daimo/nia
- 3.2. Die unmittelbare Wirkweise des Teufels im Markus-Evangelium
- 3.2.1. Der Widersacher Jesu Christi
- 3.2.2. Der Widersacher der Menschen
- 3.2.3. Der Verführer
- 3.2.4. Die unmittelbare Wirkweise des Teufels
- 3.3. Der Teufel in der markinischen Theologie
- 3.3.1. Die Funktion des Teufels im Gesamtkonzept des Evangeliums
- 3.3.2. Der Teufel als Ursache des moralischen Übels
- 3.1. Die mittelbare Wirkweise des Teufels im Markus-Evangelium
- 4. Der Teufel im lukanischen Doppelwerk
- 4.1. Die mittelbare Wirkweise des Teufels im lukanischen Doppelwerk
- 4.1.1. Die Verbindung von pneu/mata und daimo/nia
- 4.1.2. Die Verbindung des Teufels mit pneu/mata und daimo/nia
- 4.1.3. Die mittelbare Wirkweise des Teufels durch pneu/mata und daimo/nia
- 4.2. Die unmittelbare Wirkweise des Teufels im lukanischen Doppelwerk
- 4.2.1. Der Widersacher Jesu Christi
- 4.2.2. Der Widersacher der Menschen
- 4.2.3. Der Verführer
- 4.2.4. Die unmittelbare Wirkweise des Teufels
- 4.3. Der Teufel in der lukanischen Theologie
- 4.3.1. Die Funktion des Teufels im Gesamtkonzepts des Doppelwerks
- 4.3.2. Der Teufel als Ursache des moralischen und des physischen Übels
- 4.1. Die mittelbare Wirkweise des Teufels im lukanischen Doppelwerk
- 5. Vergleich des Teufels in der lukanischen und markinischen Theologie
- 6. Ertrag
- 7. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung des Teufels im Markus-Evangelium und im lukanischen Doppelwerk. Ziel ist es, die jeweiligen Perspektiven auf den Teufel zu vergleichen und zu analysieren, inwiefern eine Entmythologisierung der Teufelsfigur im heutigen Verständnis gerechtfertigt ist.
- Terminologie des Teufels in Markus und Lukas
- Mittelbare und unmittelbare Wirkweise des Teufels
- Theologische Einordnung des Teufels im jeweiligen Evangelium
- Vergleich der Darstellungen in Markus und Lukas
- Möglichkeiten der Entmythologisierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und skizziert den Forschungsansatz. Kapitel 2 analysiert die unterschiedliche Terminologie zur Bezeichnung des Teufels in den untersuchten Texten. Kapitel 3 befasst sich mit der Darstellung des Teufels im Markus-Evangelium, indem es seine mittelbare und unmittelbare Wirkweise sowie dessen theologische Funktion im Gesamtkonzept des Evangeliums beleuchtet. Kapitel 4 wiederholt diese Analyse für das lukanische Doppelwerk. Kapitel 5 schließlich vergleicht die Ergebnisse der vorherigen Kapitel.
Schlüsselwörter
Markus-Evangelium, lukanisches Doppelwerk, Teufel, satana~j, dia/boloj, Beelzebul, pneumata, daimonia, mittelbare Wirkweise, unmittelbare Wirkweise, theologische Funktion, Entmythologisierung.
Häufig gestellte Fragen
Welche Namen werden im Neuen Testament für den Teufel verwendet?
Häufige Bezeichnungen sind Satana~j (Satan), dia/boloj (Teufel) und Beelzebul.
Wie wirkt der Teufel laut dem Markusevangelium?
Markus beschreibt sowohl eine mittelbare Wirkweise durch Dämonen (daimonia) als auch eine unmittelbare Wirkweise als Widersacher Jesu und Verführer der Menschen.
Was unterscheidet die Sicht des Lukas von der des Markus?
Lukas verbindet den Teufel stärker mit der Ursache sowohl moralischen als auch physischen Übels und bettet ihn in das Gesamtkonzept seines Doppelwerks (Evangelium und Apostelgeschichte) ein.
Sollte die Rede vom Teufel heute entmythologisiert werden?
Die Arbeit untersucht, ob der Teufel nur eine pauschale Erklärung für damals unerklärliche Phänomene war oder ob die theologische Funktion der Figur auch heute noch eine Bedeutung jenseits der Mythologie hat.
Welche Beziehung besteht zwischen dem Teufel und „pneuma“?
In den Schriften wird untersucht, wie sich unreine Geister (pneu/mata) zu Dämonen und letztlich zum Teufel als deren Oberhaupt verhalten.
- Arbeit zitieren
- Eric Weidner (Autor:in), 2005, Der Teufel im Markusevangelium und im lukanischen Doppelwerk, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119687