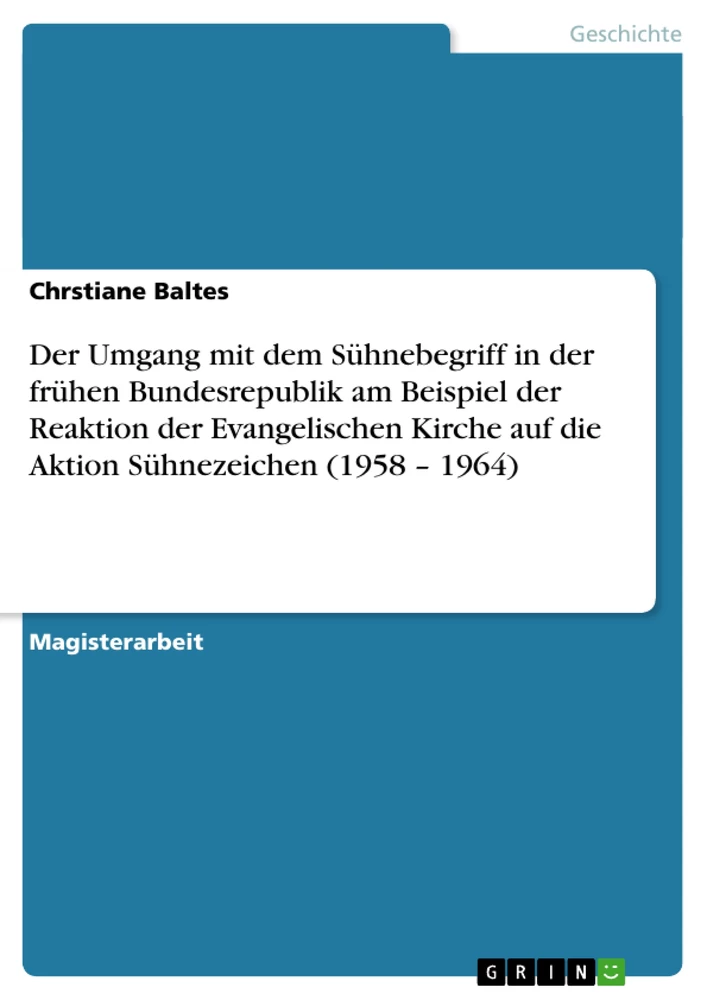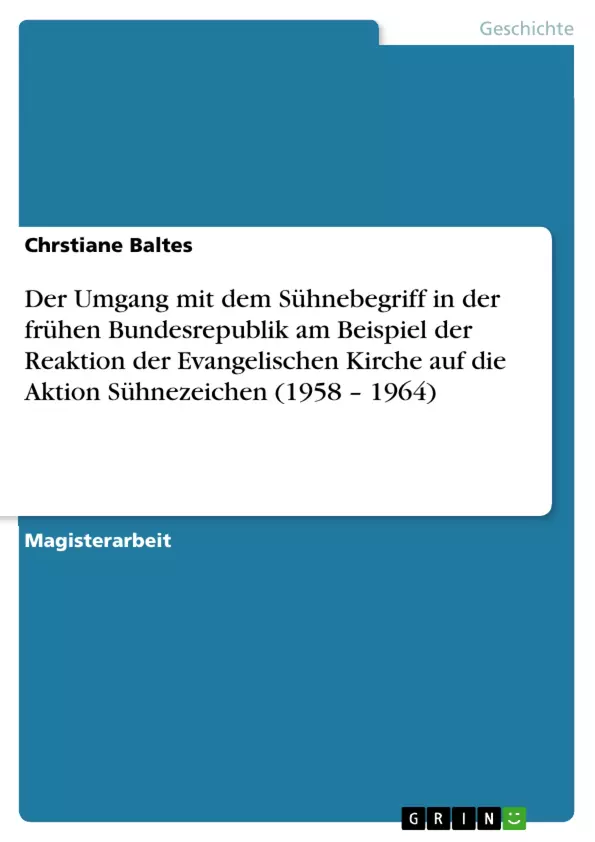Holocaust-Forschung, internationale Erinnerungskulturen sowie das Verhältnis zwischen Judentum und Christentum bildeten die Schwerpunkte meines Studiums und meines geschichtlichen Interesses. Die NS-Zeit und ihre unterschiedliche Aufarbeitung bzw. Verdrängung auf nationaler, kultureller und politischer Ebene ließen mich immer wieder neue Aspekte entdecken und weiterführende Fragen zu den Wurzeln des Antisemitismus’ und dessen Auswirkungen stellen. Die ambivalente Beziehung zwischen Judentum und Christentum erschien mir in diesem Zusammenhang sehr wichtig und interessant. Aktion Sühnezeichen ist eine protestantische Organisation, die in ihrer Arbeit eine Vielzahl dieser Aspekte vereint. Sie rief Ende der fünfziger Jahre deutsche Christen dazu auf, durch unterschiedliche Hilfsdienste ein ‚Sühnezeichen’ zur Versöhnung
in den Ländern zu errichten, die besonders unter der Gewaltherrschaft und den
Gräueltaten des Nationalsozialismus gelitten hatten. Häufig richteten sich die Projekte an den verschiedenen Orten an Juden.
In der Kirchlichen Zeitgeschichte existiert zwar eine Fülle an Forschungsergebnissen zur Kirche im Dritten Reich bzw. zum Kirchenkampf, aber der Themenkomplex Protestantismus und Holocaust in der bundesdeutschen Nachkriegszeit wurde bisher eher vernachlässigt. Mein erkenntnisleitendes Interesse liegt also in der Untersuchung des praktischen Umgangs mit den Begriffen Schuld und Sühne im Protestantismus der beginnenden Wirtschaftswunderzeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen und Hintergründe
- 2.1. Politische Debatten
- 2.2. Mentalitätsgeschichtliche Positionsbestimmung
- 2.3. Die Evangelische Kirche der Nachkriegszeit
- 2.4. Theologiegeschichtlicher Kontext
- 3. Die Evangelische Kirche und die Aktion Sühnezeichen
- 3.1. Lothar Kreyssig – zur Person des Gründers der Aktion Sühnezeichen
- 3.2. Gründung der Aktion Sühnezeichen und erste Reaktionen (1958 bis 1959)
- 3.3. Expansion von Aktion Sühnezeichen und Unterstützung durch die Evangelische Kirche (1959 bis 1961)
- 3.4. Mauerbau und Kontroversen (1961 bis 1964)
- 4. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Reaktionen der Evangelischen Kirche in der frühen Bundesrepublik auf die Gründung der Aktion Sühnezeichen (1958-1964). Die Arbeit analysiert den praktischen Umgang mit den Begriffen Schuld und Sühne im Kontext der Nachkriegszeit und der beginnenden Wirtschaftswunderjahre. Sie beleuchtet die Wechselwirkungen zwischen der Kirche, der Politik und der Gesellschaft und betrachtet die Aktion Sühnezeichen als Spiegel der sozialhistorischen Verhältnisse.
- Der Umgang der Evangelischen Kirche mit dem Begriff der Sühne nach dem Zweiten Weltkrieg.
- Die Rolle der Aktion Sühnezeichen im Kontext der bundesdeutschen Nachkriegsgesellschaft.
- Die politischen und theologischen Debatten um Schuld und Versöhnung im Protestantismus.
- Die Beziehung zwischen der Evangelischen Kirche und der Aktion Sühnezeichen.
- Die Auswirkungen des Mauerbaus auf die Arbeit der Aktion Sühnezeichen.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein, stellt die Forschungsfrage nach den Reaktionen der Evangelischen Kirche auf die Aktion Sühnezeichen dar und beschreibt die Methodik der Arbeit. Es betont den Mangel an Forschung zum Protestantismus und dem Holocaust in der bundesdeutschen Nachkriegszeit und unterstreicht die Bedeutung der Untersuchung des praktischen Umgangs mit Schuld und Sühne in dieser Zeit. Die Bedeutung der Aktion Sühnezeichen als protestantische Organisation, die Aspekte des Holocaust, des Verhältnisses von Judentum und Christentum und der Versöhnung vereint, wird hervorgehoben.
2. Grundlagen und Hintergründe: Dieses Kapitel liefert den Kontext für die Untersuchung. Es skizziert die politischen Debatten der frühen Bundesrepublik (Wiederbewaffnung, Westorientierung, Ostpolitik), die mentalitätsgeschichtlichen Gegebenheiten (Massenkonsum, Aufarbeitung der NS-Vergangenheit) und die Situation der Evangelischen Kirche (Organisation, politische Verantwortung, Vergangenheitsbewältigung). Es beleuchtet den theologischen Kontext, insbesondere die Diskussion um Schuld und Sühne im Protestantismus und das christlich-jüdische Verhältnis. Dieses Kapitel legt die Grundlage für das Verständnis der Reaktionen der Kirche auf die Aktion Sühnezeichen.
3. Die Evangelische Kirche und die Aktion Sühnezeichen: Der Hauptteil der Arbeit analysiert die Reaktionen der Evangelischen Kirche auf die Aktion Sühnezeichen chronologisch. Es wird die Person Lothar Kreyssig, der Gründer der Aktion, vorgestellt, gefolgt von einer detaillierten Darstellung der Gründung und der Entwicklung der Organisation, ihrer Expansion, ihrer Unterstützung durch die Kirche und den damit verbundenen Kontroversen. Besondere Aufmerksamkeit wird dem Einfluss des Mauerbaus und den unterschiedlichen Reaktionen in Ost- und Westdeutschland gewidmet. Die Arbeit untersucht auch die Beziehungen der Aktion Sühnezeichen zu anderen kirchlichen Institutionen und die Herausforderungen und Probleme, die mit ihrer Projektarbeit verbunden waren.
Schlüsselwörter
Aktion Sühnezeichen, Evangelische Kirche, Bundesrepublik Deutschland, Schuld, Sühne, Versöhnung, Holocaust, Nachkriegszeit, Protestantismus, Judentum, Christentum, Politische Debatten, Mentalitätsgeschichte, Theologiegeschichte.
Häufig gestellte Fragen zur Magisterarbeit: Die Evangelische Kirche und die Aktion Sühnezeichen (1958-1964)
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die Reaktionen der Evangelischen Kirche in der frühen Bundesrepublik Deutschland (1958-1964) auf die Gründung der Aktion Sühnezeichen. Sie analysiert den Umgang mit Schuld und Sühne im Kontext der Nachkriegszeit und der Wirtschaftswunderjahre und beleuchtet die Wechselwirkungen zwischen Kirche, Politik und Gesellschaft.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf den Umgang der Evangelischen Kirche mit dem Begriff der Sühne nach dem Zweiten Weltkrieg, die Rolle der Aktion Sühnezeichen in der bundesdeutschen Gesellschaft, die politischen und theologischen Debatten um Schuld und Versöhnung im Protestantismus, die Beziehung zwischen der Evangelischen Kirche und der Aktion Sühnezeichen sowie die Auswirkungen des Mauerbaus auf die Arbeit der Aktion Sühnezeichen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Einleitung, Grundlagen und Hintergründe, Die Evangelische Kirche und die Aktion Sühnezeichen, sowie Zusammenfassung und Ausblick. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und Methodik vor. Das zweite Kapitel liefert den historischen und theologischen Kontext. Das dritte Kapitel analysiert die Reaktionen der Kirche auf die Aktion Sühnezeichen chronologisch. Das letzte Kapitel fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick.
Wer war Lothar Kreyssig und welche Rolle spielte er?
Lothar Kreyssig war der Gründer der Aktion Sühnezeichen. Die Arbeit stellt seine Person vor und beschreibt seine Bedeutung für die Gründung und Entwicklung der Organisation.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die konkrete Quellenangabe ist in der vollständigen Magisterarbeit aufgeführt und hier nicht im Detail wiedergegeben. Es ist jedoch ersichtlich, dass die Arbeit auf historischen Dokumenten, politischen Debatten und theologischen Schriften basiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Aktion Sühnezeichen, Evangelische Kirche, Bundesrepublik Deutschland, Schuld, Sühne, Versöhnung, Holocaust, Nachkriegszeit, Protestantismus, Judentum, Christentum, Politische Debatten, Mentalitätsgeschichte, Theologiegeschichte.
Welche Methodik wurde angewendet?
Die genaue Methodik wird in der Einleitung der Magisterarbeit detailliert beschrieben. Die Arbeit verwendet eine historische Analyse, die politische, gesellschaftliche und theologische Aspekte berücksichtigt.
Welche Bedeutung hat die Aktion Sühnezeichen im Kontext der Arbeit?
Die Aktion Sühnezeichen dient als Fallbeispiel, um den Umgang der Evangelischen Kirche mit Schuld und Sühne nach dem Zweiten Weltkrieg zu untersuchen. Sie repräsentiert eine protestantische Organisation, die Aspekte des Holocaust, des Verhältnisses von Judentum und Christentum und der Versöhnung vereint.
Wie wird der Mauerbau in der Arbeit behandelt?
Der Mauerbau wird als ein entscheidendes Ereignis behandelt, das die Arbeit der Aktion Sühnezeichen und die Reaktionen der Evangelischen Kirche in Ost- und Westdeutschland beeinflusste. Die Arbeit untersucht die unterschiedlichen Reaktionen auf die Teilung Deutschlands.
- Arbeit zitieren
- Chrstiane Baltes (Autor:in), 2006, Der Umgang mit dem Sühnebegriff in der frühen Bundesrepublik am Beispiel der Reaktion der Evangelischen Kirche auf die Aktion Sühnezeichen (1958 – 1964), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119698