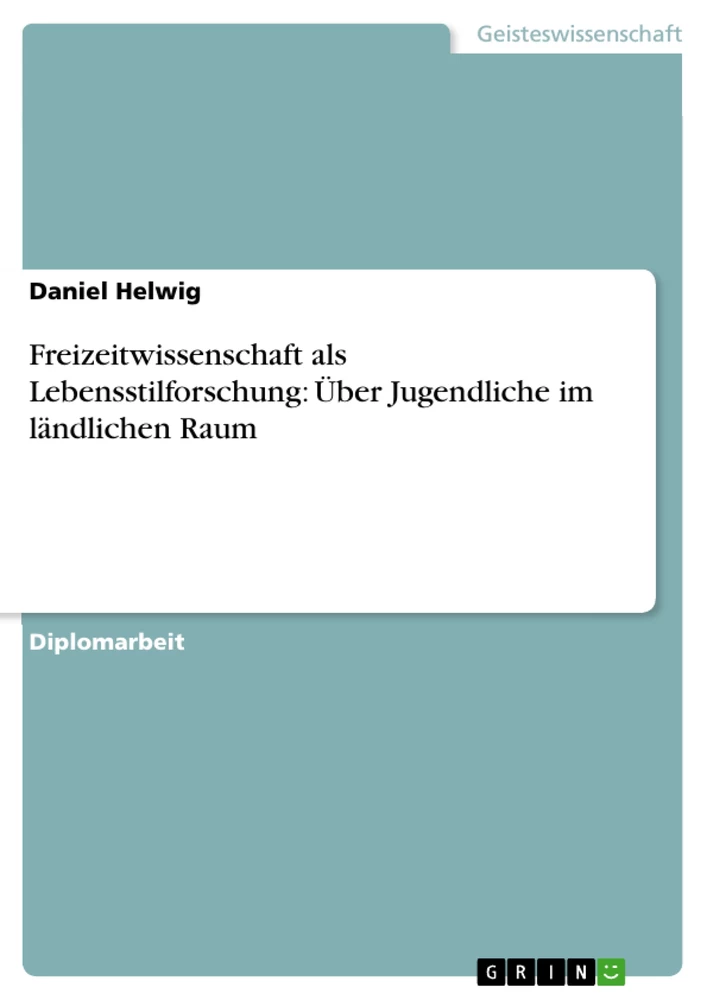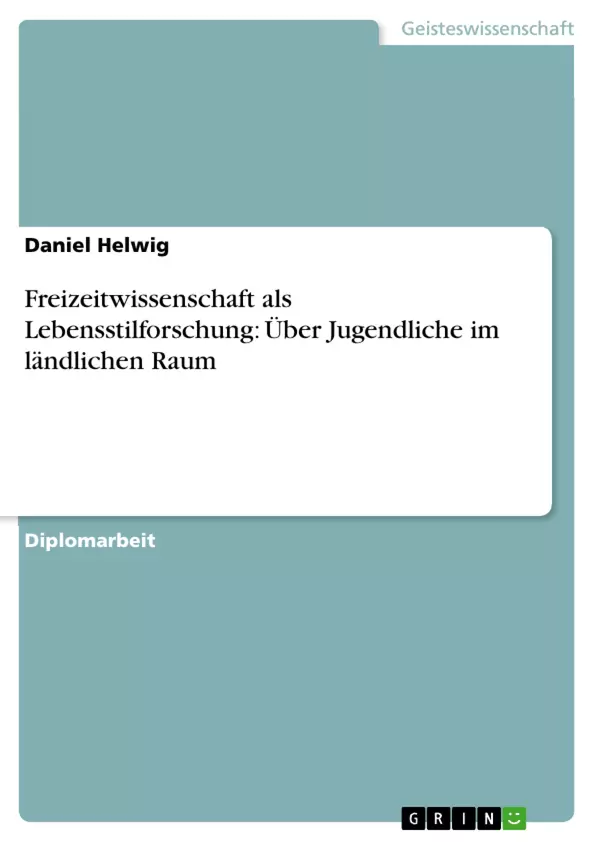Am Anfang des neuen Jahrtausends verfügen die Menschen in Deutschland
über ein zunehmend wachsendes Ausmaß an freier Zeit und in der wissenschaftlichen Literatur wird die Vorstellung evident, dass es Abschied zu nehmen heißt von der traditione llen Arbeitsgesellschaft (OPASCHOWSKI 1997, S.11).
Der moderne Mensch verbringt – grob geschätzt - nur noch jede sechste Stunde seines Lebens in der Schule oder an seinem Arbeitsplatz (LAMPRECHT/STAMM 1994, S.17).
„In dem Maße, wie die Freizeit an Bedeutung gewinnt und zum großen Geschäft wird, beginnt sie, das gesellschaftliche Leben und unsere Denk- und Vorstellungsmuster mitzuprägen“ (LAMPRECHT/STAMM 1994, S.18).
Da die Soziologie eine Wissenschaft ist, die sich mit den Strukturen und Funktionen der Gesellschaft auseinandersetzt, darf sie einen gesellschaftlichen Bereich, der im Leben der Menschen so viel Platz einnimmt wie die Freizeit, nicht außer Acht lassen.
Mit Erscheinen von Bourdieus „Die feinen Unterschiede“ hat seit Anfang der achtziger Jahre in der Soziologie die Lebensstilforschung Konjunktur (GARHAMMER 2000, S.296). Die Wissenschaftler dieser Forschungsrichtung gehen davon aus, dass im Zuge einer Individualisierung und Pluralisierung der Lebenslagen,
einhergehend mit einer Entstrukturierung der Klassengesellschaft,
die lebensweltliche Plausibilität von herkömmlichen Klassen- und Schichtmodellen zur Interpretation sozialer Wirklichkeit abnimmt (MÜLLER 1992, S.11f.). Die Lebensstilforschung, so nimmt man nun an, könne als analytisches Werkzeug die klassischen Messungen sozialer Ungleichheit ergänzen oder gar ersetzen (GEORG 1991, S.359).
Dabei wird darauf hingewiesen, dass die Freizeit, gerade im Verhältnis zur Arbeit, als Lebensbereich mit dem breitesten Spielraum für individuell disponibles und expressives Verhalten gilt. Sie ist der bevorzugte Bereich zur Verfolgung persönlicher Präferenzen und es bietet sich daher an zu versuchen, Lebensstile
auf Basis von Daten des Freizeitverhaltens zu rekonstruieren (LÜDTKE 1989, S.90f.).
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Freizeit: Historischer Rückblick und aktuelle Entwicklungslinien
- Begriffsgeschichte und neuere Definitionen von Freizeit
- Zur Begriffsgeschichte
- Negative Definitionsansätze
- Positive Definitionsansätze
- Festlegung einer Freizeitdefinition für diese Arbeit
- Soziologisch orientierte Freizeitwissenschaft
- Historischer Rückblick auf die soziologisch orientierte Freizeitwissenschaft
- Methoden der soziologischen Freizeitforschung
- Zum Einfluss des gesellschaftlichen Wandels auf die Entwicklung der Freizeit
- Zur Funktions- und Bedeutungsdimension von Freizeit
- Individuelle Bedeutungen und Funktionen
- Soziale Bedeutungen und Funktionen
- Freizeitwissenschaft als Lebensstilforschung
- Zu den Wurzeln der Lebensstilforschung
- Hintergründe zur Ausbreitung des Lebensstilkonzeptes
- Neuere Lebensstilkonzepte
- Zu Bourdieu
- Zu Lüdtke
- Zu Schulze
- Zusammenfassender Vergleich der Lebensstilkonzepte
- Freizeitstile: Theoretische Überlegungen und empirische Befunde einzelner Autoren
- Zu Giegler
- Zu Uttitz
- Zu Gluchowski
- Zu Vester
- Zu Garhammer
- Zu Lamprecht und Stamm
- Zusammenfassender Vergleich der einzelnen Autoren
- Fokus: Jugendphase
- Historische Betrachtung der Jugendphase
- Jugend heute: Definitions- und Abgrenzungsprobleme
- Zur Bedeutungsdimension von Freizeit in der Jugendphase
- Freizeitstile Jugendlicher
- Besonderheiten der Jugendphase im ländlichen Raum
- Versuch einer Stilbildung auf Grundlage einer Untersuchung zum Freizeitverhalten Jugendlicher der Stadt Schwalmstadt
- Untersuchungsort und Beschreibung der Stichprobe
- Methoden
- Design
- Instrument
- Pretest
- Haupterhebung
- Auswertungsverfahren des deskriptiven Teils
- Soziodemographische Merkmale der befragten Jugendlichen
- Alter
- Nationalität
- Wohnort
- Religionszugehörigkeit
- Familiäre Situation
- Berufstätigkeit der Eltern
- Zusammenfassung der soziodemographischen Merkmale
- Freizeit der Jugendlichen: Deskriptive Ergebnisse
- Freizeitassoziationen
- Freizeitaktivitäten
- Organisierte Freizeit
- Sportvereine
- Außerunterrichtliche schulische Angebote
- Kirchliche Angebote
- Jugendpflege
- Weitere organisierte Freizeitangebote
- Medienkonsum
- Musikverhalten
- Fernseh- und Videonutzung
- Lesegewohnheiten
- Computer- und Spielkonsolenbenutzung
- Sozialkontakte und Freundschaften
- Freizeitgestaltung am Wochenende
- Hausaufgaben und Mithilfe im Haushalt
- Finanzielle Mittel
- Werthaltung der befragten Jugendlichen
- Freizeitstile der befragten Jugendlichen
- Auswertungsverfahren zur Stilbildung
- Beschreibung der vier Freizeitstile
- Freizeitstil 1: „Moderne Aktivität“
- Freizeitstil 2: „Intellektuelle Enklave“
- Freizeitstil 3: „Mainstream“
- Freizeitstil 4: „Geselligkeit“
- Entwicklung der Freizeit im historischen Kontext
- Soziologische Ansätze zur Freizeitforschung
- Bedeutung von Freizeit in der Jugendphase
- Lebensstilforschung und die Analyse von Freizeitstilen
- Empirische Untersuchung des Freizeitverhaltens von Jugendlichen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit Freizeit als Lebensbereich im Kontext des gesellschaftlichen Wandels und der Individualisierung. Sie analysiert das Freizeitverhalten von Jugendlichen im ländlichen Raum und untersucht, inwiefern sich unterschiedliche Lebensstile anhand von Freizeitaktivitäten abbilden lassen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Fokus auf die zunehmende Bedeutung von Freizeit im modernen Leben setzt und die Relevanz der soziologischen Betrachtung dieses Bereichs hervorhebt. Kapitel 2 bietet einen historischen Rückblick auf die Begriffsgeschichte und Entwicklung der Freizeitforschung, beleuchtet soziologische Ansätze und analysiert den Einfluss des gesellschaftlichen Wandels auf die Freizeit. In Kapitel 3 wird das Konzept der Lebensstilforschung im Detail betrachtet, unterschiedliche Ansätze von Bourdieu, Lüdtke und Schulze werden vorgestellt und miteinander verglichen. Darüber hinaus werden diverse Freizeitstile, wie sie von Giegler, Uttitz, Gluchowski, Vester, Garhammer, Lamprecht und Stamm erforscht wurden, zusammengefasst und analysiert. Kapitel 4 konzentriert sich auf die Jugendphase als spezifischen Lebensabschnitt, beleuchtet die historische Entwicklung, heutige Definitions- und Abgrenzungsprobleme und die besondere Bedeutung von Freizeit für Jugendliche. Schließlich werden die Besonderheiten der Jugendphase im ländlichen Raum betrachtet.
Schlüsselwörter
Freizeit, Lebensstilforschung, Jugend, ländlicher Raum, soziologische Forschung, Individualisierung, gesellschaftlicher Wandel, Freizeitstile, empirische Untersuchung, Schwalmstadt
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Gegenstand der soziologischen Freizeitwissenschaft?
Sie untersucht Freizeit als gesellschaftlichen Bereich, der durch den Wandel von der Arbeitsgesellschaft zur Freizeitgesellschaft zunehmend an Bedeutung für Identität und Lebensstile gewinnt.
Wie hängen Freizeitverhalten und Lebensstilforschung zusammen?
Lebensstilforschung nutzt Daten des Freizeitverhaltens, um soziale Wirklichkeit jenseits klassischer Schichtmodelle zu interpretieren, da Freizeit Raum für individuelles und expressives Verhalten bietet.
Welche Freizeitstile wurden bei Jugendlichen in Schwalmstadt identifiziert?
Die empirische Untersuchung unterscheidet vier Stile: „Moderne Aktivität“, „Intellektuelle Enklave“, „Mainstream“ und „Geselligkeit“.
Welche Besonderheiten gibt es für Jugendliche im ländlichen Raum?
Die Arbeit beleuchtet spezifische Herausforderungen und Strukturen der Freizeitgestaltung in ländlichen Regionen im Vergleich zu urbanen Räumen.
Welche soziologischen Theoretiker werden in der Arbeit behandelt?
Es werden Konzepte von Pierre Bourdieu, Hartmut Lüdtke und Gerhard Schulze vorgestellt und miteinander verglichen.
Wie hat sich der Begriff "Freizeit" historisch entwickelt?
Die Arbeit bietet einen historischen Rückblick auf Begriffsdefinitionen und analysiert positive sowie negative Definitionsansätze von Freizeit.
- Arbeit zitieren
- Daniel Helwig (Autor:in), 2001, Freizeitwissenschaft als Lebensstilforschung: Über Jugendliche im ländlichen Raum, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1196