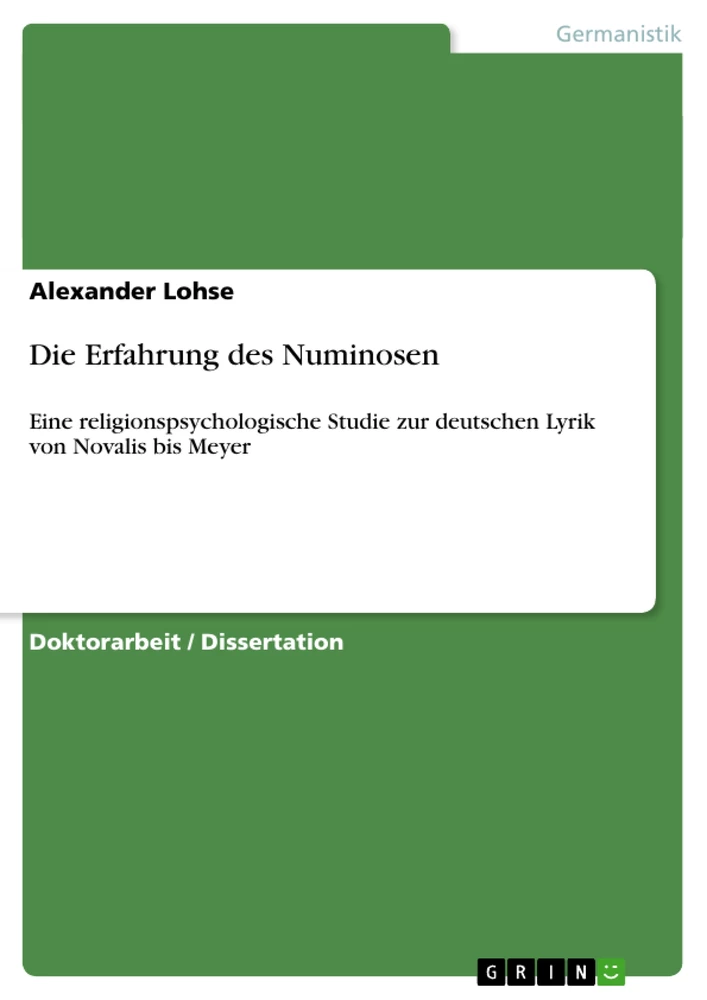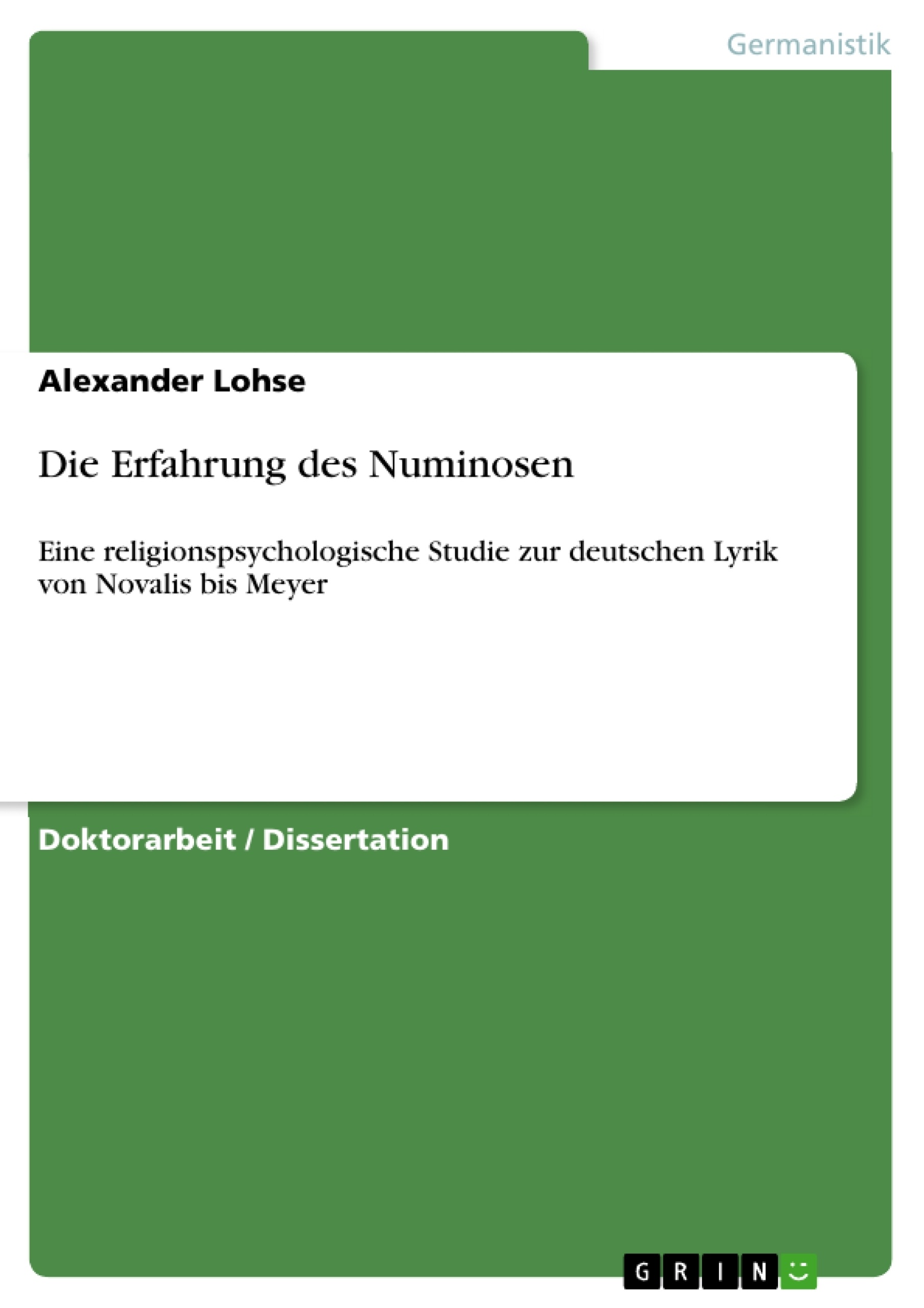Als allgegenwärtiger Hintergrund offenbart sich das ›Heilige‹ in der gesamten Vielfalt des deutschsprachigen schöngeistigen Schrifttumes. Wenn nur einmal die lyrische Gattung und hier auch nur das 19. Jh. betrachtet wird, stellen sich die Fragen, (1) welche Existenzialien diesen Hintergrund ermöglicht und aufrechterhalten haben. (2) In welchen Stilmitteln kommt die Erfahrung des ›Heiligen‹ vor, unter welche Kategorien lassen sie sich zusammenfassen und was haben verschiedene Stilelemente gemeinsam? (3) Prinzipiell sind die religionspsychologisch erklärbaren Erfahrungen eines lyrischen Aussagesubjektes von den persönlichen Empfindungen des Schriftsteller-Ich zu trennen; können unter dieser Berücksichtigung konstitutive Merkmale der religiösen Erfahrung aus verschiedenen lyrischen Formen herausgelöst, analysiert und mit einer festgelegten Terminologie beschrieben werden?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Vorwort und Leitfragen
- 1.2. Rahmen und Begriffskategorien der vorliegenden Arbeit
- 1.3. Wissenschaftliches Erkenntnisinteresse, Methode und Struktur der Arbeit
- 1.4. Die wissenschaftliche Literatur
- 2. Standpunkte der Religionswissenschaft und religionswissenschaftliche Aspekte, die der Deutung von Dichtung dienlich sind
- 2.1. Das Heilige und das Numinose
- 2.1.1. Die mystische Erfahrung und die Unmöglichkeit das Heilige zu definieren
- 2.1.2. Zur Geschichte der Religionswissenschaft und ihrer Definitionen
- 2.1.3. Standpunkte der Religionswissenschaft
- 2.1.3.1. Religionsphilosophie
- 2.1.3.2. Religionsphänomenologie
- 2.1.3.3. Religionspsychologie
- 2.1.3.3.1. William James (1842-1910)
- 2.1.3.3.2. Rudolf Otto (1869-1937)
- 2.1.3.3.2.1. Kategorien der religiösen Erfahrung in der Abhandlung Das Heilige, die der Gedichtinterpretation dienlich sind
- 2.1.3.3.2.2. Kritisches zur Abhandlung Das Heilige
- 2.1.3.3.3. Carl Gustav Jung (1875 - 1961)
- 2.2. Weitere Aspekte der religiösen Erfahrung, die der Gedichtinterpretation dienlich sind
- 2.2.1. Ein Aspekt des Urchristentums und des Gnostizismus: die Rückkehr
- 2.2.2. Ein Aspekt der griechisch-römischen Antike, der sich mit einem buddhistischen Aspekt berührt: Leidenschaftslosigkeit (Gelassenheit) und Gleichmut
- 2.2.3. Ein hinduistischer Aspekt: die Überzeugung das Absolute zu sein
- 3. Die Erfahrung des Numinosen in der deutschen Lyrik von 1799 bis 1886
- 3.1. Nachklassische Phase und Frühromantik (1798 - 1805)
- 3.1.1. Novalis (eigentl. Georg Friedrich Philipp Freiherr von Hardenberg, 1772-1801)
- 3.1.1.1. Novalis als Schriftsteller und lyrischer Dichter mystischer Erfahrungen
- 3.1.1.2. Novalis: Geistliches Lied XV
- 3.1.2. Karoline von Günderode (1780 - 1806)
- 3.1.2.1. Karoline als Schriftstellerin und lyrische Dichterin mystischer Erfahrungen
- 3.1.2.2. Karoline v. G.: Verschiedene Offenbarungen des Göttlichen
- 3.1.3. Johann Ludwig Uhland (1787 - 1862)
- 3.1.3.1. Uhland als Schriftsteller und lyrischer Dichter mystischer Erfahrungen
- 3.1.3.2. Uhland: Schäfers Sonntagslied
- 3.2. Exkurs: Was ist Lyrik und was ist lyrisch?
- 3.3. Romantik und Spätromantik (1805 - 1835)
- 3.4. Erste Zwischenbilanz
- 3.5. Der Zeitraum des Biedermeier (1810 - 1850), des Jungen Deutschland und des Vormärz (zusammengefasst: 1835-1848)
- 3.6. Zweite Zwischenbilanz
- 3.7. Der Zeitraum des Realismus (1840-1897)
- 3.7.1. Der Realismus und das Heilige
- 3.7.2. Das Numinose im Werk der Dichter
- Die Definition und Interpretation des Numinosen in der Religionswissenschaft
- Die Darstellung mystischer Erfahrungen in der deutschen Lyrik verschiedener Epochen
- Der Vergleich religionspsychologischer Theorien mit literarischen Ausdrucksformen
- Die Entwicklung der Darstellung religiöser Themen in der Lyrik
- Die Rolle der Lyrik als Medium religiöser Erfahrung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Erfahrung des Numinosen in der deutschen Lyrik von Novalis bis Meyer aus religionspsychologischer Perspektive. Ziel ist es, die Darstellung und Verarbeitung religiöser und mystischer Erfahrungen in ausgewählten Gedichten zu analysieren und in den Kontext der jeweiligen Epoche und der religionspsychologischen Theorien einzuordnen.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik ein, skizziert die Forschungsfragen und die methodischen Ansätze der Arbeit. Kapitel 2 präsentiert relevante Theorien der Religionswissenschaft, insbesondere die Konzepte des Heiligen und des Numinosen bei Rudolf Otto und William James, sowie weitere relevante Aspekte religiöser Erfahrung. Die folgenden Kapitel (3.1-3.7) untersuchen die Darstellung des Numinosen in der Lyrik verschiedener deutscher Dichter und Epochen, von der Frühromantik bis zum Realismus, unter Berücksichtigung der in Kapitel 2 vorgestellten Theorien. Es werden jeweils einzelne Gedichte analysiert und in den biographischen und literaturgeschichtlichen Kontext eingeordnet.
Schlüsselwörter
Numinose Erfahrung, Deutsche Lyrik, Religionswissenschaft, Religionspsychologie, Mystik, Romantik, Realismus, Novalis, Goethe, Heine, Meyer, Rudolf Otto, William James, Heiliges.
- Quote paper
- PhD Alexander Lohse (Author), 2008, Die Erfahrung des Numinosen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119710