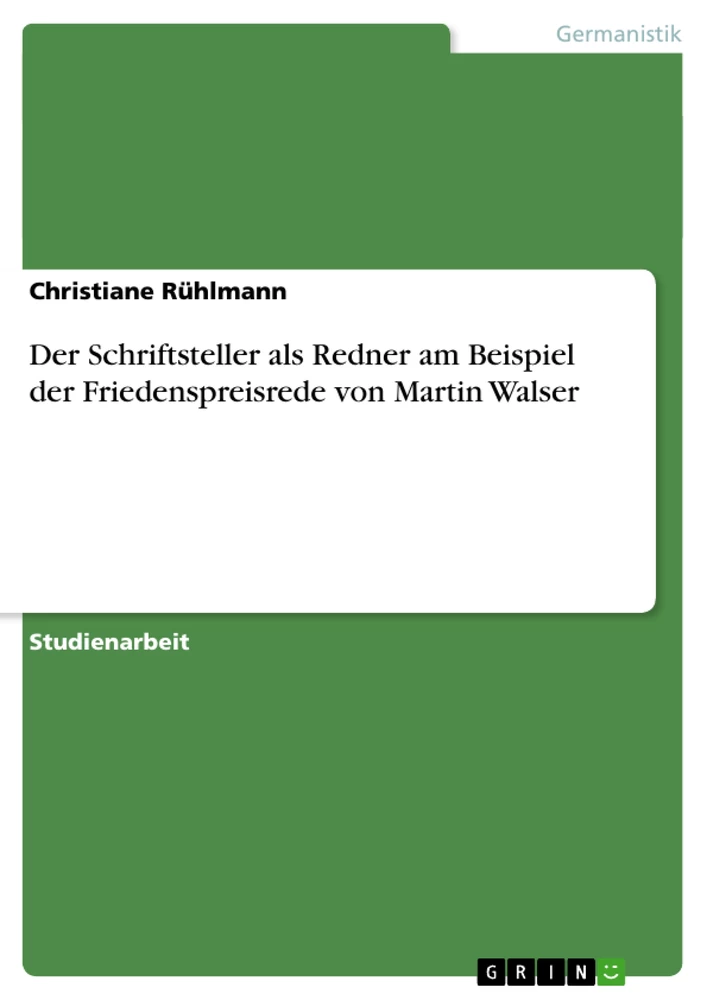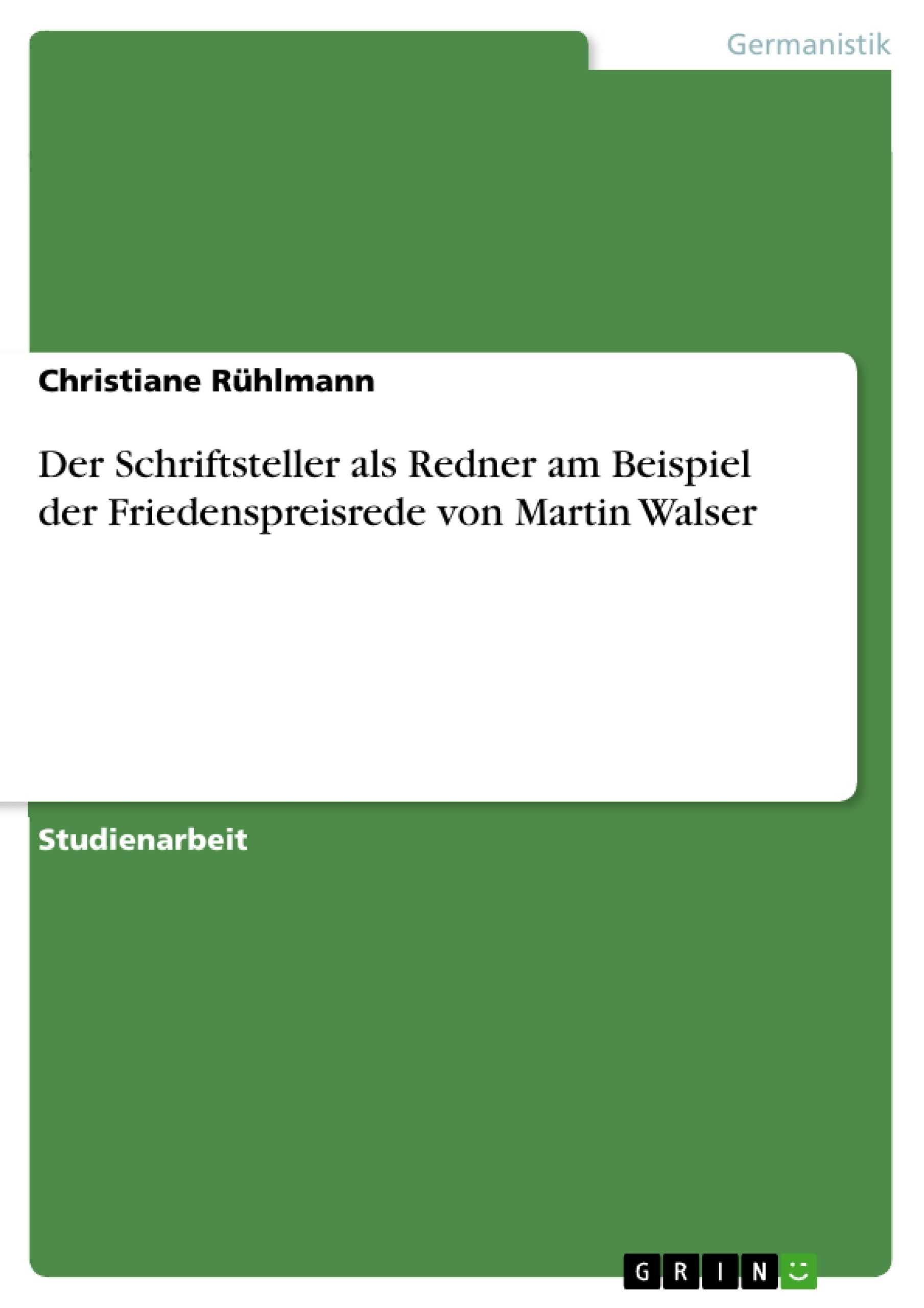Seit der deutsch-deutschen Vereinigung ist eine dichte Folge von literar-publizistischen Debatten zu beobachten. Die nachhaltigsten dieser sogenannten ‚Literaturstreits’ drehen sich um Christa Wolfs Erzählung „Was bleibt“ (1990), Peter Handkes Buch „Gerechtigkeit für Serbien“ (1993), Botho Strauß’ Spiegel-Essay „Anschwellender Bocksgesang“ (1996), sowie um die 1998 von Martin Walser gehaltene Friedenspreisrede. Sie trägt den harmlos wirkenden Titel „Erfahrungen beim Verfassen einer Sonntagsrede“ und ist Gegenstand der vorliegenden Arbeit.
Martin Walser, einer der renommiertesten Schriftsteller Deutschlands, hatte bisher ein klares linkes Profil. Doch in den 90er Jahren wird er stark in die politisch rechte Ecke gerückt. Ob er dies tatsächlich oder nur scheinbar ist, wird hier nicht geklärt.
Zu Beginn der Arbeit wurden die wichtigsten Fakten, welche die Debatte auslösten und durchzogen, dargelegt. Des Weiteren wurden die zentralen Vorwürfe gegenüber der Walser-Rede herausgegriffen und anhand der schriftlich fixierten Rede untersucht. Im zweiten Teil der Arbeit wurde die Rede anhand von sprechwissenschaftlichen und rhetorischen Kriterien untersucht. Die Diskrepanz zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit wurde mittels Beispielen herausgearbeitet und näher erläutert. Den Abschluss bilden weiterführende Gedanken zu den heftigen Reaktionen auf die Paulskirchenrede.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Reaktionen auf Martin Walsers Paulskirchenrede
- Ausgangsbasis
- Überprüfung der Vorwürfe aus der Walser-Bubis-Debatte
- Martin Walsers Paulskirchenrede - eine sprechwissenschaftliche Analyse
- Mündlichkeit vs. Schriftlichkeit
- Rhetorische Auswertung der Paulskirchenrede
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Reaktionen auf Martin Walsers Friedenspreisrede von 1998 und untersucht die Rede selbst unter sprechwissenschaftlichen und rhetorischen Aspekten. Ziel ist es, die kontroverse Debatte um die Rede zu beleuchten und die darin enthaltenen Argumentationslinien zu verstehen.
- Analyse der Walser-Bubis-Debatte und der beteiligten Akteure
- Untersuchung der rhetorischen Mittel in Walsers Rede
- Der Vergleich von Mündlichkeit und Schriftlichkeit in der Rede
- Die Rolle des Holocaust-Mahnmals in der Debatte
- Die Instrumentalisierung der Rede durch rechte Gruppierungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und führt in die Thematik der literar-publizistischen Debatten der 1990er Jahre ein, wobei Walsers Friedenspreisrede im Mittelpunkt steht. Kapitel 2 beleuchtet die Ausgangslage der Rede und die darauf folgenden Reaktionen, insbesondere die Walser-Bubis-Debatte und die unterschiedlichen Interpretationen der Rede. Es werden die zentralen Vorwürfe gegen Walser dargestellt. Kapitel 3 analysiert die Rede selbst unter sprechwissenschaftlichen und rhetorischen Gesichtspunkten. Die Diskrepanz zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit wird untersucht.
Schlüsselwörter
Martin Walser, Friedenspreisrede, Paulskirchenrede, Walser-Bubis-Debatte, Holocaust-Mahnmals, Rhetorik, Mündlichkeit, Schriftlichkeit, deutsche Geschichte, Erinnerungskultur, Antisemitismusvorwürfe.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Kern der Walser-Bubis-Debatte?
Die Debatte entzündete sich an Martin Walsers Friedenspreisrede von 1998, in der er Begriffe wie die „Instrumentalisierung des Holocaust“ verwendete, was zu heftiger Kritik durch Ignatz Bubis führte.
Welchen Titel trug die Rede von Martin Walser?
Die Rede trug den Titel „Erfahrungen beim Verfassen einer Sonntagsrede“.
Was wurde in der sprechwissenschaftlichen Analyse untersucht?
Untersucht wurde die Diskrepanz zwischen der mündlichen Darbietung in der Paulskirche und der schriftlich fixierten Fassung der Rede sowie deren rhetorische Wirkung.
Welche Rolle spielte das Holocaust-Mahnmal in der Rede?
Walser kritisierte in seiner Rede die geplante Errichtung des Holocaust-Mahnmals in Berlin, was als einer der zentralen Streitpunkte der Debatte galt.
Wurde Martin Walser durch die Rede politisch instrumentalisiert?
Die Arbeit analysiert, inwieweit Walsers Aussagen von rechten Gruppierungen instrumentalisiert wurden und wie sich sein öffentliches Profil dadurch veränderte.
- Arbeit zitieren
- Christiane Rühlmann (Autor:in), 2006, Der Schriftsteller als Redner am Beispiel der Friedenspreisrede von Martin Walser, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119739