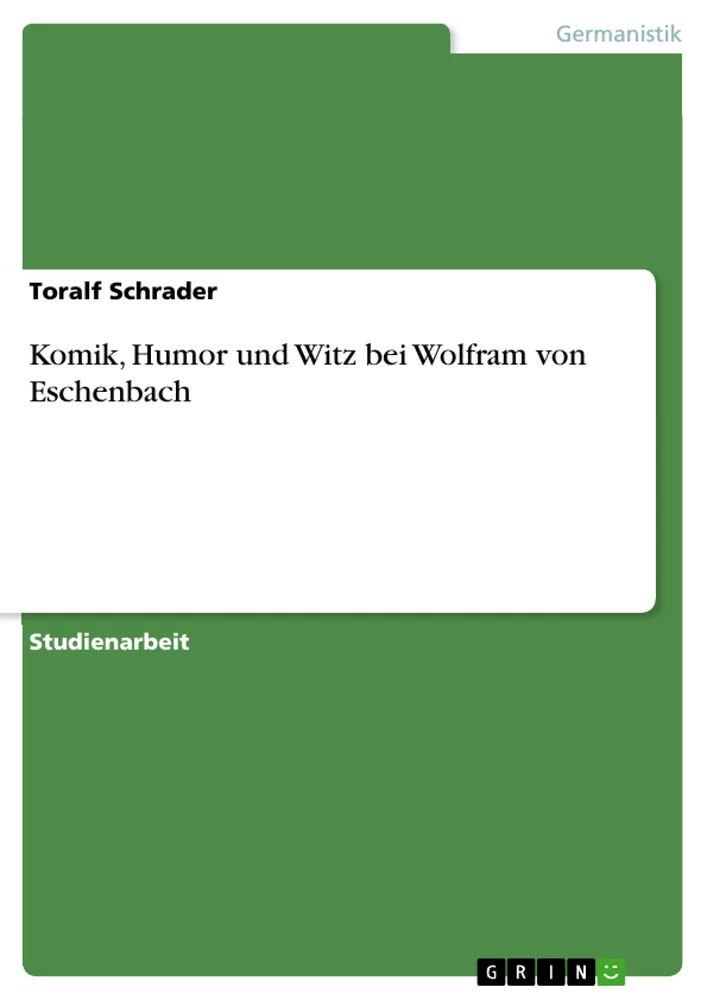Die volkssprachliche Literatur im Hochmittelalter befasst sich überwiegend mit ernsten Themen. […] Ob diese Vorstellung der gelebten Realität entsprach ist nicht nur mehr als fraglich, sondern selbst für den miles christianus […] widerlegt. Umso heller strahlen adlige Tugenden in den fiktiven mittelhochdeutschen Epen. […] Dementsprechend spielen Humor und Komik in diesen Werken eine untergeordnete Rolle. Wenn in [den Nibelungen] die ,musikalischen’ Bluttaten Volkers des Spielmannes beschrieben werden, klingt dieser Teil zwar brutal und makaber, […] wirkt [aber] zumindest für unsere Ohren darüber hinaus grotesk scherzhaft: Sîne léiche lûtent übele, sîne züge die sint rot: jâ vellent sîne doene vil manigen helt tôt. Mutet uns hier etwas komisch an, was für den zeitgenössischen Rezipienten keinesfalls „witzig“ war und vom Autor nicht beabsichtigt wurde? Oder fehlt andererseits dem Menschen unserer Zeit […] die Fähigkeit zum Verständnis des mittelalterlichen Humors […]? Passiert es uns nicht oft genug, dass wir Witze nicht verstehen, weil sie nicht unserem Erfahrungshorizont entsprechen? […] Der Humor mittelalterlicher Literatur stellt nicht nur in der Frage nach dem Verständnis, sondern auch in Bezug auf seine Funktion in den Texten ein Problem dar, das sich bis in den Bereich der Mentalität fortsetzt. Humor und Komik verlangen einen distanzierten Blick auf die Welt[…]. Man könnte sagen, dass der Mensch, der Humor benutzt, sich seiner Individualität bewusst ist. […] Die Wandlung der Mentalität hin zur „Subjektivität“ […] bildet nach wie vor eines der Elemente zur Bestimmung des Übergangs vom Mittelalter zur Neuzeit. Die Frage stellt sich, ob Subjektivität im Mittelalter empfunden wurde. Ein Weg, das herauszufinden, führt über die Untersuchung des Humors.
Der erste Teil der Arbeit soll in das Wesen der Witztheorie einführen […] und die problematische Beziehung des Christentums […] zum Lachen beleuchten.
Mit Wolfram von Eschenbach begegnet uns um 1200 ein Autor, dessen Umgang mit dem Artusroman als Hochform des Ritterepos, die bis dahin gesetzten Grenzen im Bereich Humor, Ironie, Erzählerperspektive und Publikumsanrede sprengt. In diesen Punkten sticht unter seinen drei großen Werken der Parzival besonders hervor. […] Um Wolframs Humor näher zu kommen, [ist] der Parzival das ergiebigste Werk, weshalb er im Hauptteil der Arbeit die größte Rolle spielen wird. Dort soll geklärt werden, wie Wolframs Humor funktioniert und in welchen Zusammenhängen er ihn einsetzt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlegendes zum „Lachen“
- Zu Komik, Humor und Witz
- Der Humor im Mittelalter und sein Verhältnis zum Christentum
- Der Humor Wolframs von Eschenbach und seine Sonderformen
- Witztypen bei Wolfram
- Wolframs Spiel mit Witz und Ernst
- Die Selbststilisierung des Erzählers
- Kreaturen und Kreatürlichkeit des Parzival im Dienst des Lachens
- Die Tiere im Parzival
- Die Körperlichkeit
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle von Komik, Humor und Witz in den Werken Wolframs von Eschenbach, insbesondere im Kontext des hochmittelalterlichen Ritterepos. Sie beleuchtet die Schwierigkeiten des Verständnisses mittelalterlichen Humors im modernen Kontext und analysiert Wolframs individuellen Umgang mit diesen Elementen, seine Abweichungen von den traditionellen Normen des Genres und die Funktion von Humor in seinen Erzählungen.
- Definition und Differenzierung von Komik, Humor und Witz nach Freud
- Der Humor Wolframs von Eschenbach im Vergleich zu anderen mittelhochdeutschen Epen
- Die Funktion von Humor und Komik in Wolframs Erzählweise und Charakterisierung
- Analyse von Witztypen in Wolframs Werken
- Der Einfluss von gesellschaftlichen und religiösen Normen auf die Darstellung von Humor
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der Rolle von Humor und Komik in der volkssprachlichen Literatur des Hochmittelalters, speziell im Werk Wolframs von Eschenbach, vor. Sie thematisiert die Diskrepanz zwischen der idealisierten Darstellung adliger Tugenden in der Literatur und der historischen Realität. Die scheinbare Abwesenheit von Humor in diesen Werken wird als Ausgangspunkt für die Untersuchung genommen, unter Berücksichtigung des Problems des zeitgenössischen Verständnisses mittelalterlicher Humorformen. Die Arbeit konzentriert sich auf den Parzival als primäres Analyseobjekt aufgrund des reichhaltigeren Einsatzes von humoristischen Elementen im Vergleich zu Wolframs anderen Werken, Willehalm und Titurel.
Grundlegendes zum „Lachen“: Dieses Kapitel befasst sich mit der theoretischen Fundierung des Konzepts von Komik, Humor und Witz, insbesondere mit Sigmund Freuds Unterscheidung der drei Kategorien. Freud's Definition von Humor als Verbindung von Ich und Über-Ich, Komik als situationsbezogene und Witz als unbewusste Erscheinung wird ausführlich erläutert. Das Kapitel beleuchtet die Schwierigkeiten bei der Definition und Erfassung von Humor und Komik im Vergleich zum greifbareren Witz, betont die soziale Motivation des Witzes und die Rolle der Kommunikation für seine Wirkung.
Der Humor Wolframs von Eschenbach und seine Sonderformen: Dieser Abschnitt untersucht Wolframs individuellen Umgang mit Humor, Ironie und Erzählperspektive in seinen Werken. Es wird herausgestellt, wie Wolfram von Eschenbach die Konventionen des Artusromans überschreitet und sein Spiel mit Witz und Ernst analysiert. Das Kapitel beleuchtet verschiedene Witztypen bei Wolfram und untersucht, wie er die Selbststilisierung des Erzählers einsetzt, um humoristische Effekte zu erzielen. Die unterschiedliche Verwendung humoristischer Elemente in Parzival, Willehalm und Titurel wird verglichen.
Kreaturen und Kreatürlichkeit des Parzival im Dienst des Lachens: Dieser Abschnitt fokussiert sich auf die Rolle von Tieren und der Körperlichkeit in Wolframs Parzival zur Erzeugung komischer Effekte. Es wird analysiert, wie die Darstellung von Tieren und die Betonung der Körperlichkeit zur Erzeugung humorvoller Momente und zur Charakterisierung von Figuren beitragen. Der Abschnitt beleuchtet die Bedeutung dieser Elemente für das Verständnis von Wolframs Humor und dessen Funktion innerhalb der Erzählung.
Schlüsselwörter
Wolfram von Eschenbach, Parzival, Humor, Komik, Witz, Mittelalter, Hochmittelalter, deutsche Literatur, Artusroman, Ritterepos, Freud, Erzählperspektive, Ironie, Sprachspiel, Körperlichkeit, Tierdarstellung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse des Humors in den Werken Wolframs von Eschenbach
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Rolle von Komik, Humor und Witz in den Werken Wolframs von Eschenbach, insbesondere im Parzival, im Kontext des hochmittelalterlichen Ritterepos. Sie analysiert Wolframs individuellen Umgang mit humoristischen Elementen, seine Abweichungen von traditionellen Normen und die Funktion von Humor in seinen Erzählungen.
Welche Werke Wolframs von Eschenbach werden untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich primär auf den Parzival aufgrund seines reichhaltigeren Einsatzes humoristischer Elemente. Willehalm und Titurel werden ebenfalls vergleichend betrachtet.
Wie wird Humor in dieser Arbeit definiert und differenziert?
Die Arbeit stützt sich auf Sigmund Freuds Unterscheidung von Komik, Humor und Witz. Freud's Definitionen dieser drei Kategorien werden ausführlich erläutert, unter Berücksichtigung der Schwierigkeiten bei der Definition und Erfassung von Humor und Komik im Vergleich zum Witz.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Differenzierung von Komik, Humor und Witz nach Freud; den Vergleich des Humors Wolframs von Eschenbach mit anderen mittelhochdeutschen Epen; die Funktion von Humor und Komik in Wolframs Erzählweise und Charakterisierung; die Analyse von Witztypen in Wolframs Werken; und den Einfluss gesellschaftlicher und religiöser Normen auf die Darstellung von Humor.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es darin?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den Grundlagen des Lachens (mit Freuds Theorie), ein Kapitel zum Humor Wolframs von Eschenbach und seinen Sonderformen (Analyse von Witztypen, Erzählperspektive, Ironie), ein Kapitel zu Kreaturen und Kreatürlichkeit im Parzival als Quelle komischer Effekte (Tiere, Körperlichkeit) und eine Schlussbetrachtung. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und die Problematik des Verständnisses mittelalterlichen Humors vor. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte des Humors in Wolframs Werken.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Wolfram von Eschenbach, Parzival, Humor, Komik, Witz, Mittelalter, Hochmittelalter, deutsche Literatur, Artusroman, Ritterepos, Freud, Erzählperspektive, Ironie, Sprachspiel, Körperlichkeit, Tierdarstellung.
Wie wird der Humor Wolframs von Eschenbach im Vergleich zu anderen mittelhochdeutschen Epen betrachtet?
Die Arbeit vergleicht den Umgang mit humoristischen Elementen in Wolframs Werken mit anderen mittelhochdeutschen Epen, um die Besonderheiten seines Stils und die Funktion von Humor in seinen Erzählungen herauszuarbeiten.
Welche Rolle spielen Tiere und Körperlichkeit in der Erzeugung komischer Effekte?
Die Arbeit analysiert, wie die Darstellung von Tieren und die Betonung der Körperlichkeit in Wolframs Parzival zur Erzeugung humorvoller Momente und zur Charakterisierung von Figuren beitragen.
Wie wird die Erzählperspektive und Ironie bei Wolfram von Eschenbach analysiert?
Die Arbeit untersucht, wie Wolfram von Eschenbach die Konventionen des Artusromans überschreitet und sein Spiel mit Witz und Ernst durch die Erzählperspektive und Ironie analysiert.
- Arbeit zitieren
- Toralf Schrader (Autor:in), 2006, Komik, Humor und Witz bei Wolfram von Eschenbach, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119798