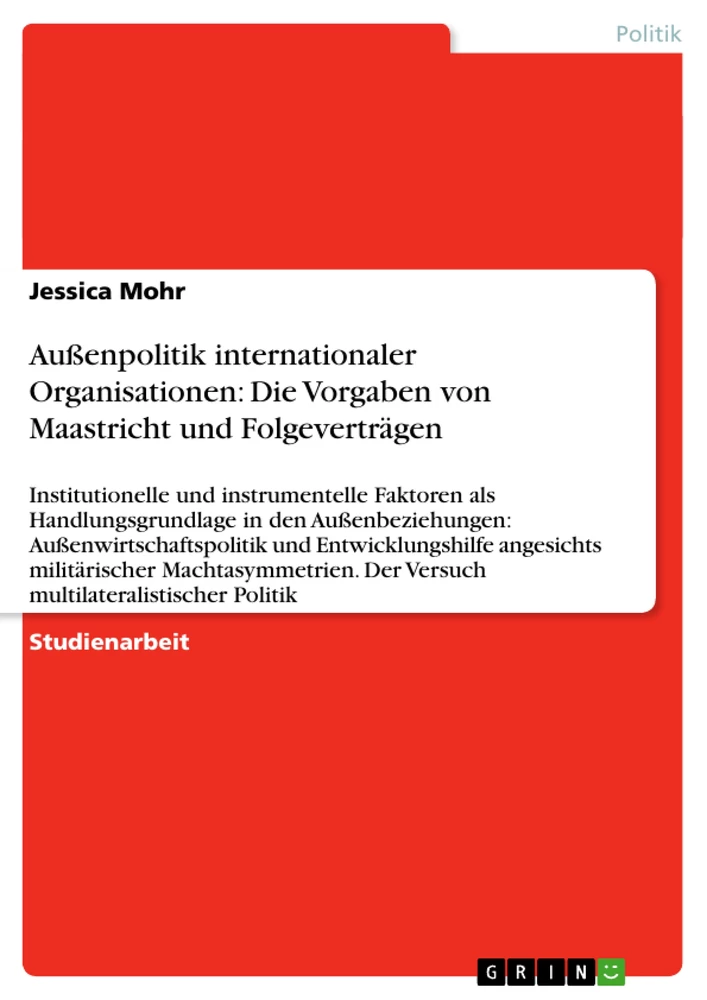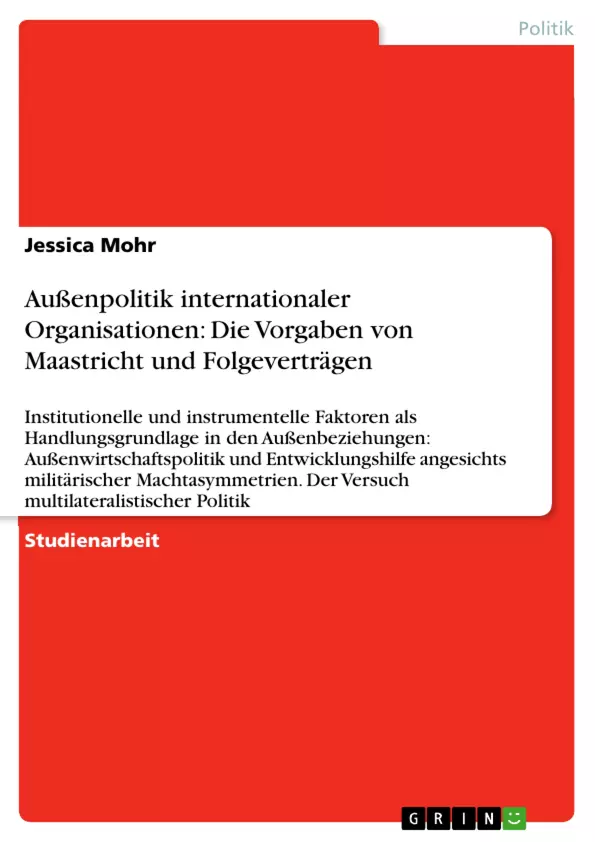Die gemeinsame Handelspolitik der EU ist Bestandteil der ersten Säule des EGV, der vergemeinschafteten Politik. Sie entsteht im Diskussionsprozess der Mitgliedstaaten (im Rat) und der Kommission mit Drittstaaten.
Die EU ist vertraglich dazu verpflichtet, Handelsschranken abzubauen und für freien (Welt-)Handel einzutreten.
Die Handelspolitik findet auf zwei Ebenen statt. Intern innerhalb der EU versuchen NGOs, Vertreter ziviler Organisationen, wirtschaftlicher Intereressenverbände, der Unternehmen und der Mitgliedstaaten sowie die Institutionen der EU selber, ihre Interessen in die GHP einzubringen und durchzusetzen. Extern gegenüber Drittstaaten / Verbünden repräsentiert die Kommission die EU, damit ein einheitliches Bild in Verhandlungen vertreten wird. Teilweise jedoch vermischen sich die Kompetenzen, wenn wie in vielen Fällen des Dienstleistungs- und Servicebereiches die Mitgliedstaaten Vereinbarungen zustimmen müssen (und nicht nur der Rat).
Einerseits kann das interne, komplexe Gefüge der EU ihre Position nach außen stärken, da sie glaubhaft machen kann, dass sie sich auf keine andere Position intern einigen kann. Andererseits wirkt sie deshalb auch sehr starrköpfig und gilt als schwieriger Verhandlungspartner.
Dennoch hat die EU in den letzten Jahren die Hauptrolle im Vorantreiben des freien Handels von den USA übernommen. Sie ist der wichtigste Handelspartner vieler Entwicklungsländer und leistet monetär die bedeutendste finanzielle Unterstützung im Bereich der Handelsvergünstigungen und der Entwicklungshilfe.
Autonome Handelspolitik im klassischen Sinne ist in der EU von heute nicht mehr möglich. Viele Aspekte anderer Politikbereiche (Außen- und Sicherheitspolitik, Entwicklungshilfe, Umweltschutz) fließen in die Handelspolitik ein und benutzen diese als Sprachrohr. Immer weniger können die einzelnen Mitgliedstaaten der EU selber über ihre nationale Handelspolitik entscheiden, da immer mehr Bereiche bereits indirekt oder direkt von der EU vorgegeben wird. Von einigen befürwortet, äußern andere hieran heftige Kritik. Es bleibt abzuwarten, ob in Zukunft EU-interne Interessen wie Verbraucher- und Umweltschutz die Handelspolitik dominieren werden, oder die Gesamtwohlfahrt der Weltwirtschaft und damit entwicklungspolitische Aspekte und Liberalisierung der Märkte den ersten Platz einnehmen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 1.1 Einleitung
- 1.2 Fragestellung der Seminararbeit
- 2. Allgemeine Grundlagen
- 2.1 Internationale Beziehungen
- 2.2 Wirtschaftspolitik
- 2.3 Institutionelle Ausgestaltung und vertraglicher Hintergrund
- 3. Handelspolitische Instrumente
- 3.1 Das autonome Einfuhrregime
- 3.1.1 Zölle
- 3.1.2 Abschöpfungen
- 3.1.3 Einfuhrkontingente
- 3.2 Das autonome Ausfuhrregime
- 3.2.1 Ausfuhrbeschränkungen
- 3.2.2 Ausfuhrförderung
- 3.2.3 Schutzklausel
- 3.3 Embargo
- 4. Vertragliche Handelspolitik
- 4.1 Die EU und die WTO
- 4.2 Präferenzabkommen und multilaterale Verhandlungen
- 4.3 EU-interne Politik
- 4.3.1 Akteure auf der EU-Ebene
- 4.3.2 Die aktuelle Politik der Kommission
- 4.4 APSplus und die Menschenrechte
- 4.4.1 Motive und Anreize für das APSplus
- 4.4.2 APSplus als Instrument effektiver Menschenrechtspolitik?
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die gemeinsame Handelspolitik der EU, insbesondere die institutionellen und instrumentellen Faktoren, die ihr Handeln in Außenbeziehungen, Außenwirtschaftspolitik und Entwicklungshilfe prägen. Der Fokus liegt auf der Analyse der Handelspolitik der EU im Kontext militärischer Machtasymmetrien und dem Versuch multilateralistischer Politik.
- Die institutionelle Ausgestaltung der EU-Handelspolitik und ihre vertraglichen Grundlagen
- Die handelspolitischen Instrumente der EU (Einfuhr-, Ausfuhrregime, Embargo)
- Die Rolle der WTO und bilateraler Abkommen in der EU-Handelspolitik
- Die interne Politikgestaltung innerhalb der EU und die Interessen verschiedener Akteure
- Der Zusammenhang zwischen Handelspolitik, Menschenrechten und Entwicklungshilfe (APSplus)
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einführung bietet einen Überblick über die EU als internationalen Akteur und die Herausforderungen des freien Handels, insbesondere im Hinblick auf Arbeitsplätze und soziale Gerechtigkeit. Kapitel 2: Allgemeine Grundlagen legt die theoretischen Grundlagen der internationalen Beziehungen und Wirtschaftspolitik dar und beschreibt den institutionellen Rahmen der EU-Handelspolitik. Kapitel 3: Handelspolitische Instrumente detailliert die verschiedenen Instrumente der autonomen Handelspolitik der EU, wie Zölle, Einfuhrkontingente und Embargos. Kapitel 4: Vertragliche Handelspolitik befasst sich mit der Rolle der WTO, Präferenzabkommen und der internen Politikgestaltung innerhalb der EU, einschließlich der Berücksichtigung von Menschenrechten im Rahmen von APSplus.
Schlüsselwörter
Europäische Union (EU), Gemeinsame Handelspolitik (GHP), Welthandelsorganisation (WTO), Präferenzabkommen, APSplus, Menschenrechte, Entwicklungshilfe, Außenwirtschaftspolitik, multilaterale Politik, institutionelle Faktoren, instrumentelle Faktoren, militärische Machtasymmetrien.
Häufig gestellte Fragen
Wie ist die gemeinsame Handelspolitik (GHP) der EU organisiert?
Sie gehört zur ersten Säule des EU-Vertrags (vergemeinschaftete Politik) und wird primär durch die Kommission nach außen vertreten, während der Rat intern entscheidet.
Welche handelspolitischen Instrumente nutzt die EU?
Dazu zählen Zölle, Einfuhrkontingente, Ausfuhrförderungen sowie Embargos als politisches Druckmittel.
Was ist APSplus?
APSplus ist ein Instrument, das Handelsvergünstigungen an die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards in Entwicklungsländern knüpft.
Warum gilt die EU als schwieriger Verhandlungspartner?
Aufgrund ihres komplexen internen Gefüges und der Notwendigkeit, viele verschiedene nationale Interessen zu harmonisieren, wirkt ihre Position nach außen oft starr.
Welche Rolle spielt die WTO für die EU?
Die EU ist ein zentraler Akteur in der Welthandelsorganisation (WTO) und setzt sich dort für den Abbau von Handelsschranken und multilateralistische Politik ein.
- Quote paper
- Jessica Mohr (Author), 2008, Außenpolitik internationaler Organisationen: Die Vorgaben von Maastricht und Folgeverträgen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119829