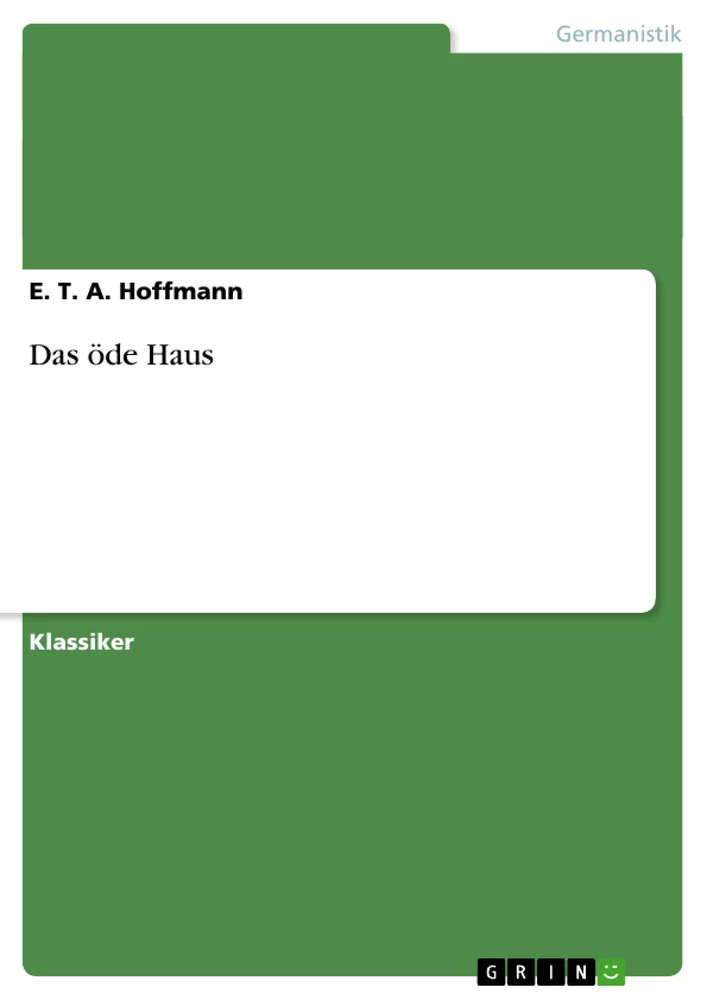Man war darüber einig, daß die wirklichen Erscheinungen im Leben oft viel wunderbarer sich gestalteten als alles, was die regste Phantasie zu erfinden trachte. „Ich meine“, sprach Lelio, „daß die Geschichte davon hinlänglichen Beweis gibt und daß ebendeshalb die sogenannten historischen Romane, worin der Verfasser in seinem müßigen Gehirn bei ärmlichem Feuer ausgebrütete Kindereien den Taten der ewigen, im Universum wartenden Macht beizugesellen sich unterfängt, so abgeschmackt und widerlich sind.“ – „Es ist“, nahm Franz das Wort, „die tiefe Wahrheit der unerforschlichen Geheimnisse, von denen wir umgeben, welche uns mit einer Gewalt ergreift, an der wir den über uns herrschenden, uns selbst bedingenden Geist erkennen.“ – „Ach!“ fuhr Lelio fort, „die Erkenntnis, von der du sprichst – ach, das ist ja eben die entsetzlichste Folge unserer Entartung nach dem Sündenfall, daß diese Erkenntnis uns fehlt!“ – „Viele“, unterbrach Franz den Freund, „viele sind berufen und wenige auserwählt! Glaubst du denn nicht, daß das Erkennen, das beinahe noch schönere Ahnen der Wunder unseres Lebens manchem verliehen ist wie ein besonderer Sinn? Um nur gleich aus der dunklen Region, in die wir uns verlieren könnten, heraufzuspringen in den heitren Augenblick, werf ich euch das skurrile Gleichnis hin, daß Menschen, denen die Sehergabe [eigen], das Wunderbare zu schauen, mir wohl wie die Fledermäuse bedünken wollen, an denen der gelehrte Anatom Spalanzani einen vortrefflichen sechsten Sinn entdeckte, der als schalkhafter Stellvertreter nicht allein alles, sondern viel mehr ausrichtet als alle übrige Sinne zusammengenommen.“ – „Ho, ho“, rief Franz lächelnd, „so wären denn die Fledermäuse eigentlich recht die gebornen natürlichen Somnambulen! Doch in dem heitern Augenblick, dessen du gedachtest, will ich Posto fassen und bemerken, daß jener sechste, bewundrungswürdige Sinn vermag, an jeder Erscheinung, sei es Person, Tat oder Begebenheit, sogleich dasjenige Exzentrische zu schauen, zu dem wir in unserm gewöhnlichen Leben keine Gleichung finden und es daher wunderbar nennen.
Man war darüber einig, daß die wirklichen Erscheinungen im Leben oft viel wunderbarer sich gestalteten als alles, was die regste Phantasie zu erfinden trachte. „Ich meine“, sprach Lelio, „daß die Geschichte davon hinlänglichen Beweis gibt und daß ebendeshalb die sogenannten historischen Romane, worin der Verfasser in seinem müßigen Gehirn bei ärmlichem Feuer ausgebrütete Kindereien den Taten der ewigen, im Universum wartenden Macht beizugesellen sich unterfängt, so abgeschmackt und widerlich sind.“ – „Es ist“, nahm Franz das Wort, „die tiefe Wahrheit der unerforschlichen Geheimnisse, von denen wir umgeben, welche uns mit einer Gewalt ergreift, an der wir den über uns herrschenden, uns selbst bedingenden Geist erkennen.“ – „Ach!“ fuhr Lelio fort, „die Erkenntnis, von der du sprichst – ach, das ist ja eben die entsetzlichste Folge unserer Entartung nach dem Sündenfall, daß diese Erkenntnis uns fehlt!“ – „Viele“, unterbrach Franz den Freund, „viele sind berufen und wenige auserwählt! Glaubst du denn nicht, daß das Erkennen, das beinahe noch schönere Ahnen der Wunder unseres Lebens manchem verliehen ist wie ein besonderer Sinn? Um nur gleich aus der dunklen Region, in die wir uns verlieren könnten, heraufzuspringen in den heitren Augenblick, werf ich euch das skurrile Gleichnis hin, daß Menschen, denen die Sehergabe [eigen], das Wunderbare zu schauen, mir wohl wie die Fledermäuse bedünken wollen, an denen der gelehrte Anatom Spalanzani einen vortrefflichen sechsten Sinn entdeckte, der als schalkhafter Stellvertreter nicht allein alles, sondern viel mehr ausrichtet als alle übrige Sinne zusammengenommen.“ – „Ho, ho“, rief Franz lächelnd, „so wären denn die Fledermäuse eigentlich recht die gebornen natürlichen Somnambulen! Doch in dem heitern Augenblick, dessen du gedachtest, will ich Posto fassen und bemerken, daß jener sechste, bewundrungswürdige Sinn vermag, an jeder Erscheinung, sei es Person, Tat oder Begebenheit, sogleich dasjenige Exzentrische zu schauen, zu dem wir in unserm gewöhnlichen Leben keine Gleichung finden und es daher wunderbar nennen. Was ist denn aber gewöhnliches Leben? – Ach, das Drehen in dem engen Kreise, an den unsere Nase überall stößt, und doch will man wohl Kurbetten versuchen im taktmäßigen Paßgang des Alltagsgeschäfts. Ich kenne jemanden, dem jene Sehergabe, von der wir sprechen, ganz vorzüglich eigen scheint. Daher kommt es, daß er oft unbekannten Menschen, die irgend etwas Verwunderliches in Gang, Kleidung, Ton, Blick haben, tagelang nachläuft, daß er über eine Begebenheit, über eine Tat, leichthin erzählt, keiner Beachtung wert und von niemandem beachtet, tiefsinnig wird, daß er antipodische Dinge zusammenstellt und Beziehungen herausphantasiert, an die niemand denkt.“ Lelio rief laut: „Halt, halt, das ist ja unser Theodor, der ganz was Besonderes im Kopfe zu haben scheint, da er mit solch seltsamen Blicken in das Blaue herausschaut.“ – „In der Tat“, fing Theodor an, der solange geschwiegen, „in der Tat waren meine Blicke seltsam, solang darin der Reflex des wahrhaft Seltsamen, das ich im Geiste schaute. Die Erinnerung eines unlängst erlebten Abenteuers“ – „O erzähle, erzähle“, unterbrachen ihn die Freunde. „Erzählen“, fuhr Theodor fort, „möcht ich wohl, doch muß ich zuvörderst dir, lieber Lelio, sagen, daß du die Beispiele, die meine Sehergabe dartun sollten, ziemlich schlecht wähltest. Aus Eberhards ,Synonymik’ mußt du wissen, daß ‘‘wunderlich’‘ alle Äußerungen der Erkenntnis und des Begehrens genannt werden, die sich durch keinen vernünftigen Grund rechtfertigen lassen, ‘‘wunderbar’‘ aber dasjenige heißt, was man für unmöglich, für unbegreiflich hält, was die bekannten Kräfte der Natur zu übersteigen oder, wie ich hinzufüge, ihrem gewöhnlichen Gange entgegen zu sein scheint. Daraus wirst du entnehmen, daß du vorhin rücksichts meiner angeblichen Sehergabe das Wunderliche mit dem Wunderbaren verwechseltest. Aber gewiß ist es, daß das anscheinend Wunderliche aus dem Wunderbaren sproßt und daß wir nur oft den wunderbaren Stamm nicht sehen, aus dem die wunderlichen Zweige mit Blättern und Blüten hervorsprossen. In dem Abenteuer, das ich euch mitteilen will, mischt sich beides, das Wunderliche und Wunderbare, auf, wie mich dünkt, recht schauerliche Weise.“ Mit diesen Worten zog Theodor sein Taschenbuch hervor, worin er, wie die Freunde wußten, allerlei Notizen von seiner Reise her eingetragen hatte, und erzählte, dann und wann in dies Buch hineinblickend, folgende Begebenheit, die der weiteren Mitteilung nicht unwert scheint.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Textausschnitt?
Der Text ist ein Auszug aus einer Geschichte, in der sich mehrere Personen über das Wunderbare im Leben und die Fähigkeit einiger Menschen, dieses zu erkennen, unterhalten. Ein Mann namens Theodor beginnt, ein seltsames Abenteuer zu erzählen, das er kürzlich erlebt hat.
Was ist das "Abenteuer", von dem Theodor spricht?
Theodor verbrachte den Sommer in ***n und war fasziniert von einem unbewohnt aussehenden Haus in einer belebten Allee. Er erfuhr von Graf P., dass das Haus eigentlich eine Bäckerei beherbergt, aber Theodor konnte sich nicht mit dieser Erklärung zufrieden geben.
Was geschieht, das Theodors Interesse wieder weckt?
Eines Tages sieht Theodor eine Hand, die zu einem Frauenzimmer gehört, an einem der verhängten Fenster des Hauses. Sie stellt eine Kristallflasche auf die Fensterbank. Dies entfacht seine Neugierde erneut.
Was erfährt Theodor vom Konditor?
Theodor befragt den Konditor, dessen Geschäft sich neben dem "öden" Haus befindet. Der Konditor erzählt ihm, dass das Haus der Gräfin von S. gehört, die auf ihren Gütern lebt, und dass es von einem alten, menschenfeindlichen Hausverwalter und einem Hund bewohnt wird. Er erwähnt auch seltsame Geräusche und Gesänge, die nachts aus dem Haus zu hören sind.
Wer ist der seltsame Mann, der den Laden betritt?
Während Theodor mit dem Konditor spricht, betritt ein kleiner, dürrer Mann mit einem mumienfarbigen Gesicht und seltsamem Lächeln den Laden. Der Konditor deutet an, dass es sich um den Hausverwalter des geheimnisvollen Hauses handelt.
Was tut der seltsame Mann im Laden?
Der Mann kauft eingemachte Pomeranzen, Makronen und Zuckerkastanien. Er zahlt mit alten Münzen und murmelt seltsame Dinge. Er tritt den Hund, gibt ihm aber dann eine Makrone. Beim Verlassen des Ladens drückt er die Hand des Konditors so fest, dass dieser aufschreit.
Was erfährt Theodor über das Haus und seinen Verwalter?
Der Konditor erzählt Theodor, dass der Verwalter früher Kammerdiener des Grafen von S. war und seit vielen Jahren die gräfliche Familie erwartet. Er behauptet, dass die Gerüchte über Spuk im Haus nicht wahr seien.
- Quote paper
- E. T. A. Hoffmann (Author), 2008, Das öde Haus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119866