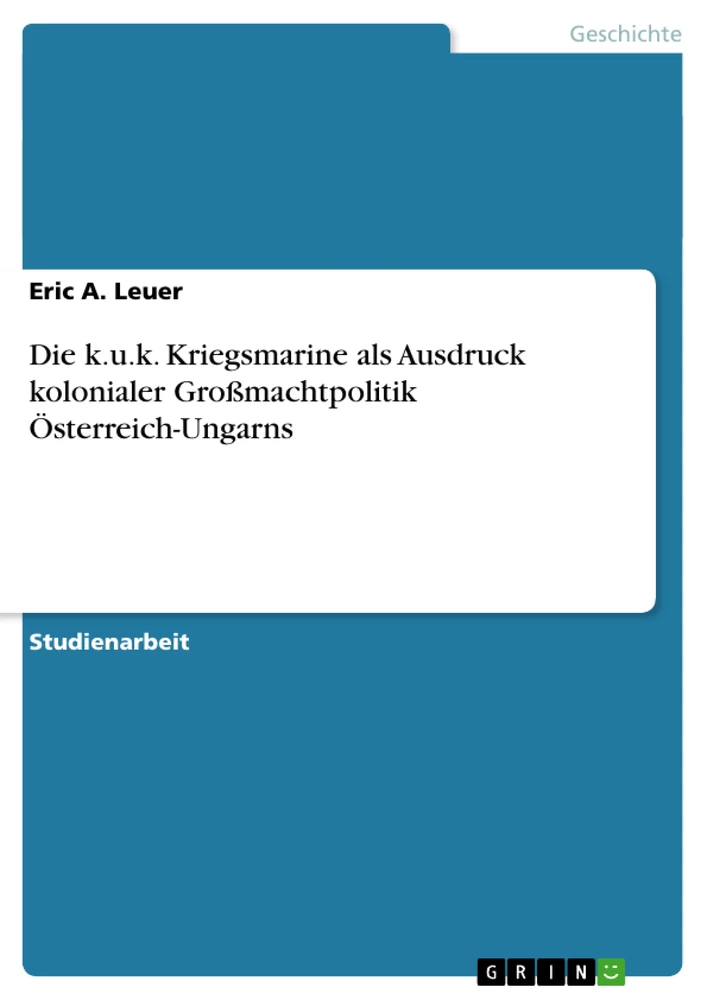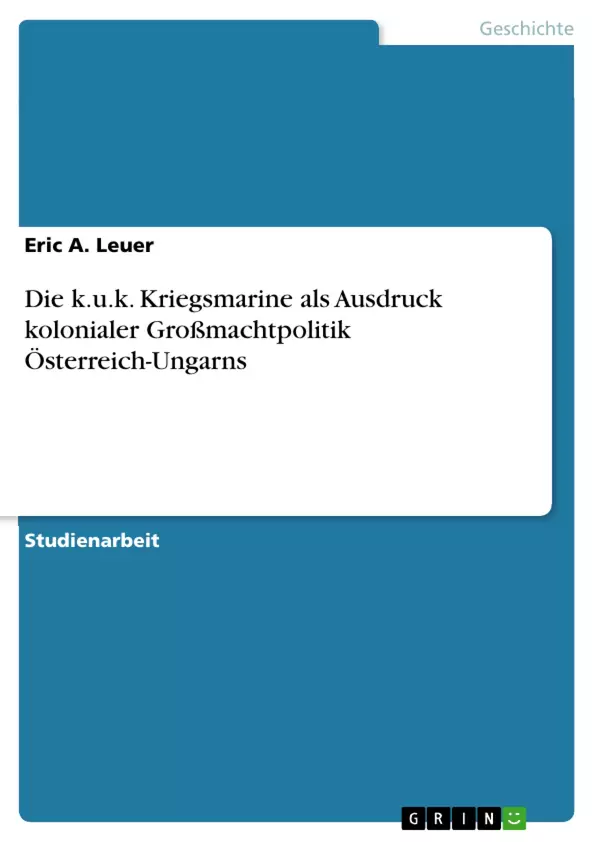Am Wiener Praterstern befindet sich eine 16 Meter hohe Triumphsäule, auf deren Spitze sich das Standbild des Begründers der „österreichischen“ Seemacht, Admiral Wilhelm von Tegetthoff befindet. In seiner Gestaltung ist es dem antiken Vorbild der „columna rostrata“ nachempfunden und erinnert darüber hinaus an die Vendome-Säule zu Ehren Napoleons oder an die Trafalgar Säule für Lord Nelson.
Aus heutiger Perspektive scheint eine solche Heldenverehrung für einen österreichischen Seefahrer seltsam, wird Österreich doch eher als alpine, denn maritime Nation gesehen. Dennoch vergisst man dabei, dass die Donaumonarchie bis zu ihrem Untergang über einen Zugang zu Mittelmeer verfügte und eben nach dem Sieg Tegetthoffs bei Lissa die Marine im Habsburgerreich zu einer außerordentlich großen, für die damalige Zeit typischen Popularität gelangte.
1899 schreibt der spätere Konteradmiral Alfred Freiherr von Koudelka, dass „in colonialen Bestrebungen und transoceanischem Landbesitz [...] der geradezu zwingende Ansporn zur Schaffung [...] einer leistungsfähigen und starken Kriegsflotte“ läge, und entsprechende Nachteile entstünden, so sich denn Österreich-Ungarn keine ernstzunehmende Flotte aneigne. Auch dies erstaunt, da die Donaumonarchie bis zu ihrem Ende keine klassischen Überseekolonien besitzt und auch nur auf dem europäischen Kontinent höchstens Bosnien als eine Kolonie zu sehen ist. Auch die militärische Rolle der Kriegsmarine bleibt militärisch gesehen eher marginal.
Weshalb also dieser Drang zum Meer? War es der Wille, das Prestigeobjekt Marine zu realisieren, um im „Konzert der Großmächte“ gleichrangig mitspielen zu können? War es die expansive Marinepolitik des Deutschen Bündnispartners, die auf Österreich-Ungarn abfärbte? Waren es Prestigedenken und die Wiener Kriegspartei, die gemeinsam mit der öffentlichen Meinung auf Österreichs Seestreitkraft drängten?
Kann zu guter Letzt Österreich-Ungarn zum Ende seiner Existenz sogar als eine kolonialistisch agierende Großmacht ohne Kolonien gesehen werden?
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Tegetthoff, Lissa und der Anfang der Kriegsmarine
- III. Forschungsreisen und friedliche Präsenz
- IV. Der Boxeraufstand – Abkehr zur Intervention
- V. Der Österreichische Flottenverein
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die k.u.k. Kriegsmarine im Kontext der kolonialen Frage der Habsburgermonarchie. Sie analysiert die Gründe für den Ausbau der österreichisch-ungarischen Flotte trotz des Fehlens klassischer Überseekolonien und beleuchtet die Rolle der Marine in der Außen- und Großmachtpolitik Österreich-Ungarns.
- Die Entwicklung der k.u.k. Kriegsmarine von ihren Anfängen bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts.
- Der Einfluss des See-Sieges bei Lissa auf die Wahrnehmung und den Ausbau der Marine.
- Die Rolle der Marine in der Außenpolitik Österreich-Ungarns, insbesondere im Hinblick auf den Kolonialismus.
- Die Frage nach dem Prestige und dem Wunsch nach Gleichrangigkeit im Konzert der Großmächte.
- Die Bedeutung der öffentlichen Meinung und der Kriegspartei für den Ausbau der Flotte.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung stellt die Frage nach der Bedeutung der österreichisch-ungarischen Marine im Kontext der Habsburgermonarchie und ihrer kolonialen Ambitionen, obwohl Österreich-Ungarn keine klassischen Kolonien besaß. Sie führt die zentrale Fragestellung der Arbeit ein.
II. Tegetthoff, Lissa und der Anfang der Kriegsmarine: Dieses Kapitel beschreibt den Sieg Österreichs bei der Seeschlacht von Lissa und die Folgen für den Ausbau und die Bedeutung der österreichischen Kriegsmarine. Es beleuchtet die Entwicklung der Marine von ihren Anfängen bis zur Schlacht von Lissa, einschließlich der Herausforderungen und der Umstrukturierung unter Admiral Dahlerup.
- Quote paper
- Cand. phil. Eric A. Leuer (Author), 2008, Die k.u.k. Kriegsmarine als Ausdruck kolonialer Großmachtpolitik Österreich-Ungarns, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119893