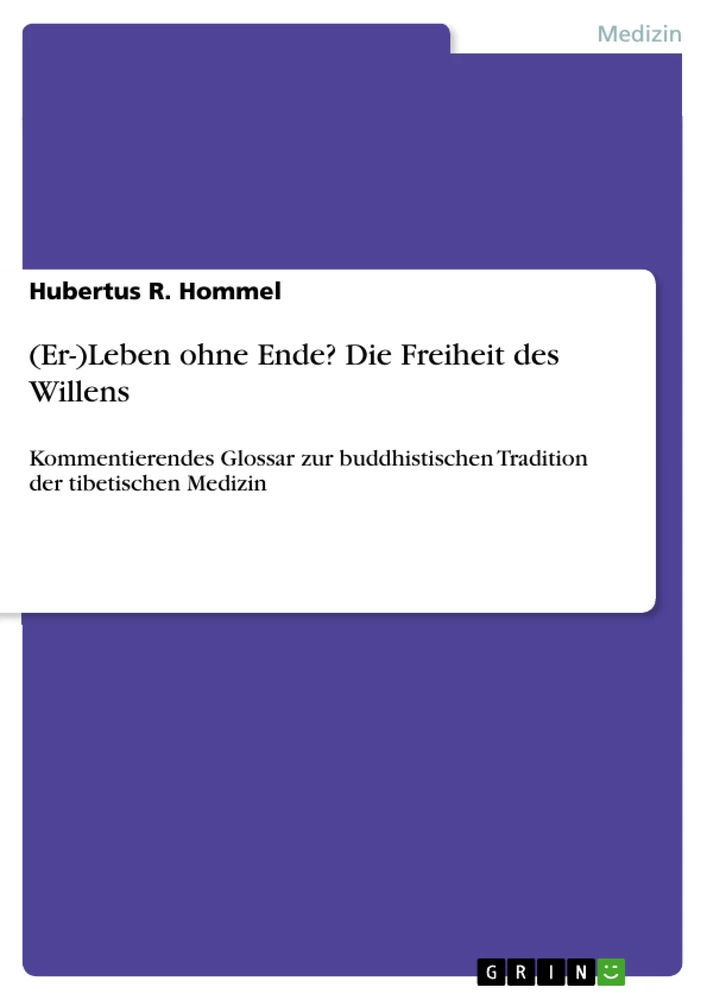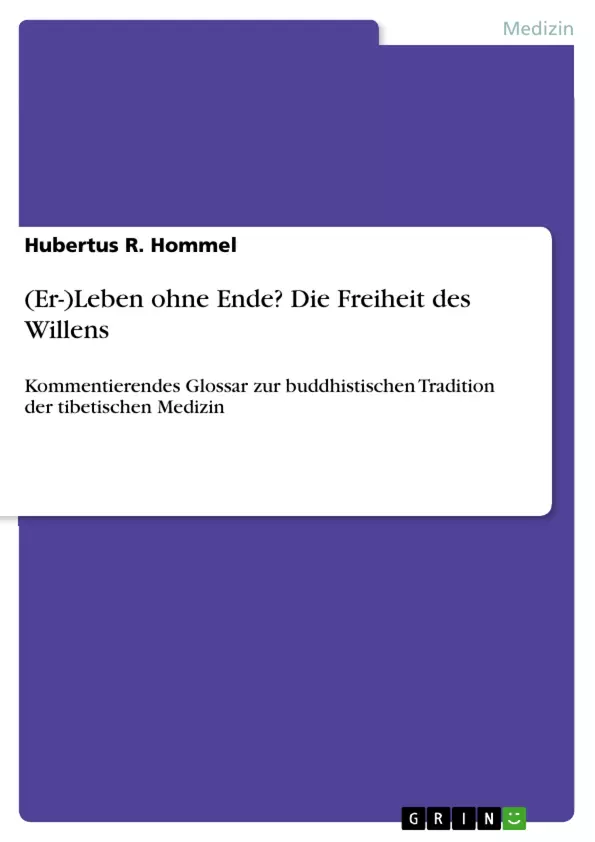In der modernen westlichen Gesellschaft verlieren immer mehr Menschen ihren Bezug zu den traditionellen moralischen Werten, was sich auf ihre Lebens-Orientierung auswirken kann. Dies begünstigt die Entstehung psychischer Störungen und hierüber induzierter psychischer und somatischer Erkrankungen. Gleichzeitig wächst der Wunsch nach neuen, möglicherweise mehr zeitgemäß empfundenen ethischen Richtlinien. Hierfür wird sich neben einer in jüngster Zeit diskreten Renaissance des Christentums zunehmend fernöstlichen Philosophien zugewandt, vor allem dem Buddhismus, da dieser die Eigenverantwortlichkeit für das persönliche Heil außerhalb einer Doktrin betont. Große Anziehungskraft hat neben dem Hinayana und dem Zen-Buddhismus vor allem der Vajrayana; diese tibetische Modifikation des Buddhismus ist ein Synkretismus aus Buddhismus, dem Bön als der traditionellen Religion Tibets sowie aus alten schamanistischen Vorstellungen von zahllosen Dämonen und Geistern. Diese sind in der Tibetischen Medizin als Störelemente und Krankheitsauslöser manifest und als mögliche Krankheitsursachen anerkannt, im Gegensatz zu allen anderen etablierten Medizinauffassungen. Hierbei ist es wichtig festzuhalten, dass die Tibetische Medizin als ein universitäres Studium einen scholastischen Hintergrund hat. Der Vajrayana gesteht das allen buddhistischen Traditionen gemeinsame Ziel der Erleuchtung dem Bewusstsein eines jeden Menschen als bereits grundsätzlich vorhanden zu. Allerdings bezeichnet er es als durch Geistesfehler verschleiert und verschüttet. Dadurch ist er besonders offen für die Diskussion Bewusstseins beeinträchtigender Faktoren und somit für die Bewusstseinsfindung. Mit der Interpretation des Menschen innerhalb eines holistischen Konzeptes als untrennbare Einheit aus Körper, Bewusstsein und Geist bietet der Vajrayana, ebenso wie die Tibetische Medizin als seine praktische Umsetzung, Varianzen der Blickwinkel für die Problematik psychischer und psychisch induzierter Störungen. Daraus definiert er sich als traditionelle Philosophie, deren Grundaussagen mit den modernen Erkenntnistheorien übereinstimmen.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Einführung
- Buddhistische Terminologie
- Tibetische Medizin
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss buddhistischer Philosophie, insbesondere des Vajrayana und der tibetischen Medizin, auf das Verständnis von psychischen und psychosomatischen Erkrankungen. Sie beleuchtet die Unterschiede zwischen westlichen und östlichen Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit und die Rolle von Bewusstsein und Geist in der Entstehung und Bewältigung von psychischen Problemen.
- Der Einfluss buddhistischer Prinzipien auf das Verständnis von Gesundheit und Krankheit.
- Vergleich der westlichen und tibetisch-buddhistischen Sichtweisen auf Geist-Körper-Beziehungen.
- Die Rolle von Bewusstseinsfaktoren in der Entstehung psychischer Störungen.
- Das holistische Konzept des Menschen in der tibetischen Medizin.
- Eigenverantwortlichkeit und psychosoziale Integration.
Zusammenfassung der Kapitel
Das Abstract gibt einen kurzen Überblick über die Thematik. Die Einführung beleuchtet den Wunsch des Menschen nach Überleben und Wohlbefinden, die Herausforderungen der modernen Gesellschaft und das steigende Interesse an fernöstlichen Philosophien. Sie diskutiert die komplexen Beziehungen zwischen Körper und Geist und die Schwierigkeiten bei der Definition des Begriffs "Geist". Es wird der heutige Wunsch nach Selbstfindung und die Bedeutung der psychosozialen Integration thematisiert, sowie die Herausforderungen, die aus dem Missverhältnis zwischen individuellen Erwartungen und den äußeren Lebensbedingungen entstehen können. Schließlich wird die subjektive Natur des Gesundheitsempfindens diskutiert und ein kybernetischer Blickwinkel auf Gesundheit und Krankheit eingeführt.
Schlüsselwörter
Buddhismus, Vajrayana, Tibetische Medizin, Psychische Störungen, Psychosomatische Erkrankungen, Geist-Körper-Beziehung, Bewusstsein, Holistisches Konzept, Eigenverantwortlichkeit, Gesundheit, Krankheit, Kybernetik, Westliche Medizin.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus der Tibetischen Medizin bei psychischen Störungen?
Die Tibetische Medizin betrachtet den Menschen als holistische Einheit aus Körper, Bewusstsein und Geist. Psychische Störungen werden oft als Ergebnis von "Geistesfehlern" oder Störelementen gesehen, die das natürliche Bewusstsein verschleiern.
Welche Rolle spielt der Vajrayana-Buddhismus in diesem Kontext?
Der Vajrayana betont die Eigenverantwortlichkeit für das persönliche Heil. Er geht davon aus, dass Erleuchtung bereits im Bewusstsein vorhanden ist, aber durch emotionale und geistige Trübungen blockiert wird.
Wie unterscheidet sich die Sicht auf Krankheitsursachen von der westlichen Medizin?
In der Tibetischen Medizin werden auch traditionelle Vorstellungen von Dämonen und Geistern als anerkannte Störelemente und Krankheitsauslöser betrachtet, während die westliche Medizin rein somatische oder psychologische Ursachen fokussiert.
Warum wenden sich heute viele Menschen fernöstlichen Philosophien zu?
In einer modernen Gesellschaft, in der traditionelle Werte an Bedeutung verlieren, suchen viele Menschen nach zeitgemäßen ethischen Richtlinien und Wegen zur Selbstfindung, die der Buddhismus durch Eigenverantwortung bietet.
Was versteht man unter einem kybernetischen Blickwinkel auf die Gesundheit?
Dieser Blickwinkel betrachtet Gesundheit als ein dynamisches Gleichgewichtssystem, in dem Körper und Geist ständig interagieren, um auf äußere und innere Belastungen zu reagieren.
- Arbeit zitieren
- Dr.med.dent. Hubertus R. Hommel (Autor:in), 2008, (Er-)Leben ohne Ende? Die Freiheit des Willens, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119911