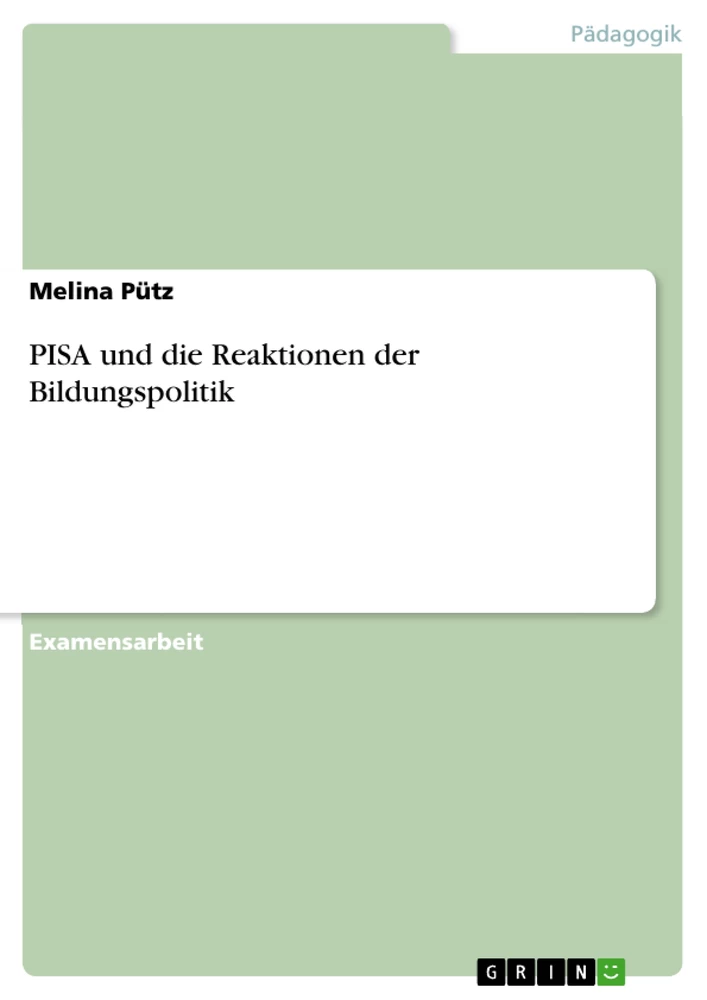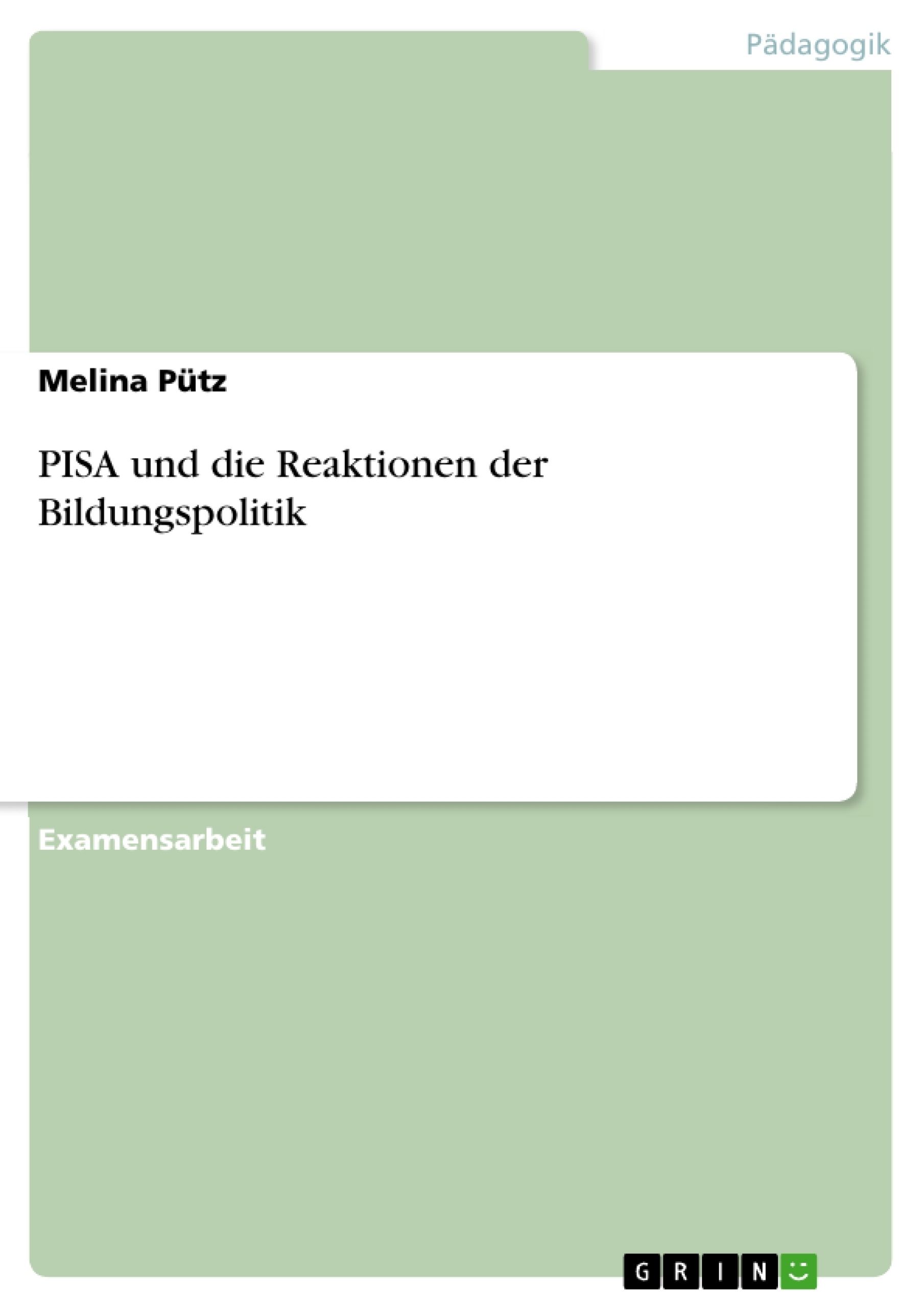Nach Veröffentlichung der ersten PISA-Studie im Dezember 2001 stand Deutschland unter Schock. Das Schulwesen des „Lands der Dichter und Denker“ brachte Schüler hervor, die im Vergleich mit anderen OECD-Staaten in den Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften nicht mal durchschnittliche Kompetenzen aufweisen konnten. Entsprechend groß war der „PISA-Schock“ und Deutschland befand sich erneut in einer „Bildungskatastrophe“.
Das schlechte Abschneiden Deutschlands wurde ganz selbstverständlich mit einem Versagen der Bildungspolitik verknüpft – und zwar nicht nur von der Presse, sondern auch von den Politikern selbst. Zumindest kann die Tatsache, dass die Kultusministerkonferenz nur 2 Tage nach Veröffentlichung der PISA-Ergebnisse einen Maßnahmenkatalog vorlegte, gewissermaßen als Schuldeingeständnis für Versäumnisse aus der Vergangenheit und gleichzeitig zur Demonstration von Handlungsbereitschaft und –vermögen, verstanden werden.
Wenn man die Bildungspolitik für Erfolge oder Scheitern des Schulwesens verantwortlich macht, wie das im Zuge von PISA häufig geschehen ist, sollte eine Analyse der Politik vorangegangen sein, was aber zum Zeitpunkt der öffentlichen Debatte noch keiner getan hatte. Zentrale Fragen wären somit: Wie erkennt, reagiert und verarbeitet Politik Probleme? Wo und wieso könnten Schwierigkeiten innerhalb der Verarbeitung auftreten? Oder konkret auf die Bildungspolitik bezogen:
PISA deckte zentrale Probleme des deutschen Schulwesens auf, dass als „Steuerungswissen“ dienen sollte. Diese Ergebnisse können nach David Easton (1965) als „input“ in das politische System verstanden werden. Wie ging die Politik nun mit diesen „Inputs“ um? Was wurde auch von ihr als Problem definiert und somit auf die Agenda gesetzt und mit welchen Maßnahmen sollten welche Ziele erreicht werden? Von welchen anderen Akteuren wurden sie dabei beeinflusst? Das alles sind zentrale Fragen, die einer politikwissenschaftlichen Klärung bedürfen. Diese Arbeit stellt einen Versuch dar, genau das zu tun.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Relevanz des Themas und Vorgehensweise
- 2. Die Entwicklungen des Bildungssystems und der Bildungspolitik von 1945 bis zur Veröffentlichung der PISA-Studie 2001
- 2.1 Die wichtigsten Entwicklungen im allgemein bildenden Schulwesen und der Bildungspolitik der BRD seit 1945
- 2.2 Strukturwandel des Bildungssystems und der Bildungspolitik nach der Wiedervereinigung
- 3. Akteure der Bildungspolitik im kooperativen Föderalismus
- 3.1 Staatliche bildungspolitische Akteure
- 3.2 Nichtstaatliche bildungspolitische Akteure
- 3.2.1 Parteien
- 3.2.2 Koordinationsgremien
- 3.3 Internationale bildungspolitische Akteure
- 4. Die Ergebnisse der PISA-Studien
- 4.1 Ausgewählte Ergebnisse aus der PISA-Studie 2000
- 4.2 Ausgewählte Ergebnisse aus der PISA-Studie 2003
- 4.3 Ausgewählte Ergebnisse aus der PISA-Studie 2006
- 4.4 Resümee aus drei PISA-Studien
- 5. Policy Making: Entscheidungsfindungsprozess nach PISA
- 5.1 Agendasetting und Politikformulierung
- 5.1.1 Einordnung des Maßnahmenkatalogs der KMK in die Erkenntnisse aus PISA
- 5.1.2 Zentrale aus PISA resultierende Handlungsfelder im Prozess des Agendasettings
- 5.1.2.1 Qualitätsentwicklung und -sicherung
- 5.1.2.2 Verringerung der Selektivität des Bildungssystems
- 5.2 Faktoren, die die politische Problembearbeitung beeinflussen
- 5.1 Agendasetting und Politikformulierung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen der PISA-Studien auf die deutsche Bildungspolitik. Sie analysiert die Entwicklung des Bildungssystems seit 1945 und beleuchtet die Rolle verschiedener Akteure im politischen Entscheidungsprozess. Ein Schwerpunkt liegt auf der Reaktion der Bildungspolitik auf die PISA-Ergebnisse.
- Entwicklung des deutschen Bildungssystems seit 1945
- Einfluss der PISA-Studien auf die Bildungspolitik
- Rolle verschiedener Akteure (staatlich, nicht-staatlich, international)
- Der Policy-Making Prozess nach PISA
- Analyse der PISA-Ergebnisse
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 erläutert die Relevanz des Themas und die methodische Vorgehensweise der Arbeit. Kapitel 2 beschreibt die Entwicklung des deutschen Bildungssystems von 1945 bis zur ersten PISA-Studie, einschließlich der wichtigsten Entwicklungen in der BRD und nach der Wiedervereinigung. Kapitel 3 benennt und analysiert die verschiedenen Akteure der Bildungspolitik, unterteilt in staatliche, nicht-staatliche und internationale Akteure. Kapitel 4 präsentiert ausgewählte Ergebnisse der PISA-Studien aus den Jahren 2000, 2003 und 2006. Kapitel 5 beleuchtet den politischen Entscheidungsprozess (Policy Making) nach der Veröffentlichung der PISA-Studien, insbesondere die Themen Agendasetting und Politikformulierung sowie Einflussfaktoren auf die politische Problembearbeitung.
Schlüsselwörter
PISA-Studie, Bildungspolitik, Bildungssystem, Deutschland, Kooperativer Föderalismus, Policy Making, Qualitätsentwicklung, Selektivität, Bildungsakteure.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem "PISA-Schock"?
Der Begriff beschreibt die Bestürzung in Deutschland nach 2001, als die erste PISA-Studie unterdurchschnittliche Leistungen deutscher Schüler in Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften aufdeckte.
Wie reagierte die Kultusministerkonferenz (KMK) auf die PISA-Ergebnisse?
Bereits zwei Tage nach Veröffentlichung legte die KMK einen Maßnahmenkatalog vor, um Handlungsbereitschaft zu demonstrieren und die Qualitätssicherung im Schulwesen zu verbessern.
Welche zentralen Handlungsfelder wurden durch PISA identifiziert?
Die Schwerpunkte lagen auf der Qualitätsentwicklung und -sicherung sowie der Verringerung der starken sozialen Selektivität des deutschen Bildungssystems.
Welche Akteure beeinflussen die deutsche Bildungspolitik?
Neben staatlichen Akteuren im kooperativen Föderalismus spielen Parteien, Koordinationsgremien sowie internationale Organisationen wie die OECD eine wichtige Rolle.
Wie wird der politische Prozess nach PISA wissenschaftlich eingeordnet?
Die Arbeit nutzt Konzepte wie David Eastons Input-Output-Modell, um zu analysieren, wie PISA-Daten als "Steuerungswissen" in politische Entscheidungen (Policy Making) einflossen.
- Quote paper
- Melina Pütz (Author), 2008, PISA und die Reaktionen der Bildungspolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119977