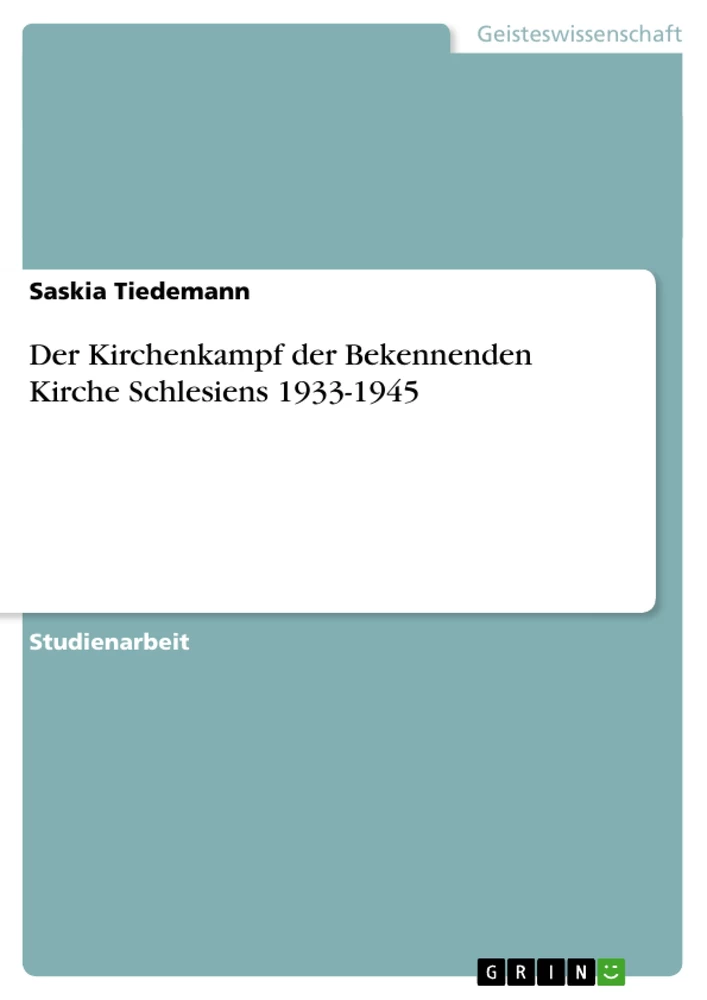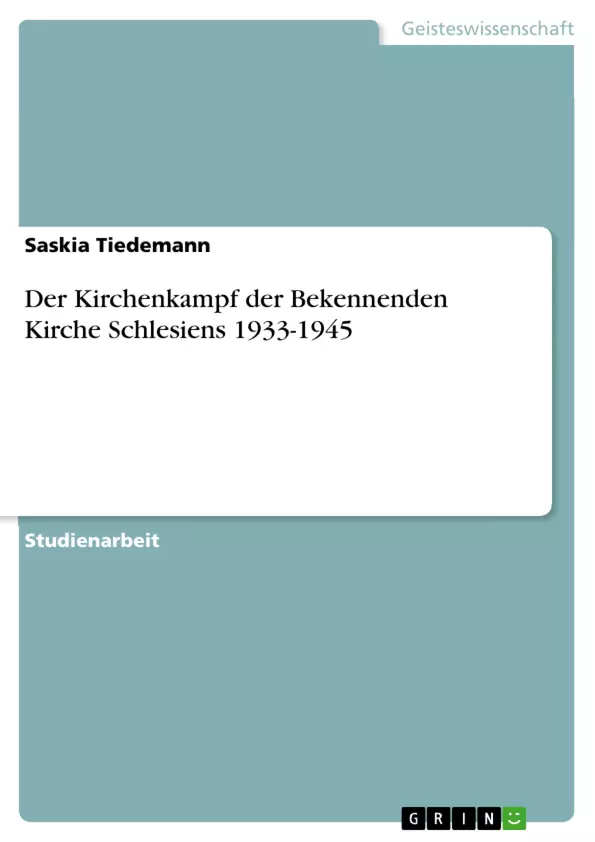Den deutsche Kirchenkampf gegen den nationalsozialistischen Staat (NS-Staat) könnte man
ebenso den Kampf um das Bekenntnis der Kirche nennen(Vgl. Reese S.15). Das mutige und
aktive Agieren vieler bekenntnistreuer Pfarrer und Laien machte es möglich, dem Übergreifen
des NS-Staates mit großem Widerstand zu begegnen. Ein beeindruckendes Exempel zeigt uns
heute der Aufbau und Widerstand der Bekennenden Kirche (BK) Schlesiens auf.
1.2 Zielsetzung
Mein Ziel ist es, die Entstehung, Entwicklung und Ausweitung der Bekennenden Kirche in
Schlesien unter der Herrschaft der Nationalsozialisten zu schildern. Des Weiteren möchte ich
darstellen, wie und wodurch es ihr gelang, dem NS-Staat Widerstand zu leisten.
1.3 Vorgehen
Ich werde die Zustände im Nationalsozialistischen Staat kurz umreißen und auf
kirchenpolitische Gesetze und Bestimmungen eingehen. Als nächstes stelle ich die der
Bekennenden Kirche gegenüber stehende Gruppierung der Deutschen Christen und deren
Grundsätze vor. Danach gehe ich kurz auf die Vorgeschichte der Schlesischen Kirche ein.
Folgend widme ich mich der Bekennenden Kirche Schlesiens zur Zeit der NS-Regierung,
indem ich zuerst ihre Entstehung schildere und dann auf die wichtigsten Ereignisse und vor
allem Synoden eingehe.
[...]
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Problemdarstellung
1.2 Zielsetzung
1.3 Vorgehen
2. Geschichtlicher Kontext
2.1 Der totalitäre nationalsozialistische Staat
2.1.1 Die Entstehung des totalitären nationalistischen Staates
2.1.2 Merkmale / Ideologie des nationalsozialistischen Staates
2.2 Die Deutschen Christen
2.2.1 Entstehung und Aufstieg der Deutschen Christen
2.2.2 Aufgaben und Grundsätze der Deutschen Christen
3. Die Bekennende Kirche Schlesiens
3.1 Vorgeschichte der schlesischen Kirche
3.2 Der Kampf der Bekennenden Kirche Schlesiens gegen den NS-Staat
3.2.1 Der erste öffentliche Widerstand durch die Jungreformatorische Bewegung
3.2.2 Gründung der Deutschen Evangelische Kirche
3.2.3 Die scheinbare Machtergreifung der DC
3.2.4 Die Gründung des Pfarrernotbundes
3.2.5 Der Kirchentag der schlesischen Bekenntnisfront
3.2.6 Die Bekenntnissynode von Barmen
3.2.6 Die Vorläufige Schlesische Synode
3.2.7 Die Spaltung der Bekennenden Kirche in Schlesien
4. Schlussbemerkung
5. Literaturverzeichnis
Anhang
Thesen der Barmer Theologischen Erklärung 1934
1. Einleitung
1.1 Problemdarstellung
Den deutsche Kirchenkampf gegen den nationalsozialistischen Staat (NS-Staat) könnte man ebenso den Kampf um das Bekenntnis der Kirche nennen(Vgl. Reese S.15). Das mutige und aktive Agieren vieler bekenntnistreuer Pfarrer und Laien machte es möglich, dem Übergreifen des NS-Staates mit großem Widerstand zu begegnen. Ein beeindruckendes Exempel zeigt uns heute der Aufbau und Widerstand der Bekennenden Kirche (BK) Schlesiens auf.
1.2 Zielsetzung
Mein Ziel ist es, die Entstehung, Entwicklung und Ausweitung der Bekennenden Kirche in Schlesien unter der Herrschaft der Nationalsozialisten zu schildern. Des Weiteren möchte ich darstellen, wie und wodurch es ihr gelang, dem NS-Staat Widerstand zu leisten.
1.3 Vorgehen
Ich werde die Zustände im Nationalsozialistischen Staat kurz umreißen und auf kirchenpolitische Gesetze und Bestimmungen eingehen. Als nächstes stelle ich die der Bekennenden Kirche gegenüber stehende Gruppierung der Deutschen Christen und deren Grundsätze vor. Danach gehe ich kurz auf die Vorgeschichte der Schlesischen Kirche ein. Folgend widme ich mich der Bekennenden Kirche Schlesiens zur Zeit der NS-Regierung, indem ich zuerst ihre Entstehung schildere und dann auf die wichtigsten Ereignisse und vor allem Synoden eingehe.
2. Geschichtlicher Kontext
2.1 Der totalitäre nationalsozialistische Staat
2.1.1 Die Entstehung des totalitären nationalistischen Staates
Adolf Hitler wurde am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler gewählt.
Am 17. Mai 1933 bekam er vom Reichstag die Zustimmung zum so genannten Ermächtigungsgesetz. Dadurch hatte er die Vollmacht, Gesetze ohne Zustimmung der Volksvertretung und ohne Berücksichtigung der Verfassungsbestimmungen zu erlassen. Von diesem Augenblick an hatte Hitler freie Hand um seine Diktatur zu errichten. Durch das Gleichschaltungsgesetz wurde die Selbständigkeit der Länder aufgehoben und die Landtage wurden aufgelöst. Am 07. April führte Hitler den so genannten „Arieparagraph“, das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, ein. Dieses erlaubte ihm die Eliminierung aller nicht-arischen Beamten.[1] Ab dem 27. April 1933 begann er mit dem Aufbau der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) und am 14. Juli wurde per Gesetz die Neugründung von Parteien verboten. Alle oppositionellen Tätigkeiten und kritischen Äußerungen gegenüber dem NS-Staat wurden von nun an als staatsfeindlicher Akt angesehen und geahndet. Somit war der totalitäre Staat errichtet.
2.1.2 Merkmale / Ideologie des nationalsozialistischen Staates
Die zentralen Merkmale des nationalsozialistischen Staates waren Antisemitismus, Rassismus, Sozialdarwinismus, Militarismus und das Führerprinzip. Der Antisemitismus bezeichnet den Judenhass.
Dieser bezog sich nicht nur auf Menschen der jüdischen Religionsgemeinschaft, sondern auch auf Menschen, die auf Grund ihrer Abstammung dem Judentum zugeschrieben wurden. Der Judenhass gipfelte in deren systematischer Massenvernichtung gipfelte.
Der nationalsozialistische Rassismus ging davon aus, dass es höherwertige und minderwertige Menschen gibt.
Die höherwertige Rasse, welche Hitler in der arischen Rasse sah, hatte die Aufgabe, eben diese rein zu halten. Der Staat erließ beispielsweise Heiratsverbote mit Menschen einer anderen Rasse und ließ geistig behinderte Menschen und Schwerverbrecher sterilisieren, damit ihr krankes Erbgut nicht weitergegeben werde. Hitlers Sozialdarwinismus orientierte sich an Charles Darwins Prinzip der natürlichen Selektion in der Biologie, nur sah Hitler es als Natürliche Vormachtstellung einer Rasse (der arischen Rasse) über andere aus einer grundsätzlichen Überlegenheit der mächtigeren Gruppe heraus.
Der Militarismus steht für eine Ideologie die vorgibt, dass nur durch militärische Stärke Sicherheit und Frieden gewährleistet werden könnten. Das Führerprinzip bedeutet eine einheitliche Ideologie, absoluten Gehorsam des Volkes, welches eine Masse darstellt, gegenüber dem Führer, generelle Ungleichheit der Menschen und Verfolgung von politischen und religiösen Gegnern.
2.2 Die Deutschen Christen
2.2.1 Entstehung und Aufstieg der Deutschen Christen
Die Glaubensbewegung der Deutschen Christen (DC) entwickelte sich 1932 aus einer lokalen Gruppierung, die 1930 in Thüringen entstand und aus dem Bund für deutsche Kirche (auch Deutschkirchler genannt)[2] die seit 1921 unter F. Andersen und K. Niedlich existierten. An ihrer Spitze befand sich J. Hossenfelder.
Auf Grund des politischen Umschwungs in Deutschland fanden die Deutschen Christen enormen Zuspruch.
Nach der Schaffung einer Evangelischen Reichskirche am 23. Juli 1933 erlangten die DC bei den Synodalwahlen in den Landeskirchen die Zweidrittelmehrheit. Damit besetzten sie die wichtigsten Ämter. Ende September 1933 wurde der nationalsozialistische Pfarrer Ludwig Müller, den Hitler „zu seinem Bevollmächtigten für die Angelegenheiten der evangelischen Kirche“[3] gemacht hatte, zum Reichsbischof ernannt.
In diesem Amt konnte er die Arbeit an der Verfassung der Deutschen Evangelischen Kirche enorm beeinflussen. Der Reichsbischof kam an die Spitze der DEK und bekam das Geistliche Ministerium für Leitung und Gesetzgebung zugeordnet.
In den Kirchenwahlen erlangten die DC fast überall die Mehrheit. Dadurch stellten nun sie (abgesehen von Bayern, Hannover und Württemberg) in den Ländern die Landesbischöfe und die Kirchenleitungen. Somit setzten sie im Sommer 1933 ihre kirchliche Machtergreifung durch.
2.2.2 Aufgaben und Grundsätze der Deutschen Christen
Die DC war eine streng nach dem Führerprinzip organisierte Bewegung und diente als Instrument zur Gleichschaltung der evangelischen Kirchen. Sie bildeten sozusagen eine Partei des Nationalsozialismus in der Kirche. Durch sie sollten der Nationalsozialismus und das Christentum eine Synthese eingehen. Im Sinne des Art. 24 des Parteiprogramms der NSDAP bekannten sie sich zu einem „positiven Christentum“. Die DC vertraten eine völkisch bestimmte Theologie und forderten ganz im Sinne des Staates die „Rassenreinheit“ der Kirchen, was in der Übernahme des „Arierparagraphen“ in die Kirchenämter bei der Altpreußischen Synode am 6. und 7. September 1933 gipfelte. Des Weiteren verlangten sie die Loslösung der evangelischen Kirche von ihren jüdischen Wurzeln, was die Abkehr und Verwerfung des als jüdisch angesehenen Alten Testaments bedeutete.
3. Die Bekennende Kirche Schlesiens
3.1 Vorgeschichte der schlesischen Kirche
Die Gemeinden Schlesiens gingen seit der Reformation schon durch einige Glaubenskämpfe. Das Bemerkenswerte ist, dass sie sich trotz des enormen Druckes in der Gegenreformation bewährten. Diese erlebte das fast vollkommen evangelische Schlesien als besonders harte Verfolgung des evangelischen Glaubens. Nachdem Schlesien 1653/54 650[4] ihrer Kirchen verlor, ihre evangelischen Pfarrer vertrieben wurden und 1666 die evangelischen Schulen geschlossen und die Lehrer ausgewiesen wurden sah alles danach aus, als sei der evangelische Glaube in Schlesien entwurzelt.
[...]
[1] „Als nicht-arisch gilt, wer von nicht-arischen, insbesondere jüdischen Eltern oder Großeltern abstammt“(http://www.documentarchiv.de/ns/rbeamtenges-1a_rtl.htm , 07. 07. 2004)
[2] Vgl. Hauschild, Wolf Dieter: Lehrbuch der Kirchen- und Dogmengeschichte.Bd.2 Reformation und Neuzeit. S. 865.
[3] Ebd. S. 866.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Dokuments?
Das Dokument ist eine akademische Arbeit, die sich mit dem Kirchenkampf gegen den Nationalsozialismus, speziell mit der Bekennenden Kirche (BK) Schlesiens, auseinandersetzt. Es beleuchtet die Entstehung, Entwicklung und den Widerstand der BK Schlesiens gegen den NS-Staat.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Entstehung, Entwicklung und Ausweitung der Bekennenden Kirche in Schlesien unter der Herrschaft der Nationalsozialisten zu schildern. Ein weiteres Ziel ist es, darzustellen, wie und wodurch es der Kirche gelang, dem NS-Staat Widerstand zu leisten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Einleitung, geschichtlichen Kontext, die Bekennende Kirche Schlesiens, Schlussbemerkung und Literaturverzeichnis. Der geschichtliche Kontext umfasst den totalitären nationalsozialistischen Staat und die Deutschen Christen. Der Abschnitt zur Bekennenden Kirche Schlesiens behandelt die Vorgeschichte der schlesischen Kirche und den Kampf der Bekennenden Kirche gegen den NS-Staat.
Was waren die zentralen Merkmale des nationalsozialistischen Staates?
Die zentralen Merkmale waren Antisemitismus, Rassismus, Sozialdarwinismus, Militarismus und das Führerprinzip.
Wer waren die Deutschen Christen (DC)?
Die Deutschen Christen waren eine Glaubensbewegung, die eine Synthese zwischen Nationalsozialismus und Christentum anstrebte. Sie forderten die "Rassenreinheit" der Kirchen und die Loslösung von jüdischen Wurzeln.
Wie entstand die Bekennende Kirche Schlesiens?
Die Bekennende Kirche Schlesiens entstand als Reaktion auf die Gleichschaltungsbestrebungen des NS-Staates und die Bestrebungen der Deutschen Christen, die evangelischen Kirchen im Sinne der NS-Ideologie zu beeinflussen. Sie setzte sich für die Bewahrung des christlichen Bekenntnisses ein.
Was war die Barmer Theologische Erklärung?
Die Barmer Theologische Erklärung (wird im Anhang erwähnt) war ein zentrales Dokument der Bekennenden Kirche, in dem sie sich gegen die Vereinnahmung der Kirche durch den NS-Staat aussprach und auf die alleinige Autorität des Wortes Gottes verwies.
Welchen Widerstand leistete die Bekennende Kirche Schlesiens?
Die Bekennende Kirche Schlesiens leistete Widerstand, indem sie sich gegen die ideologische Vereinnahmung durch den NS-Staat wehrte, an ihrem Bekenntnis festhielt und sich aktiv für verfolgte Christen einsetzte. Dies geschah beispielsweise durch die Gründung des Pfarrernotbundes.
Was ist der Pfarrernotbund?
Der Pfarrernotbund war eine Organisation, die gegründet wurde, um Pfarrer zu unterstützen, die aufgrund ihrer Gegnerschaft zum Nationalsozialismus und den Deutschen Christen verfolgt wurden. Er bot materielle und moralische Unterstützung.
Was bedeutete der "Arierparagraph" für die Kirchen?
Der "Arierparagraph" führte dazu, dass Menschen jüdischer Herkunft von kirchlichen Ämtern ausgeschlossen wurden, was eine rassistische Diskriminierung innerhalb der Kirche darstellte.
- Quote paper
- Saskia Tiedemann (Author), 2004, Der Kirchenkampf der Bekennenden Kirche Schlesiens 1933-1945, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119989