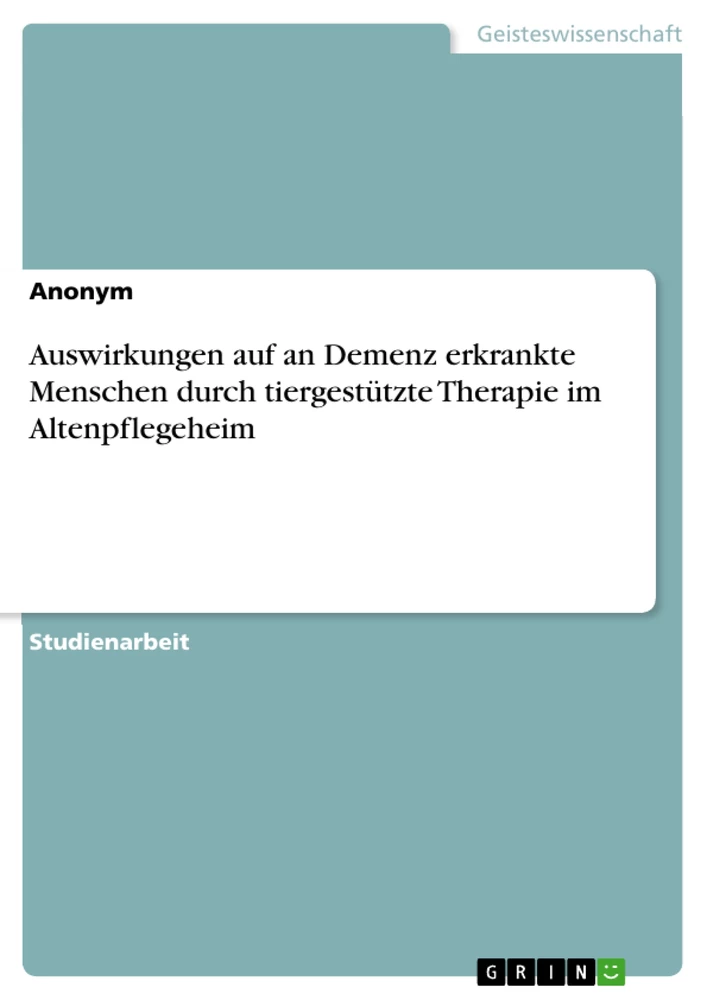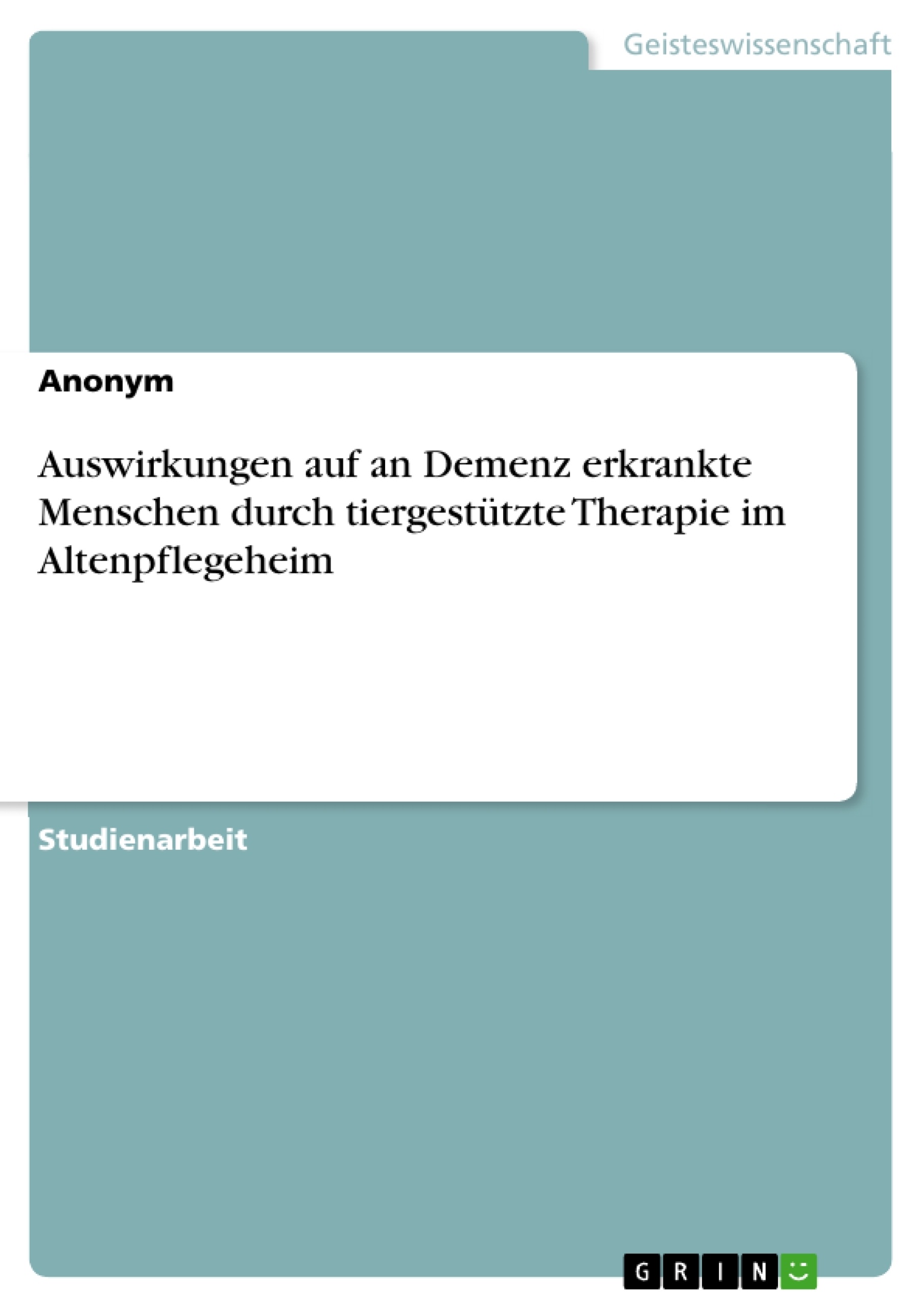Tiere gelten schon lange als Freund und Gefährte des Menschen. Die Beziehung zwischen Mensch und Tier entsteht durch das gemeinsame Zusammenleben und die Erfahrungen, die dadurch gewonnen werden. Tiere wirken nicht wie Tabletten oder Tropfen, um Störungen zu korrigieren. Sie sind Bindungspartner, deren therapeutische Wirkung sich innerhalb eines komplexen Beziehungsprozesses ausbildet.
Im Folgenden werde ich der Hypothese nachgehen, ob und inwiefern es Tieren möglich ist, die Lebensqualität und das Wohlbefinden demenziell erkrankter Menschen positiv zu beeinflussen und somit auch im Umkehrschluss die Pflege der Erkrankten zu erleichtern. Um dieser Hypothese nachzugehen, werde ich zunächst die Demenzerkrankung definieren, Symptome darstellen und die aus der Krankheit resultierenden Bedürfnisse der Betroffenen darstellen. Im nächsten Schritt werde ich mich der tiergestützten Therapie und der Beziehung zwischen Mensch und Tier widmen. Im letzten Schritt, werde ich die Demenz mit der tiergestützten Therapie in Verbindung bringen und überprüfen, inwiefern die tiergestützte Therapie im Altenpflegeheim bei den Demenzerkrankten anwendbar ist und welche Auswirkungen diese Form der Therapie im Bezug auf die Hypothese mit sich bringt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Definition Demenz
- Symptome der Demenz
- Bedürfnisse demenziell erkrankter Menschen
- Definition tiergestützte Therapie
- Beziehung zwischen Mensch und Tier und deren Wirkung
- Strukturen in Altenpflegeheimen und Betreuung Demenzkranker
- Tiergestützte Therapie im Altenpflegeheim mit demenziell erkrankten Menschen
- Auswirkungen von tiergestützter Therapie bei Demenz im Altenpflegeheim
- Definition Demenz
- Schluss/Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Auswirkungen tiergestützter Therapie auf demenziell erkrankte Menschen in Altenpflegeheimen. Im Fokus steht die Frage, ob und inwiefern Tiere die Lebensqualität und das Wohlbefinden demenziell Erkrankter verbessern und die Pflege erleichtern können. Dazu wird die Demenzerkrankung definiert, die Symptome und Bedürfnisse der Betroffenen dargestellt sowie die tiergestützte Therapie und die Mensch-Tier-Beziehung beleuchtet. Die Arbeit untersucht schließlich, inwiefern sich die tiergestützte Therapie im Altenpflegeheim bei Demenzpatienten anwenden lässt und welche Auswirkungen sie im Bezug auf die Hypothese hat.
- Definition und Symptome von Demenz
- Bedürfnisse demenziell erkrankter Menschen
- Tiergestützte Therapie und ihre Wirkungsmechanismen
- Anwendung der tiergestützten Therapie im Altenpflegeheim
- Auswirkungen der tiergestützten Therapie auf Demenzpatienten
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit beleuchtet die wachsende Zahl demenziell erkrankter Menschen aufgrund des demografischen Wandels und stellt die Hypothese auf, dass tiergestützte Therapie die Lebensqualität und das Wohlbefinden der Betroffenen verbessern kann.
- Definition Demenz: Dieses Kapitel definiert die Demenzerkrankung, beschreibt die Symptome und erörtert die besonderen Bedürfnisse demenziell erkrankter Menschen.
- Definition tiergestützte Therapie: Dieses Kapitel erklärt die tiergestützte Therapie und untersucht die positive Wirkung der Mensch-Tier-Beziehung.
- Strukturen in Altenpflegeheimen und Betreuung Demenzkranker: Dieses Kapitel beschreibt die Strukturen von Altenpflegeheimen und die Betreuung von Demenzpatienten. Es beleuchtet die Einsatzmöglichkeiten der tiergestützten Therapie in diesem Kontext.
Schlüsselwörter
Demenz, tiergestützte Therapie, Altenpflegeheim, Lebensqualität, Wohlbefinden, Mensch-Tier-Beziehung, Bedürfnisse demenziell erkrankter Menschen, Auswirkungen, Anwendung.
Häufig gestellte Fragen
Wie hilft tiergestützte Therapie demenziell erkrankten Menschen?
Tiere dienen als Bindungspartner, die das Wohlbefinden steigern, Stress reduzieren und die Lebensqualität durch emotionale Zuwendung verbessern können.
Können Tiere die Pflege im Altenheim erleichtern?
Ja, da Tiere oft beruhigend wirken und den Zugang zu den Erkrankten erleichtern, kann dies die tägliche Pflegearbeit für das Personal entlasten.
Welche Bedürfnisse haben Demenzpatienten?
Demenzkranke benötigen Sicherheit, emotionale Bestätigung und soziale Interaktion. Tiere können diese Bedürfnisse erfüllen, ohne zu urteilen oder kognitive Leistungen zu fordern.
Gibt es Risiken bei der Tierhaltung im Pflegeheim?
Die Arbeit untersucht auch die Strukturen in Heimen, wobei Hygienevorschriften und die Auswahl geeigneter Tiere für die Sicherheit der Bewohner entscheidend sind.
Warum wirken Tiere anders als Medikamente?
Tiere korrigieren keine Störungen durch Wirkstoffe, sondern wirken durch einen komplexen Beziehungsprozess, der die Psyche und die Motorik gleichermaßen anspricht.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2019, Auswirkungen auf an Demenz erkrankte Menschen durch tiergestützte Therapie im Altenpflegeheim, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1201374