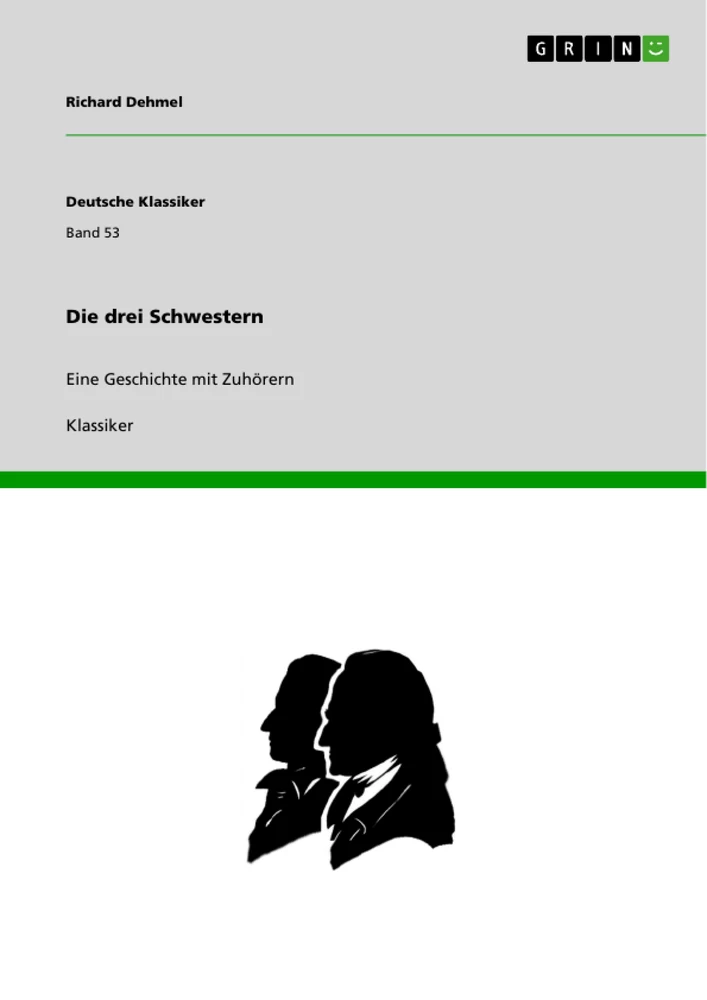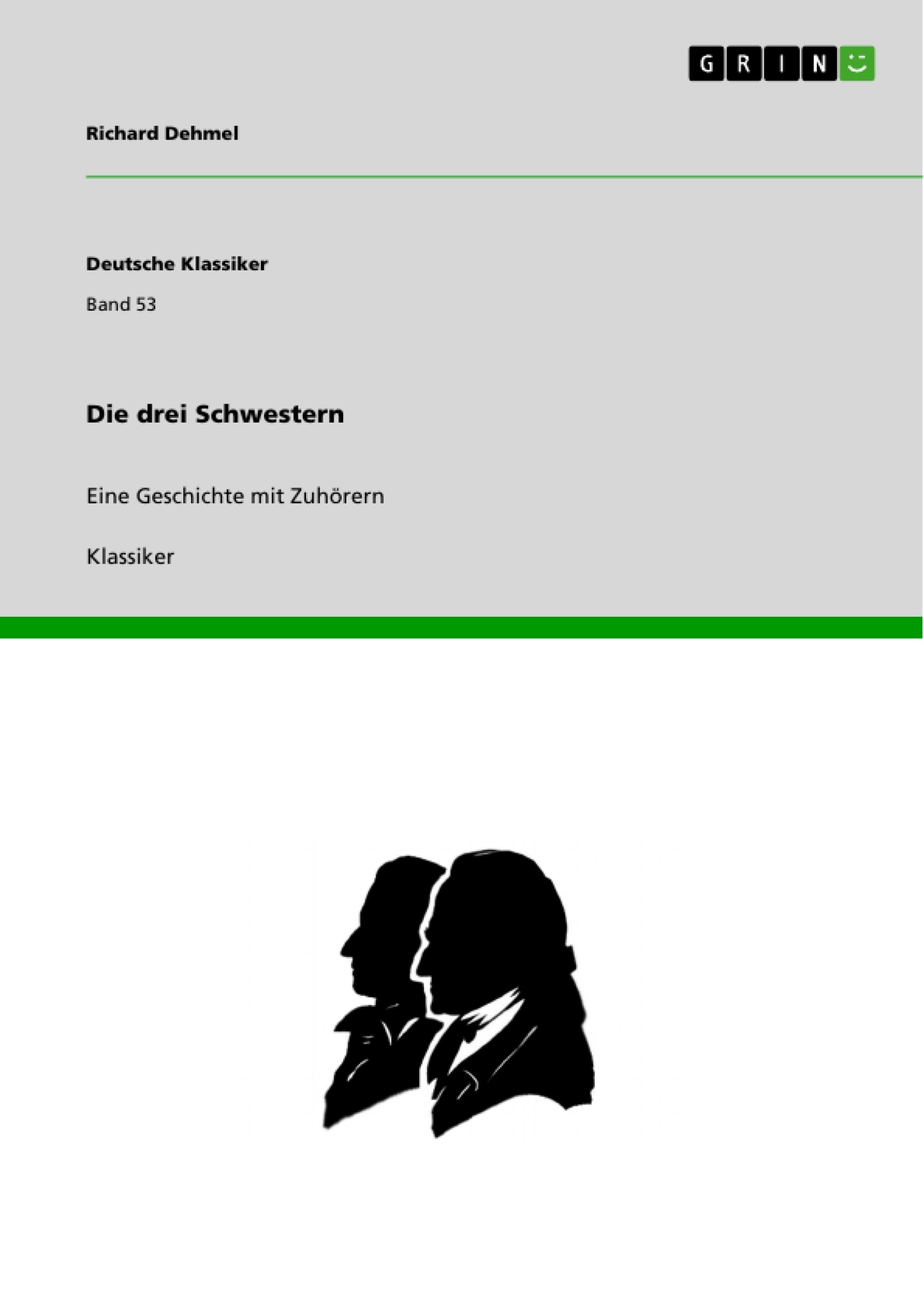„Ja – also – die Geschichte, die ich heut erzählen will“, fing der kleine Amtmann bedächtig an, „müßte sich eigentlich so ein richtiger Geschichtenschreiber vornehmen, wenn’s was Orndtliches werden sollte; und habe sie sowieso nur stückweise selber mitangesehen, das Meiste von Andern gehört, und da werd’ich wol den Karren nur mühsam vorwärts schieben können. Aber Das sag’ich Ihnen –“
„Na, Sie haben gewiß wieder ein besondres Schrot im Lauf“, knurrte der Förster. „Drücken Sie man los!“
Der Buchhändler des Städtchens aber stieß seinen Freund in die Seite, machte ein schlaues Gesicht und sagte überlegen: „Willst wol Spannung erregen, Furchenrath? Kunstkniffe, Kunstkniffe! Kennt man, zieht nicht! Und wenn du noch soviel dazudichtest.“
„Diesmal ist das Dichten überflüssig“, verteidigte sich der Amtmann. „Trotzdem die Geschichte einfach genug ist“, fügte er nach einer Weile ernst hinzu. „Also –“ [...]
„Ja – also – die Geschichte, die ich heut erzählen will“, fing der kleine Amtmann bedächtig an, „müßte sich eigentlich so ein richtiger Geschichtenschreiber vornehmen, wenn’s was Orndtliches werden sollte; und habe sie sowieso nur stückweise selber mitangesehen, das Meiste von Andern gehört, und da werd’ich wol den Karren nur mühsam vorwärts schieben können. Aber Das sag’ich Ihnen –“
„Na, Sie haben gewiß wieder ein besondres Schrot im Lauf“, knurrte der Förster. „Drücken Sie man los!“
Der Buchhändler des Städtchens aber stieß seinen Freund in die Seite, machte ein schlaues Gesicht und sagte überlegen: „Willst wol Spannung erregen, Furchenrath? Kunstkniffe, Kunstkniffe! Kennt man, zieht nicht! Und wenn du noch soviel dazudichtest.“
„Diesmal ist das Dichten überflüssig“, verteidigte sich der Amtmann. „Trotzdem die Geschichte einfach genug ist“, fügte er nach einer Weile ernst hinzu. „Also –“
„Ein’n Augenblick! Erst mal einschenken!“ Der Wirt des Gasthauses raffte sich aus seinem Armstuhl auf und füllte die Gläser von Frischem. Dann schloß er die Thür des kleinen Hinterzimmers und schob sich wieder an den Stammtisch. Der Amtmann hatte sich in das alte, hohe Sopha zurückgelehnt; da saß er in sich versunken, wie eine Grille im Sandloch. Es war ganz still in der Stube; man hörte die Flamme am Dochte der verräucherten Hängelampe nagen. Die dreie merkten, daß in dem hagern Männchen heftige Erinnerungen brannten, und seine Stimmung teilte sich ihnen mit.
„Also“ – er richtete sich halb auf und strich über sein spärliches Haar – „ja! sehr einfach.“ Seine fadenscheinige Stimme zerriß fast. „Das Mädchen“ – er fuhr sich nochmals über den Schädel, dann rückte er sich ganz zurecht. „Ja! Als ich sie das erste Mal zu sehen krigte, war mir, als hätt ich sie schon lange gekannt. Und später wurde mir auch klar, woher das kam; denn ihr Thun und Gang und Wesen war, wie man es in den alten Märchen liest.
Ich selbst war dazumal noch so ein rechter grüner Grashüpfer, etwa zwei Jahre älter als sie, eben erst mündig geworden, und sollte grade anfangen, das Gut meines Vaters zu bewirtschaften, nachdem ich mich genugsam draußen umgethan und mein Militärjahr abgedient hatte. Inzwischen war sie von dem Alten eingestellt worden.
Es wußte niemand so recht, von wannen sie stammte; unsre Leute aber sagten immer, sie sei vom „leewen Godd“ gekommen.
Und das war so gekommen. Eines Tages hatte sie bei uns angeklopft und einen Dienst begehrt; und mein Vater, der sonst schwerlich etwas doppelt sagte, besonders zu uns Kindern, hat mir zweimal ausführlich erzählt, wie sie ihn so rührend und zugleich doch so gewißlich angesehen, daß er’s ihr nicht abschlagen konnte, trotzdem er fast schon überflüssig viel Hände in Lohn zu haben meinte. Am andern Tage hatte dann aus einem katholischen Nachbardorf der Pfarrer ihre Habseligkeiten geschickt; und ab und zu erkundigte er sich, ob sie brav und anstellig wäre. Und so wurde denn zuerst gar Manches unter den Leuten geredet, wenn auch nie, wie sonst gewöhnlich, spitz und hämisch, sondern immer fein behutsam und ins Fromme deutsam, bis man sie zuletzt das Herrgottskäferchen nannte; denn zufällig hieß sie auch Marie. Der Alte aber ließ sich über keinen von ihren Umständen aus; und man fragte ihn nicht leicht, wenn er nicht von selber sprach.
Und bald spürte er auch, daß es Menschen gibt, die niemals überflüssig sind. Und weil sie sich so wacker in Haus und Stall und Scheune umthat und Alles unter ihren Händen in gleichsam sonntaglicher Sauberkeit gedieh, so machte er sie schon nach einem Jahre zur Obermagd, und es war ihr auch diesmal keine von den andern Dirnen gram darum gewesen. Sie waren ihr alle zu Willen, noch eh sie zu befehlen brauchte; so sehr wirkte auf diese einfachen Seelen die sanfte Gelassenheit ihrer Mienen und die stille Bestimmtheit ihres Treibens. Wie sie überhaupt nicht reich an Worten schien. Und doch war nichts Verstecktes in ihr und Nichts, was etwa Andern die Worte benahm. In ihren Augen konnte man ihre Gedanken spielen sehen wie die Fische in einem klaren Teiche; und wem sie so mit ihrer aufmerksamen Freundlichkeit zu Munde hörte, der wurde noch Einmal so wortfroh wie sonst und meinte, wenn er von ihr ging, von ihren Lippen vieles Gute erlauscht zu haben. Wenn’s aber an sie trat, daß sie etwas sagen mußte, durfte man’s getrost auf die Goldwage legen, und was sie that, kam aus beiden Armen und stand auf beiden Beinen.“
Der Buchhändler hatte schon zweimal gehustet und stark mit den Augen gezwinkert. Jetzt mochte ihm das Loben aber doch zu bunt geworden sein, und er platzte heraus: „Na, du warst wol schön verschossen!“ Und der Förster schmunzelte, daß sich ihm die Bartspitzen um die Mundwinkel sträubten. Der Wirt indessen liebkoste gemächlich seine Ohren, gleich Einem, dem schon sehr viel Menschliches das Trommelfell erschüttert hat.
Da merkte der Amtmann, daß er mehr verraten hatte, als er wollte. Aber als ein Mann, der seine Rechnung mit sich fertig hat und mit Ruhe vom Leben sprechen kann, erwiderte er gemessen: „Ja, meine Verehrten, ich habe nach Dieser Keine mehr leiden mögen.“
Nun wurden auch die Andern wieder ernst, und der Buchhändler schaute fast ehrfürchtig auf die grauen Haare seines Freundes, der aus Liebe einsam geblieben war, der so verschlossenen Gemütes schien und doch so gern erzählte, und dem zum ersten Male jetzt der Schlüssel seines Innern aus den Fingern glitt.
„Ja, also“ – begann er aufs Neue – „ja: ich hatte damals schon manche Schürzenschleife aufgebunden. Denn die Worte sprangen mir seit jeher von den Lippen wie reife Erbsen aus der Hülse, und das haben die Dinger ja gern. Nur dieser vermochte ich nichts Schönes zu sagen, so sehr mir der Sinn danach stand. Das ging aber Allen so; denn sie hatte eine Schwäche.“
„Siehst du, Büchermade“, wandte er sich an den Freund, „jetzt kommen auch ihre Fehler an die Reihe – oder besser: ihr Fehl. Ja: Eins fehlte ihr, um ganz fürs Leben geschickt zu sein: die rechte Unbefangenheit. Man durfte ihr nicht von ihr selber sprechen; dann wurde sie fast ängstlich, wie eine Schnecke, der man an die Fühler gegriffen hat. Und war dies doch einmal geschehen, so konnte man die Furcht davor noch lange auf ihrem Gesichte lesen, sobald man wieder in ihre Nähe trat. Daher sich jeder bei uns hütete, ihr stilles Wirken zu stören.
So lagen Entschlossenheit und Schüchternheit, Besonnenheit und Zagheit in ihrer Seele neben einander, wie Fäden, die nicht recht zu einem festen Band verflochten waren. Mich aber rührte das vielleicht besonders – und den Vater wol auch, weil meine tote Mutter von ähnlicher Art gewesen war, obschon gesprächiger und weniger zart von Wuchs.
Ja! – Aber Einer lebte doch auf unserm Hof herum, vor dem sie nicht beiseite wich, was immer für Reden er an sie brachte; der Heinrich Wendel. Das kam nun freilich sehr allmählich erst in Fluß; denn dem krochen für gewöhnlich die Worte aus dem Munde wie die Regenwürmer aus der Erde, und daher hieß man ihn mitunter wol den stummen Heinz oder auch – in unsrer Mundart da oben – den Träumling. Er mochte ein gut Jahr älter sein als ich, und wir kannten uns von jung auf. Wir hatten in der Hauptstadt zusammen auf der hohen Schule gesessen, wie sie bei uns das Gymnasium nennen. Allerdings blos in den unteren Klassen, da er in der Tertia hängen blieb und dann abging, um daheim die Raupen unter seinem Flachskopf möglichst unbehelligt weiternisten zu lassen.
Er war nämlich nicht eigentlich dumm, aber hatte immer etwas mehr im Kopf als das, worauf’s gerade ankam. Und wenn man eine Frage an ihn that, dann dämmerte in seinen Augen immer so ein wunderndes Lächeln auf, als ob ein Kind aus Träumen erwacht. Weil er aber ein hübscher Bengel war, hatten ihn die Lehrer gern und schoben ihn anfangs mit fort, zumal er von Zeit zu Zeit eine gute Arbeit lieferte. Die Jungens freilich hänselten ihn wegen seines verlorenen Wesens, und so wurde er so nach und nach noch wortkarger und stillsinniger, als er von Natur schon war; außer daß hin und wieder zu Aller Staunen eine jähe Ausgelassenheit in seltsam kindischen Sprüngen und Tänzen aus ihm herausbrach.
Solch Gebaren überkam ihn noch am Tage seiner Einsegnung – fünfzehn Jahre war er damals –, weil er sich wieder auf seinem Besitztum einhecken durfte; das lag etwa zwei Meilen von dem unsrigen entfernt. Dort lebte er in Gemeinschaft mit seinen drei Schwestern, die sämtlich älter waren als er und ihn sehr verhätschelten. Die Mutter, eine schlichte, nachdenkliche Frau, war schon vor Jahren gestorben – wie man sagte: aus Gram über ihren Mann.
Der war nämlich Einer von den neumodischen Großbauern, denen der gemächliche Erwerbssinn von ehedem im Gewoge unsrer hastigen Zeit so langsam ersäuft, bis sie ihren Reichtum nicht mehr hinterm Pfluge aus dem Acker, sondern auf der Eisenbahn aus den Bankhäusern der großen Stadt holen wollen. Er hatte in amerikanischen Bergwerkspapieren spekulirt und ausnahmsweise Glück gehabt. Zugleich aber hatte die Genußsucht, die hinter dem leichten Gewinn her in die Städte schlich, sein hitziges Blut angesteckt, und man erfuhr, daß er von seinen Reisen meist erst über die Weinstuben und schlimmere Orte hinweg heimkehrte. Und das gab ihm auch den Rest. Denn als er einsmals, in der Dorfschenke, ein Schwindler gescholten wurde, hat ihn in der Wut des Rausches ein unmenschlicher Zorn überwältigt, also daß ein Schlagfall ihn niederwarf, an dem er Tags darauf verstarb.“
Jetzt müßigte sich auch der Wirt zu der Erzählung seines Gastes eine Regung des Beifalls ab und machte „Hm, ja!“ Auch schien er daran eine Erläuterung knüpfen zu wollen, denn sein Mund rundete sich sacht, als ob er ein Wort auf der Zunge wälzte.
Der Amtmann aber ließ sich nicht stören und fuhr fort: „Bei alledem war er doch altväterisch oder einsichtig genug gewesen – oder zur rechten Zeit unter die Erde gefahren, um das Gewonnene nicht in weiteren Wagnissen zu verzetteln. Vielmehr hatte er’s zumeist in Grund und Boden festgelegt und einen stattlichen Besitz von Land und Wiesen um sein Gehöft gesammelt. Und das Anwesen, das er seinen Kindern hinterließ, war der schönste Bauernhof in der Umgegend und konnte sich mit manchem altvererbten Rittergute messen.
Da also machten sich’s die vier Geschwister nach dem Tode des Alten bequem. So lange der nämlich lebte, hatte er sie nicht viel um sich gelitten; teils wol, um ungestörter seinen wüsten Sinnen nachzuhängen, vielleicht auch weil er sich im Grunde seines ungezähmten, aber väterlichen Herzens vor den heranwachsenden Töchtern schämte. Vornehmlich aber sollten sie – wie er selbst sich ausdrückte – mit der Welt mitgehen lernen, wovon ja ein Jeder seine eigene Auffassung hat. Und wenn er sich auch selber nicht wenig drauf zugute that, daß er mit der Mistforke angefangen hatte, und nicht selten mit seiner Unwissenheit und seinen harten Händen prahlte, so sollten seine Kinder doch mal wissen, was vornehme Art wäre; und er träumte gar vielleicht von adeligen Schwiegersöhnen.
Die Fräuleins aber mochten wol der Meinung sein, daß die Wissenschaft und das Weltverständnis, worauf der Alte sie verwies, zur Genüge in seinem Gelde steckten. Denn wie sie aus ihrer Erziehungsanstalt heimkehrten, war nicht viel mehr an ihnen hängen geblieben, als der äußerliche Modekram, allsodaß die guten alteingesessenen Familien, an welche sie sich drängten, ihnen die Lust zu weiteren Besuchen durch einige verbrämte Deutlichkeiten bald benahmen. Und da sie selbst sich für den Umgang mit Ihresgleichen zu fein dünkten, so geschah es, daß sie schließlich ganz auf ihre eigene Vornehmheit angewiesen waren.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Geschichte?
Die Geschichte beginnt mit einer Einführung, in der ein kleiner Amtmann verspricht, eine Geschichte zu erzählen. Er betont, dass sie eigentlich von einem professionellen Geschichtenschreiber bearbeitet werden sollte, da er sie nur stückweise erlebt oder von anderen gehört hat. Er warnt davor, dass er die Geschichte nur mühsam vorwärts bringen kann. Der Förster fordert ihn auf, zu beginnen, während der Buchhändler den Amtmann beschuldigt, Spannung erzeugen zu wollen. Der Amtmann verteidigt sich und betont, dass die Geschichte einfach genug sei.
Wer sind die Hauptfiguren zu Beginn der Geschichte?
Die Hauptfiguren zu Beginn sind der kleine Amtmann (der Erzähler), der Förster, der Buchhändler und der Wirt des Gasthauses.
Wie wird das Mädchen (Marie) beschrieben, um die es in der Geschichte geht?
Das Mädchen, Marie genannt, wird als jemand beschrieben, der dem Amtmann von Anfang an bekannt vorkam. Ihr Verhalten und Wesen werden mit alten Märchen verglichen. Sie wird als vom "leewen Godd" (lieben Gott) gekommen bezeichnet. Sie wurde von dem Alten (dem Vater des Amtmanns) eingestellt, da sie ihn mit ihrem rührenden und gewissen Blick überzeugte. Der Pfarrer aus dem Nachbardorf schickte ihre Habseligkeiten.
Wie war Maries Rolle auf dem Hof?
Marie war fleißig und sorgte für Sauberkeit im Haus, Stall und Scheune. Nach einem Jahr wurde sie zur Obermagd ernannt, was von den anderen Dirnen akzeptiert wurde. Sie wirkte sanft und bestimmt auf die einfachen Seelen. Sie sprach wenig, aber ihre Gedanken waren in ihren Augen erkennbar. Ihre Ratschläge wurden geschätzt und ihre Handlungen waren überlegt.
Wie reagierten die anderen auf die Lobreden des Amtmanns über Marie?
Der Buchhändler unterbrach den Amtmann und deutete an, dass er in Marie verliebt gewesen sei. Der Förster schmunzelte. Der Wirt hörte aufmerksam zu. Der Amtmann bestätigte, dass er nach ihr keine andere mehr leiden mochte.
Was fehlte Marie, um ganz fürs Leben geschickt zu sein?
Marie fehlte die rechte Unbefangenheit. Sie wurde ängstlich, wenn man sie auf sich selbst ansprach. Sie hatte eine Schwäche, nämlich Schüchternheit und Zaghaftigkeit neben Entschlossenheit und Besonnenheit.
Wer war Heinrich Wendel und welche Beziehung hatte er zu Marie?
Heinrich Wendel, auch "stummer Heinz" oder "Träumling" genannt, war ein Nachbar, den der Amtmann von der Schule kannte. Anders als die Anderen wich Marie vor seinen Reden nicht zurück. Heinrich war wortkarg und in seinen Gedanken versunken, aber er war auch ein hübscher Bengel. Seine Familie bestand aus drei älteren Schwestern, die ihn verhätschelten. Sein Vater war ein spekulativer Großbauer, der früh starb.
Wie war das Verhältnis von Heinrich Wendels Familie, besonders der Schwestern, zu den anderen im Dorf?
Nach dem Tod des Vaters lebten die vier Geschwister bequem. Die Schwestern wurden in ihrer Erziehungsanstalt nicht sehr gelehrt und legten Wert auf Mode. Sie wurden von den alteingesessenen Familien gemieden und grenzten sich selbst aus, indem sie sich für vornehmer hielten. Sie lebten in Einigkeit untereinander, beschwerten sich über den Hochmut der Anderen und hielten sich für etwas Besseres.
- Arbeit zitieren
- Richard Dehmel (Autor:in), 2008, Die drei Schwestern, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120172