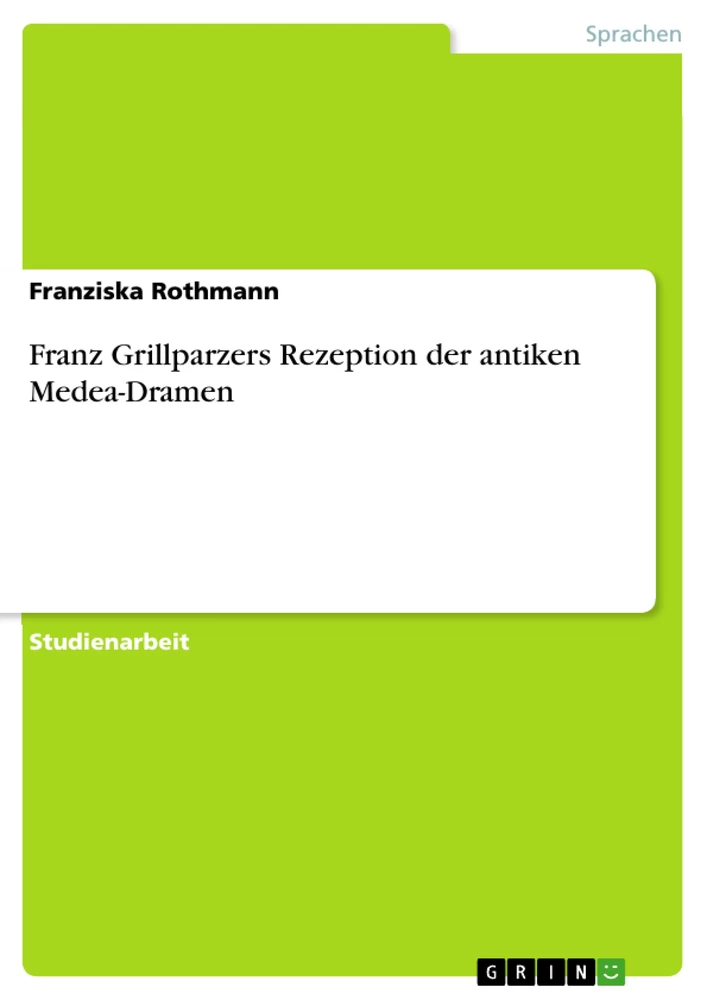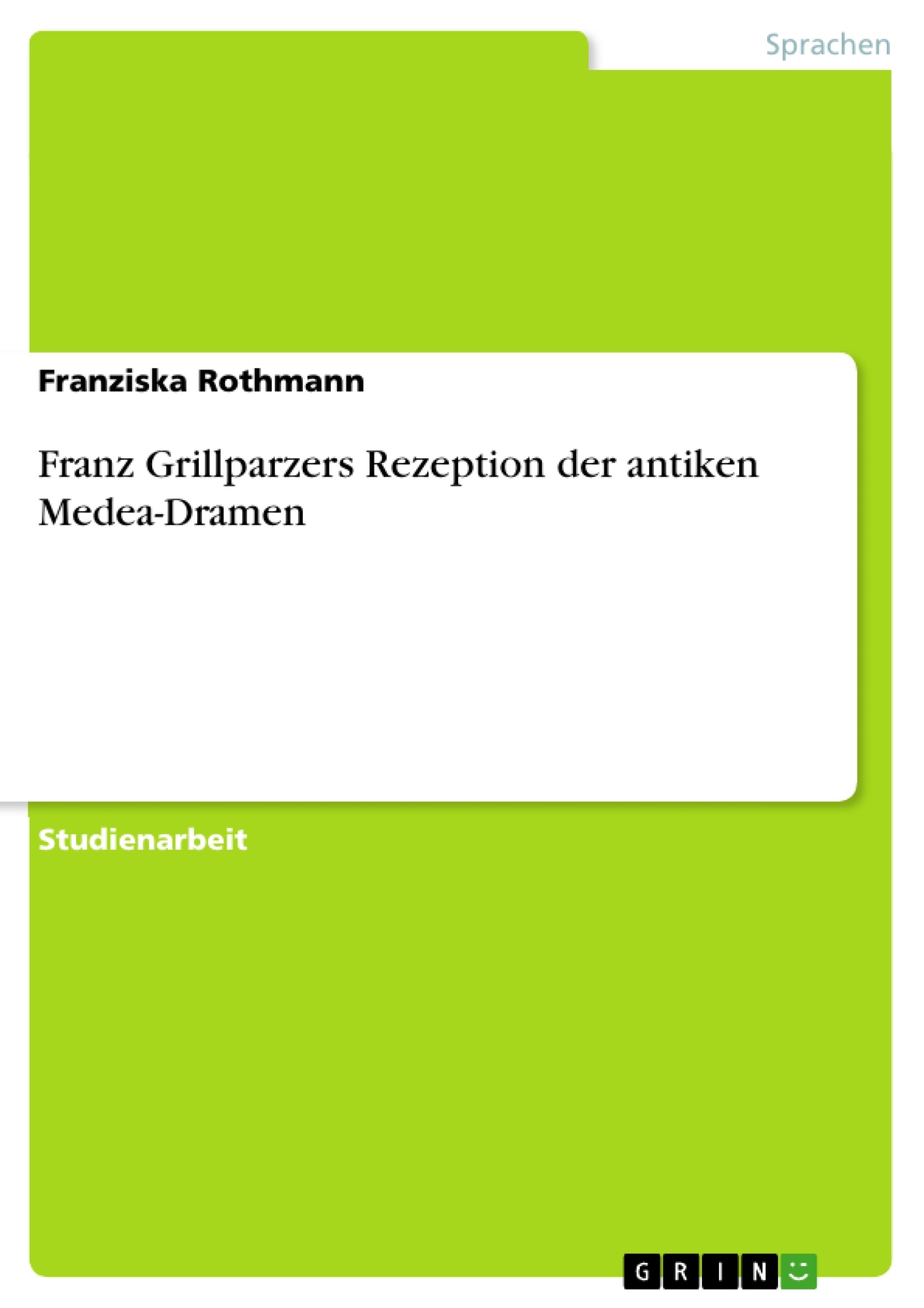Der Mythos Medea hat durch alle Jahrhunderte eine ausgeprägte Faszination auf die Autoren der jeweiligen Zeit ausgeübt. Als Teil eines umfassenderen Mythos, der Argonautensage, für die es ebenfalls viele unterschiedliche Quellen gibt, hat vor allem die Geschichte Medeas zu immer neuen Werken inspiriert. Daher findet sich kaum eine mythologische Figur so häufig in literarischen Bearbeitungen wieder. „Was speziell die Medea angeht, so hat die von Euripides geschaffene tragische Gestalt in zwei Jahrtausenden europäischer Bühnendichtung von Ovid und Seneca bis Grillparzer und Anouilh eine besonders reiche Fülle von Metamorphosen erlebt.“ Ausgehend von den antiken tatsächlich überlieferten Medea-Dramen, wie eben die Medea des Euripides und die des Seneca, zieht sich die literarische Entwicklung der Medea durch alle Epochen bis in die heutige Zeit. Dabei erlebte die Figur Medea und ihre Geschichte zahlreiche Wandlungen und Veränderungen, die sich teils auf die jeweilige Zeit bzw. die Epoche zurückführen lassen, teils aber auch von den Autoren beeinflusst wurden. Jedes Werk hat seinen eigenen literarischen Wert, steht als Exempel der Zeit, in der es entstanden ist und als Ausdruck der Intention seines Autors. Aspekte, die zu untersuchen eine spannende Aufgabe sein dürfte. Bei einem derartig oft rezipierten Mythos bietet jede Bearbeitung jedoch auch zugleich Untersuchungsmöglichkeiten in Bezug auf die Weiterentwicklung des Mythos. Welche Tendenzen können in den unterschiedlichen Bearbeitungen aufgezeigt werden, welche Veränderungen finden sich und wie können sie begründet werden. Dies soll wesentlicher Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit sein. Dabei werden zwei antike Medea-Bearbeitungen, die Medea-Dramen von Euripides und Seneca, und das Medea-Drama von Franz Grillparzer herangezogen. Zu beachten ist, dass es sich bei dem Trauerspiel des Wiener Autors um einen Teil einer Trilogie mit dem Titel „Das goldene Vließ“ handelt. Grillparzer hat – sich stützend auf unterschiedliche Quellen – die Vorgeschichte Medeas selbstständig verfasst. „Daß Grillparzer nicht nur eine Tragödie, sondern eine Trilogie geschrieben hat, ist das entscheidende Merkmal, das sein Werk von denen des Euripides, Seneca und Corneille unterscheidet.“
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Medea-Dramen – Euripides, Seneca, Grillparzer
- 2.1. Das „griechische“ Medea-Drama des Euripides
- 2.1.1. Der Autor und das Werk
- 2.1.2. Inhaltliche Zusammenfassung
- 2.2. Das „römische“ Medea-Drama von Seneca
- 2.2.1. Der Autor und das Werk
- 2.2.2. Inhaltliche Zusammenfassung
- 2.3. Das Medea-Drama von Grillparzer
- 2.3.1. Der Autor und das Werk
- 2.3.2. Inhaltliche Zusammenfassung
- 2.1. Das „griechische“ Medea-Drama des Euripides
- 3. Grillparzers Rezeption der antiken Medea-Dramen – Ein Vergleich ausgewählter Schwerpunkte
- 3.1. Vergleich der Personen in den Dramen
- 3.2. Vergleich der Dramenanfänge
- 3.3. Vergleich der Charakterisierung Medeas
- 3.3.1. Medeas Absage an die barbarischen Wurzeln
- 3.3.2. Medeas Rachepläne
- 3.3.3. Der Kindermord und das Ende des Dramas
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rezeption der antiken Medea-Dramen durch Franz Grillparzer. Das Hauptziel ist es, die Art und Weise zu analysieren, wie Grillparzer die Werke von Euripides und Seneca in seinem eigenen Medea-Drama verarbeitet hat. Dabei werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Bezug auf ausgewählte Schwerpunkte herausgearbeitet.
- Vergleich der Charakterisierung Medeas in den drei Dramen
- Analyse der Dramenanfänge und ihrer unterschiedlichen Gestaltung
- Untersuchung der Rachemotive und ihrer Darstellung
- Rezeption des Medea-Mythos über die Jahrhunderte
- Der Einfluss der jeweiligen Epoche auf die Darstellung Medeas
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Rezeption des Medea-Mythos ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Art und Weise, wie Franz Grillparzer die antiken Vorbilder Euripides und Seneca in seinem Medea-Drama rezipiert hat. Sie begründet die Auswahl der drei Dramen und skizziert den methodischen Ansatz des Vergleichs ausgewählter Schwerpunkte, wobei formale Aspekte bewusst ausgeklammert werden. Die Einleitung hebt die kontinuierliche Faszination des Medea-Mythos in der Literatur hervor und betont die Wandlungen und Veränderungen der Figur Medeas im Laufe der Zeit. Sie skizziert den Umfang der Arbeit und ihre methodischen Grenzen.
2. Die Medea-Dramen – Euripides, Seneca, Grillparzer: Dieses Kapitel bietet eine inhaltliche Zusammenfassung der Medea-Dramen von Euripides, Seneca und Grillparzer. Es beinhaltet kurze biografische Informationen der Autoren und skizziert den jeweiligen Kontext der Dramen. Die Zusammenfassungen konzentrieren sich auf die zentralen Handlungselemente und die Darstellung Medeas. Es werden die Unterschiede in der Darstellung des Mythos und der Charakterisierung der Hauptfigur hervorgehoben, um die Grundlage für den späteren Vergleich zu schaffen.
3. Grillparzers Rezeption der antiken Medea-Dramen – Ein Vergleich ausgewählter Schwerpunkte: Dieses Kapitel vergleicht ausgewählte Schwerpunkte der drei Dramen. Es beginnt mit einem Vergleich der Personenkonstellationen, geht dann auf die unterschiedlichen Dramenanfänge ein und analysiert schließlich die Charakterisierung Medeas in den drei Werken. Der Fokus liegt dabei auf Medeas Absage an ihre barbarischen Wurzeln, ihren Racheplänen und der Darstellung des Kindermords und des Dramas Ende. Der Vergleich soll die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Rezeption des Mythos aufzeigen und die Intention Grillparzers beleuchten.
Schlüsselwörter
Medea, Euripides, Seneca, Grillparzer, antike Dramen, Rezeption, Mythos, Tragödie, Rache, Kindermord, Charakterisierung, Vergleich, literarische Bearbeitung, griechische Literatur, römische Literatur, Wiener Klassik.
Häufig gestellte Fragen zu: Rezeption der antiken Medea-Dramen bei Grillparzer
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert die Rezeption der antiken Medea-Dramen von Euripides und Seneca durch Franz Grillparzer. Im Mittelpunkt steht ein Vergleich der drei Dramen hinsichtlich ausgewählter Aspekte, um Grillparzers Bearbeitung des Mythos zu beleuchten. Die Arbeit enthält eine Einleitung, Kapitel zur Zusammenfassung der drei Dramen, einen Vergleich ausgewählter Schwerpunkte und ein Fazit. Formale Aspekte werden bewusst ausgeklammert.
Welche Dramen werden verglichen?
Verglichen werden die Medea-Dramen von Euripides, Seneca und Franz Grillparzer. Die Arbeit untersucht, wie Grillparzer die Werke seiner antiken Vorbilder in seinem eigenen Drama verarbeitet und welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede bestehen.
Welche Aspekte der Dramen werden im Vergleich untersucht?
Der Vergleich konzentriert sich auf ausgewählte Schwerpunkte: die Charakterisierung Medeas (insbesondere ihre Abkehr von ihren barbarischen Wurzeln, ihre Rachepläne und die Darstellung des Kindermords), die Dramenanfänge und die Personenkonstellation in den drei Dramen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, drei Hauptkapitel und ein Fazit. Kapitel 2 bietet inhaltliche Zusammenfassungen der drei Dramen, inklusive kurzer biografischer Informationen der Autoren. Kapitel 3 vergleicht die ausgewählten Schwerpunkte der Dramen. Die Einleitung führt in das Thema ein und skizziert die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Art und Weise zu analysieren, wie Grillparzer die Werke von Euripides und Seneca in seinem eigenen Medea-Drama verarbeitet hat. Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Bezug auf ausgewählte Schwerpunkte werden herausgearbeitet, um Grillparzers Interpretation des Medea-Mythos zu verstehen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Medea, Euripides, Seneca, Grillparzer, antike Dramen, Rezeption, Mythos, Tragödie, Rache, Kindermord, Charakterisierung, Vergleich, literarische Bearbeitung, griechische Literatur, römische Literatur, Wiener Klassik.
Welche Informationen enthalten die Kapitelzusammenfassungen?
Die Kapitelzusammenfassungen geben einen Überblick über den Inhalt jedes Kapitels. Die Einleitung erläutert die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz. Kapitel 2 bietet eine inhaltliche Zusammenfassung der drei Dramen. Kapitel 3 beschreibt den detaillierten Vergleich der ausgewählten Schwerpunkte.
- Citar trabajo
- Franziska Rothmann (Autor), 2007, Franz Grillparzers Rezeption der antiken Medea-Dramen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120350