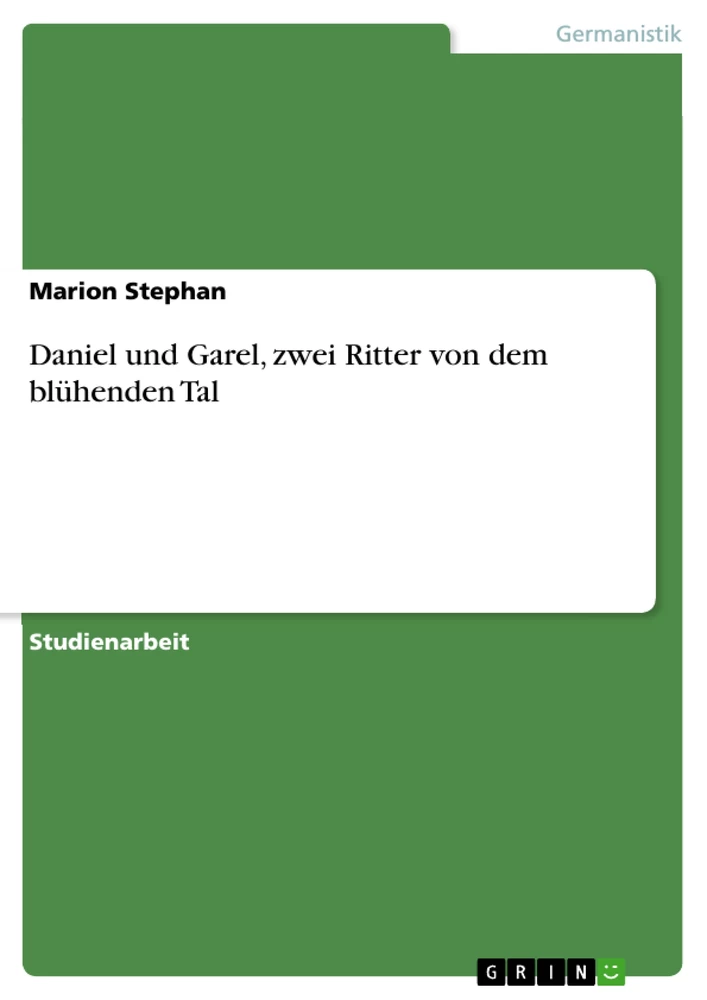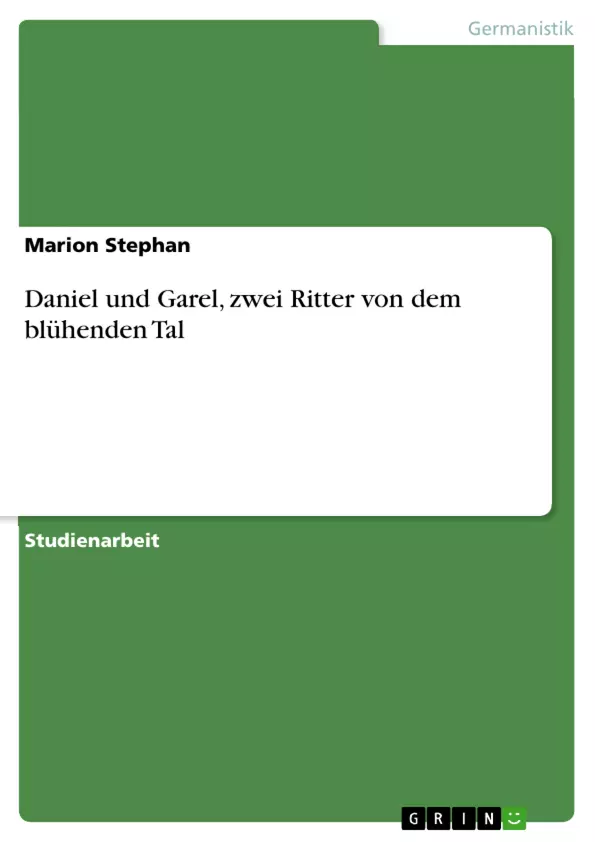Suchen wir in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts in der deutschen Literatur nach Artusromanen, so lassen sich relativ wenige Texte finden. Zwei davon sind Daniel von dem Blühenden Tal von dem Stricker und Garel von dem Blühenden Tal von dem Pleier. Mit diesen beiden Werken befasst sich folgende Arbeit.
Sowohl der Daniel als auch der Garel werden als nachklassische Artusromane bezeichnet, da sie sich von den klassischen Artusromanen in verschiedener Hinsicht unterscheiden.
Mit Hilfe von Forschungsergebnissen soll in der Arbeit untersucht werden, ob der Garel tatsächlich als ein Epos der Anspielung zu verstehen ist. Dazu werden einige Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Romanen durchleuchtet sowie Handlungen, die in beiden Werken parallel zu finden sind. Überdies wird der Protagonist jeweils genauer analysiert und auf sein Verhalten in dem Romangeschehen eingegangen.
Ein weiterer Schwerpunkt wird sein, die Rückbindung des Pleiers an den klassischen Artusroman nachzuvollziehen. Es wird erforscht, mit welchen Mitteln der Pleier versucht, seinen Roman wieder dem klassischen Vorbild anzunähern und sich so gegen Strickers Daniel wendet, der einige nicht gattungskonforme Elemente aufweist.
Überdies wird auf die Minne- und Heiratsproblematik in diesen Artusromanen eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Garel als ein Epos der Anspielung
- 2.1 Allgemeine Gemeinsamkeiten zwischen Daniel und Garel
- 2.2 Parallelhandlungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Beziehung zwischen Strickers "Daniel von dem Blühenden Tal" und Pleiers "Garel von dem Blühenden Tal", zwei nachklassischen Artusromanen. Die Zielsetzung besteht darin, die These von Garel als "Epos der Anspielung" auf den Daniel zu überprüfen. Dazu werden Gemeinsamkeiten, Parallelhandlungen und die Charaktere der Protagonisten analysiert.
- Vergleich der Handlungsstrukturen von "Daniel" und "Garel"
- Analyse der Parallelen in den Abenteuern (Aventüren) beider Romane
- Untersuchung der Rolle König Artus in beiden Werken
- Beurteilung des Einflusses des klassischen Artusromans auf "Garel"
- Analyse der "Minne" als Thema in beiden Romanen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der späten mittelhochdeutschen Artusromane ein und stellt "Daniel von dem Blühenden Tal" und "Garel von dem Blühenden Tal" als Forschungsgegenstand vor. Sie beleuchtet die Entstehungszeit und die Überlieferungsgeschichte beider Texte sowie die bisherige Forschung, welche die Romane als nachklassische Artusromane bezeichnet und verschiedene Interpretationsansätze vorstellt, darunter die Bedeutung von "List" und die Frage der Korrektur oder Anspielung des Daniels im Garel. Die Einleitung skizziert die Forschungsfragen der Arbeit, welche sich auf die Anspielungsfunktion des Garels und die Rückbindung an den klassischen Artusroman konzentrieren, inklusive der Rolle der Minne und Heiratspolitik.
2. Der Garel als ein Epos der Anspielung: Dieses Kapitel untersucht die These, dass Pleiers "Garel" als Anspielung auf Strickers "Daniel" zu verstehen ist. Es beginnt mit einer Analyse der allgemeinen Gemeinsamkeiten beider Romane, wie der Struktur der Handlung, der Kriegsausrufung durch einen Boten, der Reise der Protagonisten, den überstandenen Aventüren, der Überwindung des gegnerischen Heeres und der finalen Versöhnung. Die Kapitel analysiert die Makrostruktur der Romane und argumentiert, dass die formale Zweiteilung in beiden Romanen keine echte Entwicklung des Helden widerspiegelt, im Gegensatz zum klassischen Artusroman. Die Rolle des König Artus in beiden Werken wird ebenfalls verglichen. Abschließend werden ausgewählte Parallelhandlungen in den Aventüren detailliert untersucht, beispielsweise der Vergleich zwischen den Aventüren mit Juran und Gerhart sowie der Begegnung mit Ungeheuern, die jeweils ein Medusenhaupt tragen und durch die Protagonisten besiegt werden. Der detaillierte Vergleich der Textpassagen untermauert die These der Anspielung.
Schlüsselwörter
Artusroman, mittelhochdeutsch, Stricker, Pleier, Daniel von dem Blühenden Tal, Garel von dem Blühenden Tal, nachklassischer Artusroman, Anspielung, Parallelhandlung, Minne, Aventiure, König Artus, Handlungsanalyse, Makrostruktur, literarische Tradition.
Häufig gestellte Fragen zu "Garel von dem Blühenden Tal" und "Daniel von dem Blühenden Tal"
Welche Romane werden in dieser Arbeit verglichen?
Die Arbeit vergleicht die spätmittelhochdeutschen Artusromane "Daniel von dem Blühenden Tal" (Stricker) und "Garel von dem Blühenden Tal" (Pleier).
Was ist die zentrale These der Arbeit?
Die zentrale These ist, dass "Garel von dem Blühenden Tal" als "Epos der Anspielung" auf "Daniel von dem Blühenden Tal" zu verstehen ist.
Welche Aspekte der Romane werden verglichen?
Verglichen werden die Handlungsstrukturen, Parallelhandlungen in den Abenteuern (Aventüren), die Rolle König Artus, der Einfluss des klassischen Artusromans, und das Thema "Minne" in beiden Romanen. Die Arbeit analysiert auch die Makrostruktur und Gemeinsamkeiten wie die Kriegsausrufung, die Reisen der Protagonisten und die finale Versöhnung.
Wie wird die These der Anspielung belegt?
Die These wird durch den Vergleich der allgemeinen Gemeinsamkeiten beider Romane, detaillierte Analysen von ausgewählten Parallelhandlungen in den Aventüren (z.B. die Abenteuer mit Juran und Gerhart, die Begegnung mit Ungeheuern) und den Vergleich der Textpassagen belegt.
Welche Rolle spielt König Artus in beiden Romanen?
Die Arbeit vergleicht die Rolle König Artus in beiden Werken und untersucht, wie sein Einfluss den Verlauf der Handlung prägt.
Wie wird die "Minne" in der Analyse berücksichtigt?
Die Arbeit untersucht das Thema "Minne" als wichtigen Aspekt in beiden Romanen und analysiert dessen Bedeutung im Kontext der Handlung und der Charaktere.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit enthält eine Einleitung, ein Hauptkapitel ("Der Garel als ein Epos der Anspielung"), welches die These der Anspielung vertieft, und eine Zusammenfassung der Ergebnisse. Das Kapitel über den Garel als Anspielung analysiert die Makrostruktur der Romane und vergleicht detailliert ausgewählte Parallelhandlungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Artusroman, mittelhochdeutsch, Stricker, Pleier, Daniel von dem Blühenden Tal, Garel von dem Blühenden Tal, nachklassischer Artusroman, Anspielung, Parallelhandlung, Minne, Aventiure, König Artus, Handlungsanalyse, Makrostruktur, literarische Tradition.
Welche Forschungsfragen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Anspielungsfunktion des Garels, die Rückbindung an den klassischen Artusroman, die Rolle der Minne und die Heiratspolitik in den Romanen.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke bestimmt und dient der Analyse von Themen in einer strukturierten und professionellen Art und Weise.
- Quote paper
- Marion Stephan (Author), 2007, Daniel und Garel, zwei Ritter von dem blühenden Tal, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120388