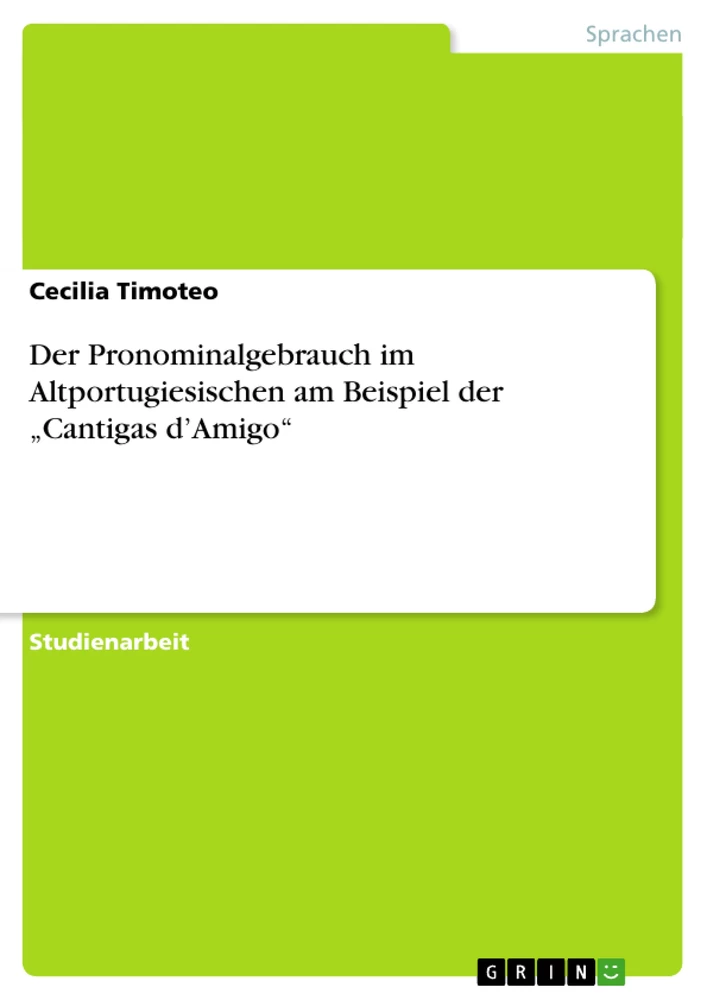Sowohl in Bezug auf Personalpronomen als auch auf Possessivpronomen hat das Portugiesische einen linguistischen Wandel vollzogen. Dieser Wandel betrifft hauptsächlich die Stellungsvarianten von Objektpronomen. Darüber hinaus gibt es auch einen Wandel im Gebrauch von Possessiva. Während im 13. Jahrhundert Possessiva normalerweise ohne Artikel verwendet werden, kommen sie im aktuellen europäischen Sprachgebrauch systematisch mit Artikeln vor. Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist es, den Pronominalgebrauch im Altportugiesischen zu analysieren. Als Basis für die Untersuchung dienen die Cantigas d´Amigo, die zwischen 1220 und 1350 verfasst wurden und zu den ältesten poetischen Texten des Portugiesischen bzw. Galego-Portugiesischen zählen. Als Quelle dienen hier Rip Cohens „500 cantigas d'amigo”.
In Anbetracht der Tatsache, dass es keine einheitliche und klare Periodisierung des Altportugiesischen gibt, werden zunächst die bis heute bestehenden Periodisierungsansätze kurz dargestellt. Dies wird lediglich in Bezug auf das Altportugiesische thematisiert. Die bestehende Problematik in Bezug auf das Portugiesische nach dem 16. Jahrhundert beispielsweise wird im Rahmen dieser Arbeit nicht berücksichtigt.
Vor dem Hintergrund des Pronominalgebrauchs im Altportugiesischen wird auch der Pronominalgebrauch im modernen Portugiesisch thematisiert, um so zum einen den aktuellen Stand zu zeigen und zum anderen eine Gegenüberstellung zum Pronominalgebrauch im Altportugiesischen zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang wird auch die brasilianische Variante thematisiert, da es gerade im Pronominalgebrauch große Unterschiede zum europäischen Portugiesisch gibt.
Den Hauptteil der vorliegenden Arbeit bildet die Untersuchung des Textkorpus. Es erfolgt eine quantitative Untersuchung der jeweiligen Pronomina, die sowohl morphologische als auch syntaktische Aspekte – vor allem im Vergleich zum heutigen Pronominalgebrauch – berücksichtigt. Die Detailanalyse der Personalpronomen konzentriert sich vor allem auf die vorhandene oder nicht vorhandene Markierung der Verbalperson durch die Subjektpronomen und auf die Stellung der unbetonten bzw. klitischen Objektpronomen, da es in diesem Bereich große Abweichungen zum modernen Portugiesisch gibt. In diesem Zusammenhang werden die proklitische, die enklitische und auch die mesoklitische Stellung thematisiert. Die Possessivpronomen werden vor allem hinsichtlich der Verwendung mit dem bestimmten Artikel als Determinant untersucht.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Altportugiesisch – Periodisierung und sprachliche Zeugnisse
2.1 Periodisierung
2.2 Erste schriftliche Zeugnisse
3 Pronominalgebrauch im modernen Portugiesisch
3.1 Personalpronomen
3.1.1 Subjektpronomen
3.1.2 Objektpronomen
3.2 Possessivpronomen
4 Methodik der Datenanalyse
5 Korpusanalyse
5.1 Personalpronomen im Altportugiesischen
5.1.1 Subjektpronomen
5.1.1.1 Markierung der Verbalpersonen
5.1.2 Objektpronomen
5.1.2.1 Stellungsvarianten
5.2 Possessivpronomen im Altportugiesischen
5.2.1 Verwendung mit Determinanten
6 Schlußwort
7 Bibliographie
7.1 Quellen
7.2 Sekundärliteratur
7.3 Nachschlagewerke
Verzeichnis der Tabellen und Abbildungen
Tabelle 1: Periodisierung des Altportugiesischen
Tabelle 2: Subjektpronomen im modernen Portugiesisch
Tabelle 3: Objektpronomen im modernen Portugiesisch
Tabelle 4: Possessivpronomen im modernen Portugiesisch
Tabelle 5: Quantitative Ergebnisse Subjektpronomen
Tabelle 6: Quantitative Ergebnisse Markierung der Verbalpersonen
Tabelle 7: Quantitative Ergebnisse Objektpronomen
Tabelle 8: Quantitative Ergebnisse Possessivpronomen
Abbildung 1: Markierung der Verbalpersonen
Abbildung 2: Stellungsvarianten der Objektpronomen
Abbildung 3: Stellung der Objektpronomen im Vergleich zu Heute
Abbildung 4: Prokliseauslösende Elemente
Abbildung 5: Setzung des Artikels bei Possessiva
1 Einleitung
Sowohl in Bezug auf Personalpronomen als auch auf Possessivpronomen hat das Portugiesische einen linguistischen Wandel vollzogen.
„Falemos, ainda, de uma mudança linguística que percorre a história do Português: a colocação dos pronomes átonos ou clíticos“[1]
Dieser Wandel betrifft, wie Esperança Cardeira feststellt, hauptsächlich die Stellungsvarianten von Objektpronomen. Darüber hinaus gibt es auch einen Wandel im Gebrauch von Possessiva. Während im 13. Jahrhundert Possessiva normalerweise ohne Artikel verwendet werden, kommen sie im aktuellen europäischen Sprachgebrauch systematisch mit Artikeln vor.[2] Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist es, den Pronominalgebrauch im Altportugiesischen zu analysieren. Als Basis für die Untersuchung dienen die Cantigas d´Amigo, die zwischen 1220 und 1350 verfasst wurden und zu den ältesten poetischen Texten des Portugiesischen bzw. Galego-Portugiesischen zählen.[3] Als Quelle dienen hier Rip Cohens „ 500 cantigas d'amigo”.
In Anbetracht der Tatsache, dass es keine einheitliche und klare Periodisierung des Altportugiesischen gibt, werden zunächst die bis heute bestehenden Periodisierungsansätze kurz dargestellt. Dies wird lediglich in Bezug auf das Altportugiesische thematisiert. Die bestehende Problematik in Bezug auf das Portugiesische nach dem 16. Jahrhundert beispielsweise wird im Rahmen dieser Arbeit nicht berücksichtigt.[4]
Vor dem Hintergrund des Pronominalgebrauchs im Altportugiesischen wird auch der Pronominalgebrauch im modernen Portugiesisch thematisiert, um so zum einen den aktuellen Stand zu zeigen und zum anderen eine Gegenüberstellung zum Pronominalgebrauch im Altportugiesischen zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang wird auch die brasilianische Variante thematisiert, da es gerade im Pronominalgebrauch große Unterschiede zum europäischen Portugiesisch gibt.[5]
Den Hauptteil der vorliegenden Arbeit bildet die Untersuchung des Textkorpus. Es erfolgt eine quantitative Untersuchung der jeweiligen Pronomina, die sowohl morphologische als auch syntaktische Aspekte – vor allem im Vergleich zum heutigen Pronominalgebrauch – berücksichtigt. Die Detailanalyse der Personalpronomen konzentriert sich vor allem auf die vorhandene oder nicht vorhandene Markierung der Verbalperson durch die Subjektpronomen und auf die Stellung der unbetonten bzw. klitischen Objektpronomen, da es in diesem Bereich große Abweichungen zum modernen Portugiesisch gibt. In diesem Zusammenhang werden die proklitische, die enklitische und auch die mesoklitische Stellung thematisiert. Die Possessivpronomen werden vor allem hinsichtlich der Verwendung mit dem bestimmten Artikel als Determinant untersucht.
Obwohl es keine Grammatik des Altportugiesischen gibt[6], so existieren viele historische Grammatiken und empirische Untersuchungen, die detaillierte Informationen zum Altportugiesischen bieten und daher die Grundlage dieser Arbeit bilden. Darunter sind besonders erwähnenswert: „ Estruturas trecentistas: elementos para uma gramática do português arcaico.“ vonRosa Virgínia Mattos e Silva, „Syntaxe histórica portuguesa“ von Augusto Epiphanio da Silva Dias, „Altportugiesisches Elementarbuch.“ von Joseph Huber, „Compêndio de Gramática Histórica Portuguesa. Fonética e Morfologia.“ vonJosé Joaquim Nunes und „ Gramática Histórica“ von Ismael de Lima Coutinho. Detaillierte Angaben zum heutigen Pronominalgebrauch finden sich in der „Nova Gramática do Português Contemporâneo” von Celso Cunha und Lindley Cintra und in Eberhard Gärtners „Grammatik der portugiesischen Sprache“. Die Aufsätze von Esperança Cardeira und Clarinda de Azevedo Maia beinhalten sowohl einen Überblick über die bisherigen Periodisierungsversuche als auch über die momentane Lage.
2 Altportugiesisch – Periodisierung und sprachliche Zeugnisse
2.1 Periodisierung
Die Frage der Periodisierung sowohl des Portugiesischen insgesamt als auch des Altportugiesischen ist bis zum heutigen Zeitpunkt nicht einheitlich geklärt und beantwortet.[7] Lediglich in Bezug auf den Beginn des Altportugiesischen gibt es einen Konsens:
“Se, relativamente ao «início» da história da língua portuguesa, os filólogos e historiadores são unânimes em situá-lo nos princípios do século XIII, pelo facto de só então se ter verificado a «passagem à escrita» da língua do Noroeste hispânico, remontando, portanto, a essa época o início da tradição escrita em galego-português [...]”[8]
Wie Clarinda de Azevedo Maia feststellt, sind sich die Philologen vor allem deshalb über den Beginn des Altportugiesischen sicher, weil im 13. Jahrhundert die Verschriftlichung der Sprache faktisch festzustellen ist. Was das Ende der altportugiesischen Phase, eine mögliche Untergliederung oder gar die Bezeichnung der einzelnen Phasen betrifft, so gibt es unterschiedliche Ansätze. Das Ende der altportugiesischen Phase „é uma questão em aberto“[9]. Je nach Definition reicht das Altportugiesische bis zum Jahr 1350, bis zum 15. oder sogar bis zum 16. Jahrhundert.[10]
Tabelle 1: Periodisierung des Altportugiesischen[11]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Ebenfalls uneinheitlich ist die Untergliederung des Altportugiesischen in zwei unterschiedliche Entwicklungsphasen:
“Também se discute, e é uma questão já antiga, a subperiodização do português arcaico.”[12]
Während bei Vasconcelos und Messner das Altportugiesische eine einzige Phase bildet, wird es bei Silva Neto, Vásquez Cuesta/Luz, Mattos e Silva und Da Silva in zwei Subgruppen unterteilt.[13] Die erste Phase ist durch die sprachliche Einheit des Galego-Portugiesischen gekennzeichnet und wird als trovadoresco [14], galego- português [15], português antigo [16] oder português arcaico [17] bezeichnet.[18] Die zweite Phase des Altportugiesischen – eine „fase nitidamente portuguesa“[19] – wird durch die Trennung der galizisch-portugiesischen Spracheinheit im politischen und sozialen Sinn gerechtfertigt und wird als português comum bzw. português arcaico [20], português pré-clássico [21] oder português médio [22] bezeichnet.[23] Hierbei ist festzuhalten, dass, wie in diesem Fall, oft nicht linguistische, sondern hauptsächlich historische Faktoren die Periodisierung des Portugiesischen beeinflussen:
“Ponhamos em evidência que estas classificações se baseiam em factos de carácter extralinguístico, nomeadamente acontecimentos de carácter histórico. [...]”[24]
So kennzeichnet beispielsweise das Jahr 1354 mit dem Tod von D. Pedro, Conde de Barcelos, dem letzten und größten Vertreter der poesia trovadoresca, den Niedergang der galego-portugiesischen Trobadourlyrik und damit auch das Ende der ersten Phase, für die die poesia trovadoresca charakteristisch ist.[25] Ein weiteres historisches Kriterium, das den Beginn einer zweiten rein portugiesischen Phase rechtfertigt, ist die Tatsache, dass sich der politische Schwerpunkt des Landes vom nördlichen Guimarães, dem ehemaligen Sitz des Königs, ins mozarabische Lissabon verlagerte.[26] Lissabon vereinigte ab diesem Zeitpunkt „o prestígio da Corte e da Universidade“[27] und übte damit eine normierende Kraft auf die Sprache aus.[28] Nachdem die Grenzen des neuen portugiesischen Reiches endgültig definiert waren, gingen das Portugiesische und das Galizische getrennte Wege.[29] Ab dem 14. Jahrhundert setzt die Differenzierung des Galizischen und des Portugiesischen ein. Dies wird auch daran deutlich, dass das Galizische zwischen 1350 und 1450 eine „segunda floração lírica“ erlebt hat, an der die Portugiesen nicht mehr teilgenommen haben.[30]
2.2 Erste schriftliche Zeugnisse
Die ersten belegten schriftlichen Dokumente des Portugiesischen bzw. des Altportugiesischen können in drei Gruppen unterteilt werden. Zum einen gibt es Urkunden juristischen Ursprungs – dabei handelt es sich beispielsweise um Testamente, Schenkungen oder Verkaufsurkunden.[31] Des weiteren gibt es poetische Texte aus der galego-portugiesischen höfischen Liedkunst, die sich parallel zu den juristischen Dokumenten entwickelt haben.[32] Die dritte Gruppe setzt sich aus literarischen Prosatexten zusammen, die jedoch erst Mitte des 13. Jahrhunderts erschienen.[33]
Nach heutigem Kenntnisstand sind die Notícia de torto (1210-1214) und das Testamento Afonso II (1214) die ältesten Dokumente mit einer “eindeutigen und durchgängigen portugiesischen Struktur.”[34] Lange Zeit galten aber der Auto de partilha, der auf das jahr 1192 datiert wurde, und der Testamento de Elvira Sanches (1193)[35] als die ältesten sprachlichen Zeugnisse. Eine genauere Analyse ergab aber, dass es sich dabei lediglich um nachträgliche Übersetzungen von lateinischen Originalen handelt.[36]
“[...] aqueles antes considerados os mais antigos [...] não são, respectivamente, de 1192 e 1193, mas ambos dos fins do século XIII, sendo sim, os seus originais em latim, dos fins do século XII.”[37]
In der letzten Dekade wurden allerdings zwei weitere Texte gefunden, die noch früher datiert werden können: die Notícia de fiadores, die auf das Jahr 1175 datiert wird und der Pacto de Gomes Pais e Ramiro Pais, der zwischen 1169 und 1173 zeitlich eingeordnet wird.[38] Beide Dokumente orientieren sich aber noch stark an der lateinischen Diskurstradition und weisen, obwohl schon eindeutige portugiesische Merkmale auftreten, große sprachliche Unterschiede zu der Notícia de torto, die 40 Jahre jünger ist. Bei diesen Dokumenten kann man also von einer Zwischenstufe in der Übergangsphase vom Latein zum Portugiesischen ausgehen.[39]
Parallel zu den eben aufgeführten Urkunden juristischer Natur entwickelte sich Ende des 12. bzw. Anfang des 13. Jahrhunderts eine höfische Liedkunst.[40] Diese umfasst die Cantigas de Santa Maria und drei Cancioneiros profanos. Zu den Cancioneiros profanos gehören: der Cancioneiro de Ajuda, der Cancioneiro da Vaticana und der Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa. Diese Gedichtsammlungen gehen auf verlorene Manuskripte zurück, von dem aber Kopien existieren.[41] Der Cancioneiro da Ajuda ist die älteste der Gedicht-sammlungen und wurde Ende des 13. bzw. Anfang des 14. Jahrhunderts kopiert. Die beiden anderen Cancioneiros wurden erst später in Italien kopiert – wahrscheinlich Anfang des 16. Jahrhunderts.[42] Die Cancioneiros umfassen insgesamt mehr als 1679 Gedichte und enthalten drei Arten von Gedichten: die Cantigas de Escarnho e Maldizer, die Cantigas d´Amor und die Cantigas d´Amigo.[43]
3 Pronominalgebrauch im modernen Portugiesisch
Nach Bußmann ist ein Pronomen [lat. prō nōmen ] ein Anzeigewort, Fürwort oder Stellvertreter – es ist also eine Wortart, die nach ihrer Funktion benannt ist und für ein Nomen steht. Allen Pronomen ist die Funktion des Verweisens zueigen. Es werden mehrere Untergruppen unterschieden, wie zum Beispiel die Personal-, Possessiv-, Demonstrativ- und Indefinitpronomen.[44]
Vor dem Hintergrund der Untersuchung des Pronominalgebrauchs im Altportugiesischen wird im folgenden Kapitel der Pronominalgebrauch im modernen Portugiesisch thematisiert. Es werden hierbei sowohl Personalpronomen als auch Possessivpronomen dargestellt. Ebenfalls berücksichtigt wird die brasilianische Variante, die sich vor allem im Pronominalgebrauch vom europäischen Portugiesisch unterscheidet:
“Ein Vergleich der brasilianischen mit der europäischen Norm des Portugiesischen verdeutlicht, daß gerade der Pronominalbereich erhebliche Abweichungen aufweist.”[45]
[...]
[1] Vgl. Cardeira, Esperança (2006), O essencial sobre a história do português Lisboa, S. 55.
[2] Vgl. Rinke, Esther; Kupisch, Tanja (1999), Italienische und portugiesische Possessivpro-nomina im diachronischen Vergleich: Determinanten oder Adjektive? Hamburg, S. 19.
[3] Vgl. Cohen, Rip (2003), 500 cantigas d'amigo. Porto, S. 53.
[4] Vgl. Maia, Clarinda de Azevedo (1999), „Periodização na história da lingua portuguesa: status quaestionis e perspectivas de investigação futura” in: Estudos de história da língua portuguesa. Frankfurt am Main, S. 32.
[5] Vgl. Petruck, Christoph (1989), Sprachregister und Pronominalgebrauch im Portugiesischen. Münster, S. 5.
[6] Vgl. Mattos e Silva, Rosa Virgínia (1993), O português arcaico: Fonologia. São Paulo, S. 16
[7] Vgl. Endruschat, Annette; Schmidt-Radefeldt, Jürgen (2006), Einführung in die portugiesische Sprachwissenschaft. Tübingen, S. 25.
[8] Vgl. Maia, Clarinda de Azevedo (1999), „Periodização na história da lingua portuguesa: status quaestionis e perspectivas de investigação futura” in: Estudos de história da língua portuguesa. Frankfurt am Main, S. 28.
[9] Vgl. Mattos e Silva, Rosa Virgínia (1993), O português arcaico: Fonologia. São Paulo, S. 16.
[10] Vgl. Endruschat, Annette; Schmidt-Radefeldt, Jürgen (2006), Einführung in die portugiesische Sprachwissenschaft. Tübingen, S. 25.
[11] Vgl. Mattos e Silva, Rosa Virgínia (1993) , O português arcaico: Fonologia. São Paulo, S. 19.
[12] Vgl. Mattos e Silva, Rosa Virgínia (1993), O português arcaico: Fonologia. São Paulo, S. 17.
[13] Vgl. Endruschat, Annette; Schmidt-Radefeldt, Jürgen (2006), Einführung in die portugiesische Sprachwissenschaft. Tübingen, S. 25.
[14] Silva Neto
[15] Vásquez Cuesta / Luz
[16] Mattos e Silva und Lindley Cintra
[17] Da Silva
[18] Vgl. Maia, Clarinda de Azevedo (1999), „Periodização na história da lingua portuguesa: status quaestionis e perspectivas de investigação futura” in: Estudos de história da língua portuguesa. Frankfurt am Main, S. 30.
[19] Vgl. ebd., S. 31.
[20] Silva Neto
[21] Vásquez Custa / Luz
[22] Lindley Cintra, Mattos e Silva und Da Silva
[23] Vgl. Maia, Clarinda de Azevedo (1999), „Periodização na história da lingua portuguesa: status quaestionis e perspectivas de investigação futura” in: Estudos de história da língua portuguesa. Frankfurt am Main, S. 30.
[24] Vgl. ebd., S. 30.
[25] Vgl. Endruschat, Annette; Schmidt-Radefeldt, Jürgen (2006), Einführung in die portugiesische Sprachwissenschaft. Tübingen, S. 25.
[26] Vgl. Teyssier, Paul (1993), História da Língua Portuguesa. Lisboa, S. 21.
[27] Vgl. Silva Neto, Serafim da (1979 ), História da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro, S. 398.
[28] Vgl. ebd., S. 398.
[29] Vgl. Mattos e Silva, Rosa Virgínia (1993), O português arcaico: Fonologia. São Paulo, S. 19.
[30] Vgl. Teyssier, Paul (1993), História da Língua Portuguesa. Lisboa, S. 39.
[31] Vgl. Mattos e Silva, Rosa Virgínia (1993), O português arcaico: Fonologia. São Paulo, S. 30ff.
[32] Vgl. Endruschat, Annette; Schmidt-Radefeldt, Jürgen (2006), Einführung in die portugiesische Sprachwissenschaft. Tübingen, S. 46.
[33] Vgl. Teyssier, Paul (1993), História da Língua Portuguesa. Lisboa, S. 23f.
[34] Vgl. Endruschat, Annette; Schmidt-Radefeldt, Jürgen (2006), Einführung in die portugiesische Sprachwissenschaft. Tübingen, S. 43.
[35] Vgl. Mattos e Silva, Rosa Virgínia (1993), O português arcaico: Fonologia. São Paulo, S. 33.
[36] Vgl. Endruschat, Annette; Schmidt-Radefeldt, Jürgen (2006), Einführung in die portugiesische Sprachwissenschaft. Tübingen, S. 43.
[37] Vgl. Mattos e Silva, Rosa Virgínia (1993), O português arcaico: Fonologia. São Paulo, S. 16.
[38] Vgl. Endruschat, Annette; Schmidt-Radefeldt, Jürgen (2006), Einführung in die portugiesische Sprachwissenschaft. Tübingen, S. 45.
[39] Vgl. ebd., S. 46.
[40] Vgl. ebd., S. 46.
[41] Vgl. Cohen, Rip (2003), 500 cantigas d'amigo. Porto, S. 53.
[42] Vgl. Teyssier, Paul (1993), História da Língua Portuguesa. Lisboa, S. 22.
[43] Vgl. Mattos e Silva, Rosa Virgínia (1993), O português arcaico: Fonologia. São Paulo, 30f.
[44] Vgl. Bußmann, Hadumod (1990), Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart, S. 615.
[45] Vgl. Petruck, Christoph (1989), Sprachregister und Pronominalgebrauch im Portugiesischen. Münster, S. 5.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die "Cantigas d’Amigo"?
Es sind lyrische Gedichte aus dem 13. und 14. Jahrhundert, die zu den ältesten schriftlichen Zeugnissen des Portugiesischen (Galego-Portugiesisch) zählen.
Wie unterscheidet sich der Pronominalgebrauch im Altportugiesischen von heute?
Ein Hauptunterschied liegt in der Stellung der Objektpronomen (Klitika) und dem häufigen Fehlen von Artikeln vor Possessivpronomen.
Wann begann die schriftliche Tradition des Portugiesischen?
Die Verschriftlichung im Nordwesten der Iberischen Halbinsel wird allgemein auf den Beginn des 13. Jahrhunderts datiert.
Was bedeutet Proklise und Enklise?
Proklise ist die Stellung des Pronomens vor dem Verb, Enklise die Stellung nach dem Verb. Die Regeln hierfür haben sich historisch stark gewandelt.
Warum gibt es Unterschiede zum brasilianischen Portugiesisch?
Das brasilianische Portugiesisch hat eine eigenständige Entwicklung im Pronominalgebrauch vollzogen, die oft stärker vom europäischen Standard abweicht.
- Citar trabajo
- Cecilia Timoteo (Autor), 2007, Der Pronominalgebrauch im Altportugiesischen am Beispiel der „Cantigas d’Amigo“, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120405