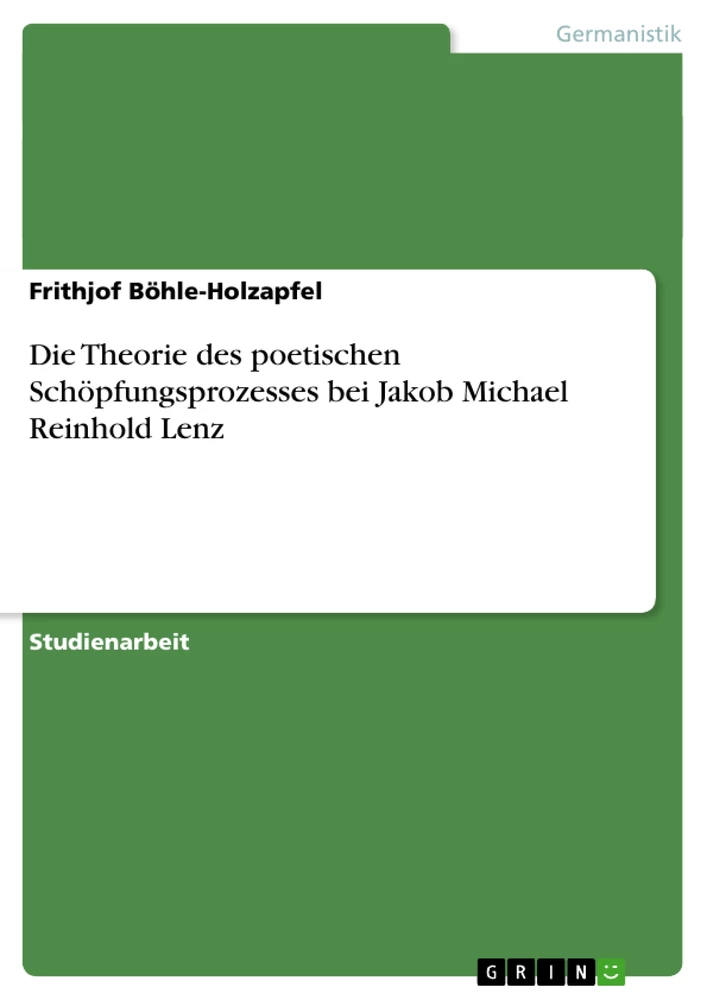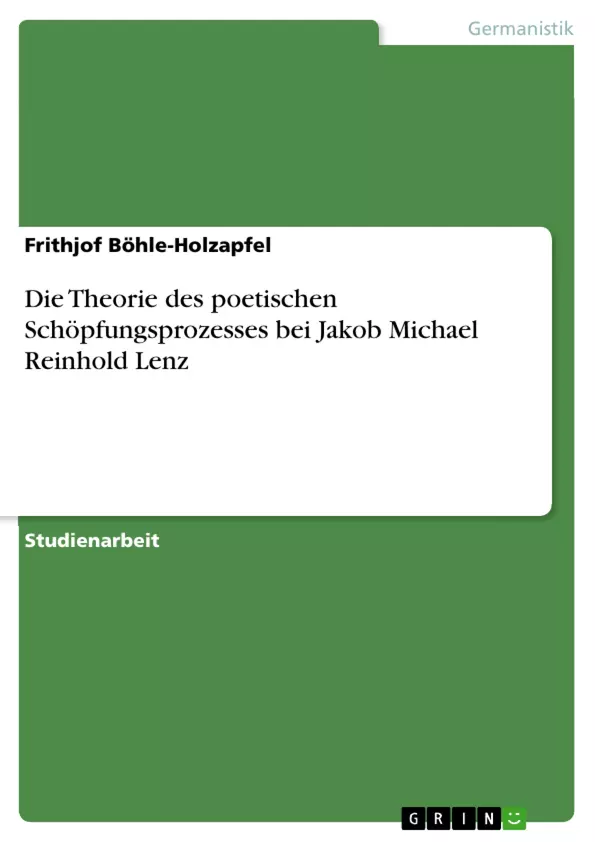Sowohl im Hinblick auf den poetischen Schaffensprozeß als auch in der Ausarbeitung dramentheoretischer Neuansätze entwickelt Jakob Michael Reinhold Lenz zwischen 1770 und 1780 Gedanken, deren zentraler Gehalt, sc. die Forderung nach konsequentem Werkrealismus, einerseits einen markanten Gegensatz zu den etablierten Dichtungswerten des "belle nature" - Klassizismus bildet, auf der anderen Seite aber bereits den sozial ambitionierten poetischen Realismus Georg Büchners antizipiert. Dabei agiert J.M.R. Lenz im eigentümlichen Spannungsfeld von noch immer präsentem Klassizismus und dem "phantastischem Taumel" (H. Hettner) der antiklassizistisch motivierten Sturm- und Drangperiode.
Insofern wird sich die vorliegende Arbeit notwendigerweise an diesen epochenimmanenten Implikationen orientieren. Nach den einleitenden Bemerkungen zur Shakespeare-Rezeption und der Emanzipation der Sinnlichkeit im 18. Jahrhundert wird die Diskussion des poetischen Schöpfungsvorgangs mit der Analyse des Körper- und Seelenbegriffs bei Lenz eröffnet. Es wird gezeigt, dass seine Dichtungstheorie durch die definitorischen Vorgaben des Körper- und Seelenbegriffs bedingt ist.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkung
- Einleitung: Shakespeare-Rezeption und Emanzipation der Sinnlichkeit im 18. Jahrhundert
- Lenzens Körper- und Seelenbegriff
- Die Sukzession der Erkenntnis
- Der poetische Schöpfungsprozess
- I. Nachahmung als Nachhandlung
- II. Das poetische Genie und seine Schöpfung
- Dramenimmanente Konsequenzen: Der individuelle Charakter
- Ausblick: Wirkungsästhetische Konsequenzen im Verhältnis Dichter und Publikum
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Jakob Michael Reinhold Lenzens Theorie des poetischen Schöpfungsprozesses im Kontext des 18. Jahrhunderts. Sie beleuchtet die Spannungen zwischen Klassizismus und Sturm und Drang und analysiert, wie Lenzens Werk diese Epoche widerspiegelt.
- Lenzens Rezeption Shakespeares
- Die Rolle der Sinnlichkeit in Lenzens Erkenntnistheorie
- Lenzens Körper- und Seelenbegriff und dessen Einfluss auf seine Dichtungstheorie
- Der poetische Schöpfungsprozess bei Lenz: Nachahmung und Genie
- Wirkungsästhetik bei Lenz und das Verhältnis von Dichter und Publikum
Zusammenfassung der Kapitel
Die Vorbemerkung skizziert Lenzens Beitrag zum Werkrealismus und seine Stellung im Spannungsfeld von Klassizismus und Sturm und Drang. Die Einleitung behandelt die Shakespeare-Rezeption und die Emanzipation der Sinnlichkeit im 18. Jahrhundert als wichtige kontextuelle Faktoren. Das Kapitel zu Lenzens Körper- und Seelenbegriff legt die philosophischen Grundlagen seiner Dichtungstheorie dar. Die Kapitel zum poetischen Schöpfungsprozess analysieren Nachahmung und die Rolle des poetischen Genies. Das Kapitel über die dramenimmanenten Konsequenzen fokussiert auf die Darstellung des individuellen Charakters.
Schlüsselwörter
Jakob Michael Reinhold Lenz, poetischer Schöpfungsprozess, Sturm und Drang, Klassizismus, Shakespeare-Rezeption, Sinnlichkeit, Erkenntnistheorie, Körper- und Seelenbegriff, Werkrealismus, Wirkungsästhetik, individueller Charakter.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht J.M.R. Lenz unter „konsequentem Werkrealismus“?
Lenz fordert eine Dichtung, die sich gegen den idealisierenden Klassizismus („belle nature“) stellt und stattdessen die Realität ungeschönt und sozial ambitioniert darstellt.
In welchem literarischen Spannungsfeld bewegte sich Lenz?
Er agierte zwischen dem etablierten Klassizismus und dem „phantastischen Taumel“ der antiklassizistisch motivierten Sturm- und Drang-Periode.
Welchen Einfluss hatte die Shakespeare-Rezeption auf Lenz?
Die Rezeption Shakespeares war zentral für die Emanzipation der Sinnlichkeit im 18. Jahrhundert und beeinflusste Lenz' Abkehr von den starren Regeln des französischen Klassizismus.
Wie hängen Körper- und Seelenbegriff bei Lenz mit seiner Dichtungstheorie zusammen?
Seine Dichtungstheorie ist durch seine spezifischen definitorischen Vorgaben von Körper und Seele bedingt, was sich in der Darstellung individueller Charaktere äußert.
Was bedeutet „Nachahmung als Nachhandlung“ im Schöpfungsprozess?
Für Lenz ist der poetische Schöpfungsprozess keine bloße Kopie der Natur, sondern ein aktives Nachvollziehen (Nachhandeln) der schöpferischen Kraft.
Welchen Autor antizipiert Lenz mit seinen dramentheoretischen Ansätzen?
Lenz' Ansätze nehmen bereits den sozial ambitionierten poetischen Realismus von Georg Büchner vorweg.
- Quote paper
- M.A. Frithjof Böhle-Holzapfel (Author), 1991, Die Theorie des poetischen Schöpfungsprozesses bei Jakob Michael Reinhold Lenz , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120438