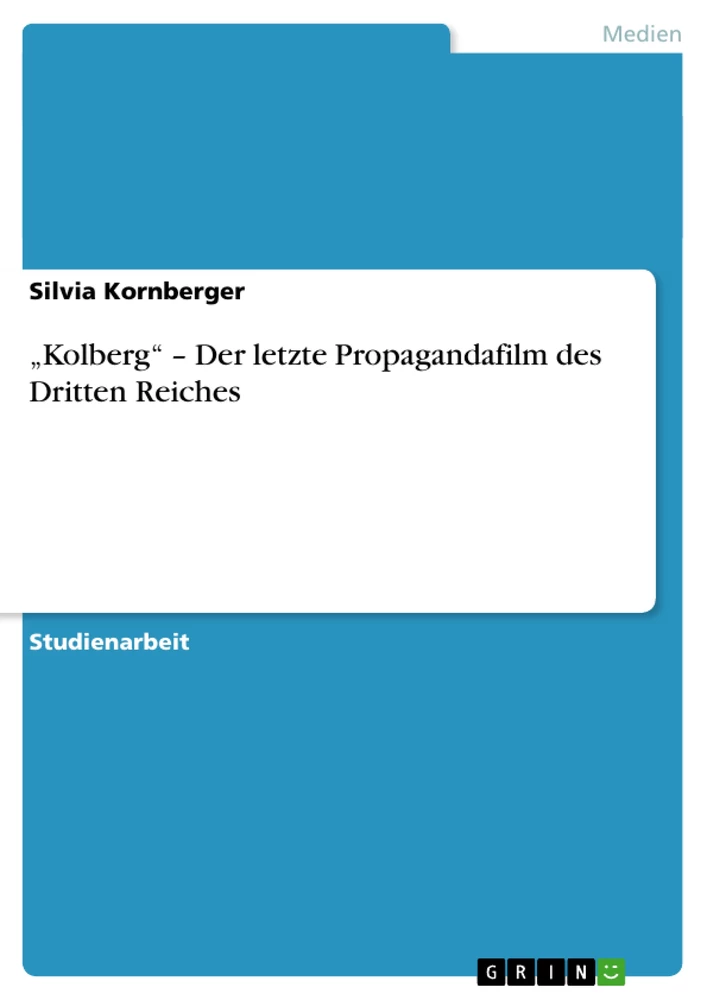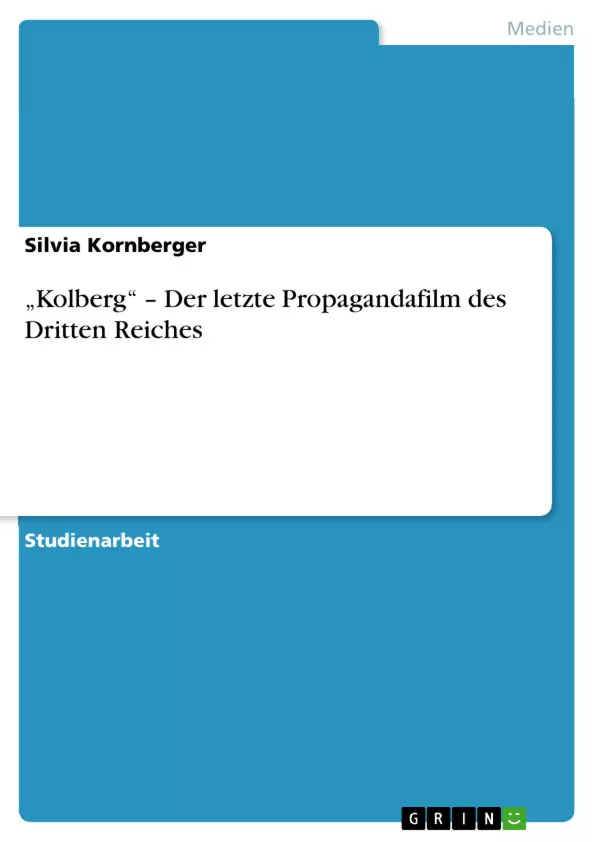„In their war propaganda films the Nazis, of course, pictured themselves exactly as they wanted to be seen, and when, with the passing of time, some traitor lost its attraction, the propaganda experts did not hesitate to suppress it.“ (Kracauer)
Trotz Aufruf zum „Widerstand bis zum Letzten“ klaffen Realität und Fiktion weit auseinander: Am 19. März schreibt Goebbels angesichts der verlustreichen Lage an der deutschen Ostfront: „Kolberg haben wir nunmehr räumen müssen. Die Stadt, die sich mit einem so außerordentlichen Heroismus verteidigt hat, konnte nicht mehr länger gehalten werden. Ich will dafür sorgen, dass die Räumung von Kolberg nicht im OKW-Bericht verzeichnet wird. Wir können das angesichts der starken psychologischen Folgen für den Kolberg-Film augenblicklich nicht gebrauchen.“
Die berechnete Verführung durch Ästhetisierung und Theatralisierung politischer Inhalte zur Mobilisierung des kollektiven Patriotismus ging nicht mehr auf. An der rauen Wirklichkeit prallte auch die schauspielerische Leistung der UFA-Stars wie Söderbaum oder George ab, denn weder Dialogführung noch der Einsatz symbolträchtiger Bilder konnten zu diesem Zeitpunkt noch mit der Realität Schritt halten.
Der Film zum universalisierten „deutschen Heldentum“ steht auch im Vergleich zur medialen Berichterstattung der späten NS-Täterprozesse Ende Fünfzigerjahre und des spektakulären Eichmann-Prozesses 1960/61 in Israel – nach Abflauen der alliierten Entnazifizierungsmaßnahmen – als sich öffentliche Stimmung wieder allmählich zu Gunsten der Täter veränderte.
Inhaltsverzeichnis
- Prolog
- Die Intention hinter „Kolberg“
- Eine filmische Materialschlacht
- Die Entstehungsgeschichte
- Propagandaerfahrene Publikumslieblinge werben fürs Durchhalten
- Kristina Söderbaum – die Verkörperung des nationalsozialistischen Frauentypus
- Heinrich George - ein wandlungsfähiger Schauspieler
- „Blut und Boden“- Dialogführung
- „Das Volk steht auf, der Sturm bricht los“ – Misstrauen gegenüber hohen Militärs
- Aufruf zur Opferbereitschaft
- Maria das Ideal des „deutschen Mädchens“
- Der Feind
- Deutsche Filmästhetik im Kontext mit dem Faschismus
- Massenszenen verbildlichen den „Volkskörper“
- Der mächtige Feind
- Optische Umsetzung des nationalsozialistischen Frauenbildes
- Der Feind im eigenen Lager
- „Gott ist mit den Gerechten“
- Epilog
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den Film „Kolberg“ (1943-45) als letzten Propagandafilm des Dritten Reiches. Ziel ist es, die Intentionen des Films, seine propagandistische Wirkung und die verwendeten filmischen Mittel zu untersuchen. Der Fokus liegt auf der Analyse der Dialoge, der Bildsprache und der Rolle der Schauspieler im Kontext des nationalsozialistischen Regimes.
- Die Intention des Films und seine Einordnung in den Kontext des Zweiten Weltkriegs
- Die propagandistische Wirkung von Dialogen und Bildern
- Die Darstellung des „deutschen Volkskörpers“ und des Feindbildes
- Die Rolle der Schauspieler und ihre Beziehung zum nationalsozialistischen Regime
- Die filmische Ästhetik im Kontext des Faschismus
Zusammenfassung der Kapitel
Der Prolog erläutert die Wahl des Films „Kolberg“ als Untersuchungsgegenstand und hebt dessen Unterschied zu anderen Filmen des NS-Regimes hervor. Kapitel 1 untersucht die Intention hinter „Kolberg“, die Entstehung des Films und die prominenten Schauspieler, die an dem Projekt beteiligt waren. Es beleuchtet den immensen materiellen Aufwand sowie die symbolträchtige Uraufführung kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Kapitel 2 analysiert die „Blut und Boden“-Ideologie, die im Film durch Dialoge transportiert wird. Die folgenden Kapitel befassen sich mit der Darstellung von Misstrauen gegenüber Militärs, dem Aufruf zur Opferbereitschaft und dem Idealbild des „deutschen Mädchens“, wie es der Film präsentiert. Die Analyse der deutschen Filmästhetik im Kontext des Faschismus beinhaltet verschiedene Aspekte der Bildgestaltung und deren propagandistische Wirkung.
Schlüsselwörter
Kolberg, Veit Harlan, Propagandafilm, Drittes Reich, Zweiter Weltkrieg, nationalsozialistische Ideologie, „Blut und Boden“, Filmsprache, Propaganda, Heinrich George, Kristina Söderbaum, Filmästhetik, Durchhalteparolen, Volkskörper, Feindbild.
Häufig gestellte Fragen
Warum gilt „Kolberg“ als der letzte Propagandafilm des NS-Regimes?
Der Film wurde unter extremem Aufwand kurz vor Kriegsende (1945) fertiggestellt, um das deutsche Volk zum „Durchhalten“ und zum totalen Widerstand aufzurufen.
Welche historische Begebenheit liegt dem Film zugrunde?
Der Film thematisiert die Verteidigung der Stadt Kolberg gegen die Truppen Napoleons im Jahr 1807, wobei die historische Realität stark für NS-Zwecke verzerrt wurde.
Wer waren die Hauptdarsteller in „Kolberg“?
Die Publikumslieblinge Heinrich George und Kristina Söderbaum spielten die Hauptrollen, um durch ihre Popularität die Akzeptanz der Durchhalteparolen zu erhöhen.
Welche filmischen Mittel wurden zur Propaganda genutzt?
Man nutzte gewaltige Massenszenen zur Darstellung des „Volkskörpers“, pathetische Dialoge („Blut und Boden“) und die Ästhetisierung von Opferbereitschaft.
Wie reagierte Goebbels auf die reale Räumung Kolbergs 1945?
Er sorgte dafür, dass die Räumung der Stadt nicht im Wehrmachtsbericht erwähnt wurde, um die psychologische Wirkung des zeitgleich anlaufenden Films nicht zu gefährden.
- Arbeit zitieren
- MMag. Silvia Kornberger (Autor:in), 2005, „Kolberg“ – Der letzte Propagandafilm des Dritten Reiches, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120467