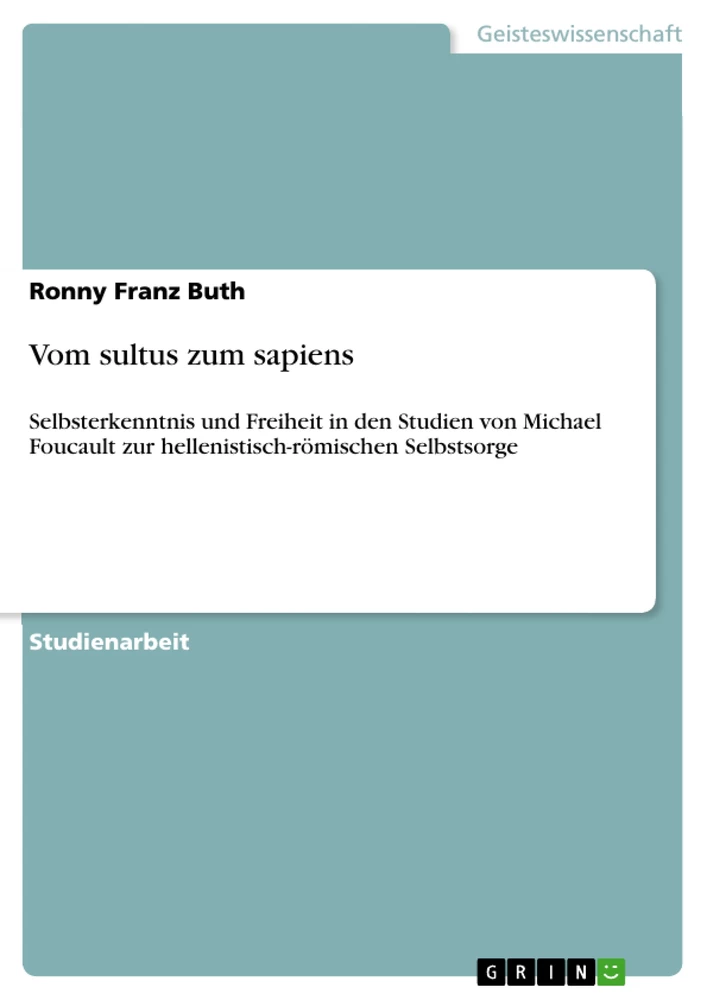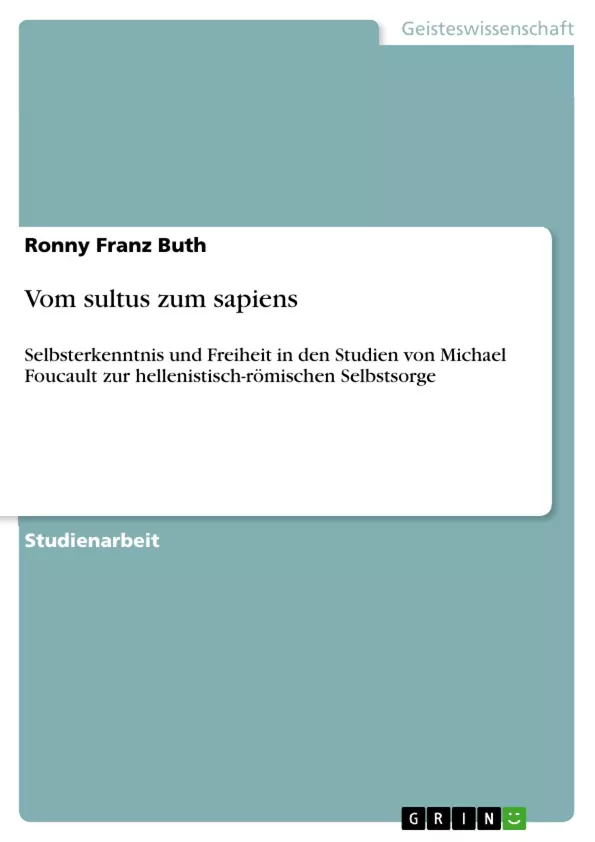Kann ein Subjekt eine unbeeinflusste Beziehung zur Wahrheit herausbilden? Betrachtet man den Großteil der Studien Michael Foucaults, in denen er sich bis zu Beginn der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts mit der Beziehung von Wissen und Macht auseinandersetzt und dabei Begriffe wie Disziplinarmacht und diskursiven Praktiken prägt, so würde man die Eingangsfrage verneinen und das bis dahin kaum näher betrachtete Subjekt als ein fremd-geformtes Produkt bzw. einen unselbstständigen, sich selbst unterwerfenden Untertanen ansehen. Foucaults Beschäftigung mit der hellenistisch-römischen Philosophie hingegen läutet sein Spätwerk ein und lenkt das Forschungsinteresse vom politisch-objektiven Feld auf die ethisch-subjektive Beziehung des Subjekts zur Wahrheit. Wäre der Begriff einer „Genealogie der Moral“ nicht bereits durch Nietzsche geprägt worden, so gestand Foucault, könnte sein Werk auch diesen Titel tragen. Er betreibt eine genealogische und archäologische Analyse im Hinblick auf die wechselseitige Beziehung und variierende Gewichtung von Verhaltenskodizes und Subjektivierungsformen. Vom Subjekt ausgehend untersucht er dessen, auf die Entwicklungsgeschichte des Abendlandes bezogenen, Bedingungen, Praktiken und Formungsmöglichkeiten. Wenn man so will, eine Genealogie des Selbst, des Heils und der Wahrheit – Begriffe, die fortlaufend in seinen Texten thematisiert werden. Im 1. und 2. Jahrhundert unserer Zeitrechnung entdeckt er eine hellenistisch-römische Selbstkultur, die ein, sich selbst konstituierendes, souveränes Subjekt hervorbrachte, ja sogar eine Kunst des Selbst begründete, das zum gesamtgesellschaftlich praktizierten Prinzip erhoben wurde. Von Januar bis März 1982 hält Foucault am Collège de France die Vorlesung „Hermeneutik des Subjekts“ , in der er das hellenistische Modell und die dazugehörigen Selbsttechniken der Sorge um sich, in Abgrenzung zum platonischen und christlichen Entwurf, erläutert. Das Konzept ist geprägt von einem außergewöhnlich intensiven Existenzbewusstsein und einer Subjektivierungsvorstellung, das dem christlichen Ideal des Selbstverzichts diametral entgegensteht. Im Folgenden soll, unter Beachtung anderer Arbeiten aus Foucaults Spätwerk, die Beziehung des Subjekts zur Wahrheit in dieser Zeit untersucht werden. Dabei wird die Funktionsweise der Umkehr zu sich, besonders die des stoischen Modells von Seneca, zusammenfassend vorgestellt und anschließend genauer geprüft. Ein besonderes Augenmerk soll weiterhin auf der Funktion der Selbsterkenntnis bei der Herausbildung von Autonomie liegen, die in der Vorlesung Foucaults einen hohen Stellenwert genießt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sokrates und die hellenistisch-römische Selbstsorge
- Wahrheit, Geistigkeit und Selbsterkenntnis von Sokrates bis in der Spätantike
- Die Umkehr zu sich, der doppelte Blick und die geistige Modalisierung bei Seneca
- Vollendete Selbsterkenntnis durch Naturerkenntnis im stoischen Denken
- Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Michael Foucaults Spätwerk, insbesondere seine Beschäftigung mit der hellenistisch-römischen Philosophie und dem Konzept der Selbstsorge. Der Fokus liegt auf der Beziehung des Subjekts zur Wahrheit in diesem Kontext und der Rolle der Selbsterkenntnis bei der Herausbildung von Autonomie.
- Foucaults genealogische Analyse der Selbstsorge
- Vergleich der sokratischen, hellenistisch-römischen und christlichen Konzepte der Selbsterkenntnis
- Die Bedeutung der „Umkehr zu sich“ und des doppelten Blicks
- Die Rolle der Selbsterkenntnis in der Entwicklung von Autonomie
- Das stoische Modell der Selbstsorge bei Seneca
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der Möglichkeit eines Subjekts, eine unbeeinflusste Beziehung zur Wahrheit aufzubauen, in den Kontext von Foucaults Werk. Sie führt in Foucaults Spätwerk und seine Beschäftigung mit der hellenistisch-römischen Philosophie ein, die im Gegensatz zu seinen früheren Arbeiten den Fokus auf die ethisch-subjektive Beziehung des Subjekts zur Wahrheit legt.
Sokrates und die hellenistisch-römische Selbstsorge: Dieses Kapitel untersucht die Ursprünge der Selbstsorge (epimeleia heautou) in der hellenistischen Philosophie und ihren Unterschied zum platonischen und christlichen Denken. Es vergleicht das sokratische Modell der Selbstsorge mit dem späteren hellenistisch-römischen Modell, wobei Unterschiede in Bezug auf Adressaten, Zielsetzung und den Stellenwert des Wissens hervorgehoben werden.
Schlüsselwörter
Michael Foucault, Selbstsorge (epimeleia heautou), Selbsterkenntnis (gnothi seauton), Hellenistisch-römische Philosophie, Stoizismus, Seneca, Autonomie, Wahrheit, Genealogie, Subjektivierung.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Michel Foucault unter „Sorge um sich“ (epimeleia heautou)?
Die Sorge um sich ist ein antikes Konzept der Selbstkultur, bei dem das Subjekt durch spezifische Techniken eine ethische Beziehung zu sich selbst aufbaut, um Autonomie und Souveränität zu erlangen.
Wie unterscheidet sich die stoische Selbstsorge vom christlichen Modell?
Während die stoische Sorge (z. B. bei Seneca) auf die Konstituierung eines starken, freien Selbst abzielt, ist das christliche Modell eher durch Selbstverzicht und Unterwerfung unter den göttlichen Willen geprägt.
Was bedeutet „Umkehr zu sich“ bei Seneca?
Es beschreibt den Prozess, den Blick von äußeren, unwichtigen Dingen abzuziehen und sich auf die eigene geistige Vervollkommnung und das Erlangen von Weisheit zu konzentrieren.
Welche Rolle spielt die Selbsterkenntnis für die Autonomie?
Selbsterkenntnis (gnothi seauton) ist die Voraussetzung dafür, die eigenen Abhängigkeiten zu erkennen und sich durch geistige Übungen von fremder Macht und Trieben zu befreien.
Was ist Foucaults „Hermeneutik des Subjekts“?
Es ist eine Vorlesungsreihe, in der Foucault die Geschichte untersuchte, wie das Subjekt im Abendland eine Beziehung zur Wahrheit hergestellt hat, insbesondere durch Praktiken der Selbstformung.
- Quote paper
- Ronny Franz Buth (Author), 2007, Vom sultus zum sapiens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120473