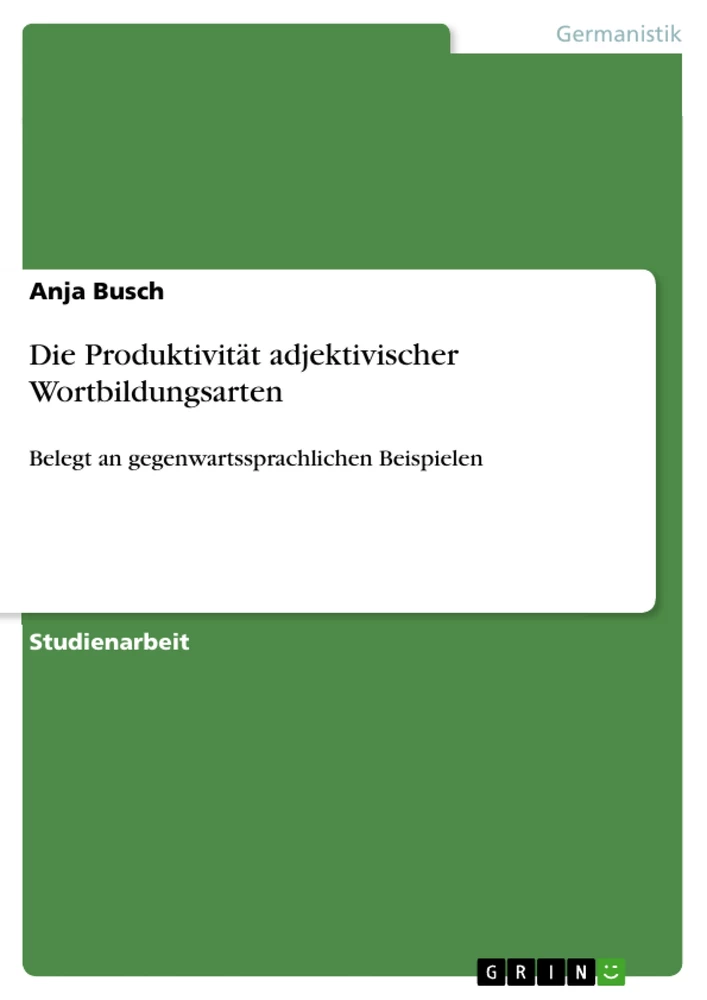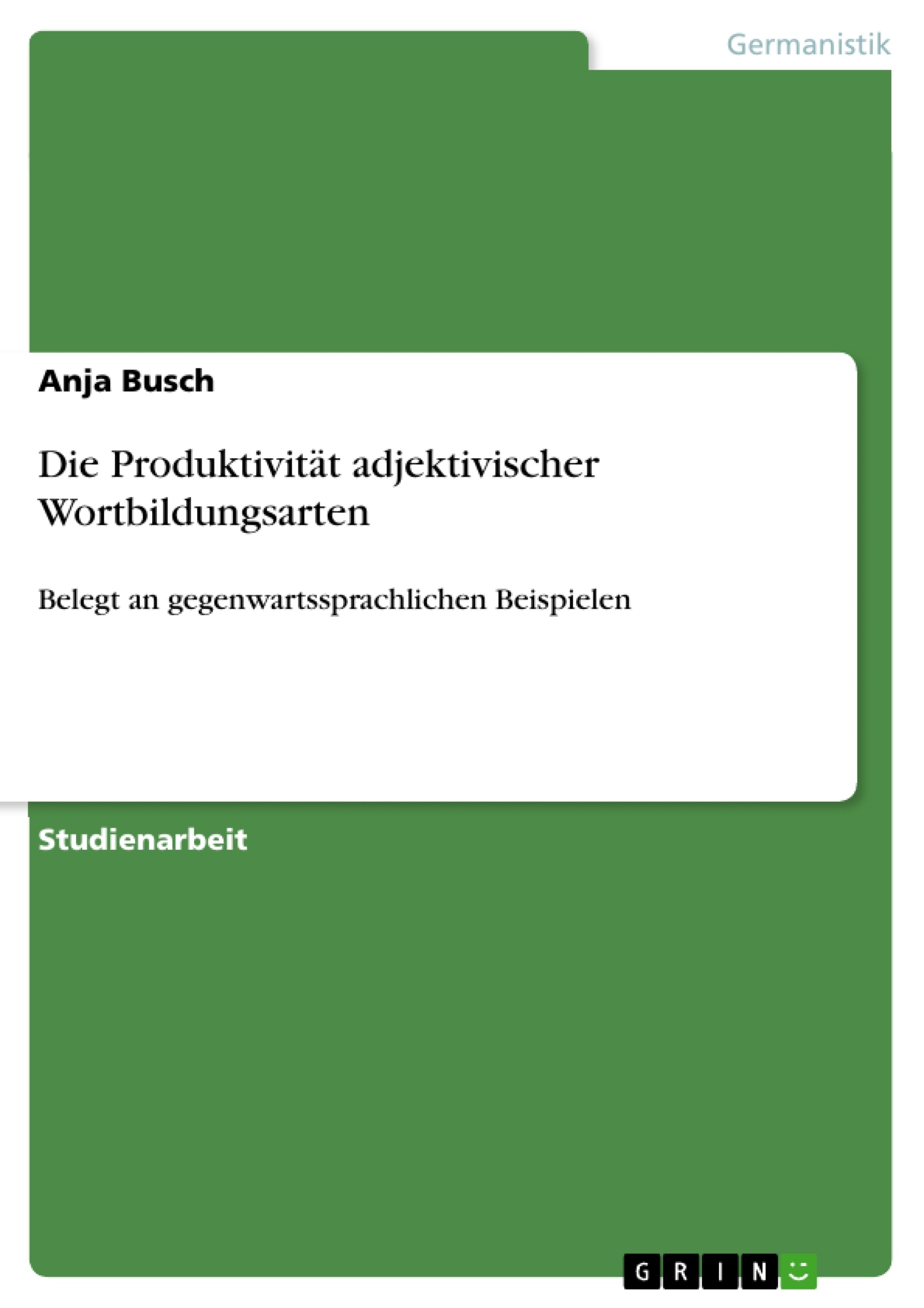Um die Produktivität von Wortbildungsmustern in der Gegenwartssprache zu untersuchen, bediene ich mich zweier Fundamente, die im Laufe der Arbeit zueinander geführt werden sollen. Den ersten Teil dieser Arbeit soll eine theoretische Basis ausmachen, in der die verschiedenen Wortbildungsmuster kurz vorgestellt und Angaben zu ihrer Produktivität gemacht werden sollen. Auf abweichende Definitionen in der einschlägigen Fachliteratur soll dabei Bezug genommen werden, es kann jedoch aufgrund des Umfangs dieser Arbeit kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden. Aus demselben Grund finden einige seltene und unproduktive Wortbildungsmuster keine Erwähnung.
Die zweite Grundlage dieser Arbeit bildet eine Sammlung von Beispielwörtern, die im Rahmen der Vorbereitung zu dieser Arbeit zusammengetragen wurden. Diese Wortneubildungen entstammen der Gegenwartssprache, sie sind also nicht älter als 80 Jahre. Es finden sich sowohl alltägliche Gebrauchswörter als auch Wörter aus der Jugendsprache darunter. Um die Produktivität von Wortbildungsprozessen in der Gegenwartssprache darzustellen, sollen im zweiten Teil dieser Arbeit diese zuvor zusammengetragenen Wortneubildungen ihren Wortbildungsklassen zugeordnet und interessante Beispiele näher untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Wortbildungsarten
- 2.1 Komposition
- 2.1.1 Determinativkomposition
- 2.1.2 Kopulativkomposition
- 2.2 Derivation
- 2.2.1 Explizite Derivation
- 2.2.1.1 Präfigierung
- 2.2.1.2 Suffigierung
- 2.2.1.3 Zirkumfixderivation
- 2.2.2 Implizite Derivation
- 3. Adjektivische Wortbildung
- 3.1 Determinative Adjektivkomposition
- 3.1.1 Determinative Substantiv-Adjektiv-Komposition
- 3.1.2 Determinative Adjektiv-Adjektiv-Komposition
- 3.1.3 Determinative Verb-Adjektiv-Komposition
- 3.2 Explizite Derivation von Adjektiven
- 3.2.1 Adjektivische Suffigierung
- 3.2.2 Adjektivische Präfigierung
- 3.2.3 Adjektivische Zirkumfigierung
- 3.3 Implizite Derivation von Adjektiven
- 3.4 Eigene Reflektionen über schwer zuordenbare Adjektivbildungen
- 3.4.1 Pfandpflichtig
- 3.4.2 Reproduktiv
- 3.4.3 Vorschulisch
- 3.4.4 Psycho und porno
- 3.4.5 Abgespaced
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Produktivität adjektivischer Wortbildungsmuster im Deutschen anhand von Beispielen aus der Gegenwartssprache. Sie verbindet eine theoretische Auseinandersetzung mit verschiedenen Wortbildungsarten mit einer empirischen Analyse von selbst gesammelten Wortneubildungen.
- Theoretische Einordnung verschiedener Wortbildungsarten (Komposition und Derivation)
- Untersuchung der Produktivität unterschiedlicher adjektivischer Wortbildungsmuster
- Analyse von Beispielen aus der Gegenwartssprache, inklusive Jugendsprache
- Klassifizierung von Wortneubildungen nach Wortbildungsklassen
- Reflexion über schwer zuordenbare Adjektivbildungen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 (Einleitung): Die Einleitung beschreibt die Zielsetzung der Arbeit: die Untersuchung der Produktivität von Wortbildungsmustern in der Gegenwartssprache anhand einer theoretischen Basis und einer Sammlung von Beispielwörtern.
Kapitel 2 (Wortbildungsarten): Dieses Kapitel behandelt die Komposition (Determinativ- und Kopulativkomposita) und die Derivation (explizit und implizit), inklusive Unterkategorien wie Präfigierung, Suffigierung und Zirkumfixierung. Es werden Angaben zur Produktivität der jeweiligen Wortbildungsarten gemacht und auf abweichende Definitionen in der Literatur eingegangen.
Kapitel 3 (Adjektivische Wortbildung): Dieses Kapitel fokussiert sich auf die adjektivische Wortbildung, unterteilt in determinative Komposition (Substantiv-Adjektiv, Adjektiv-Adjektiv, Verb-Adjektiv) und explizite sowie implizite Derivation von Adjektiven. Es beinhaltet auch eine Reflexion über besonders herausfordernde Fälle der Adjektivbildung.
Schlüsselwörter
Wortbildung, Komposition, Derivation, Adjektiv, Produktivität, Gegenwartssprache, Determinativkomposition, Kopulativkomposition, Präfigierung, Suffigierung, Zirkumfixderivation, Implizite Derivation, Wortneubildung.
- Quote paper
- Anja Busch (Author), 2008, Die Produktivität adjektivischer Wortbildungsarten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120476