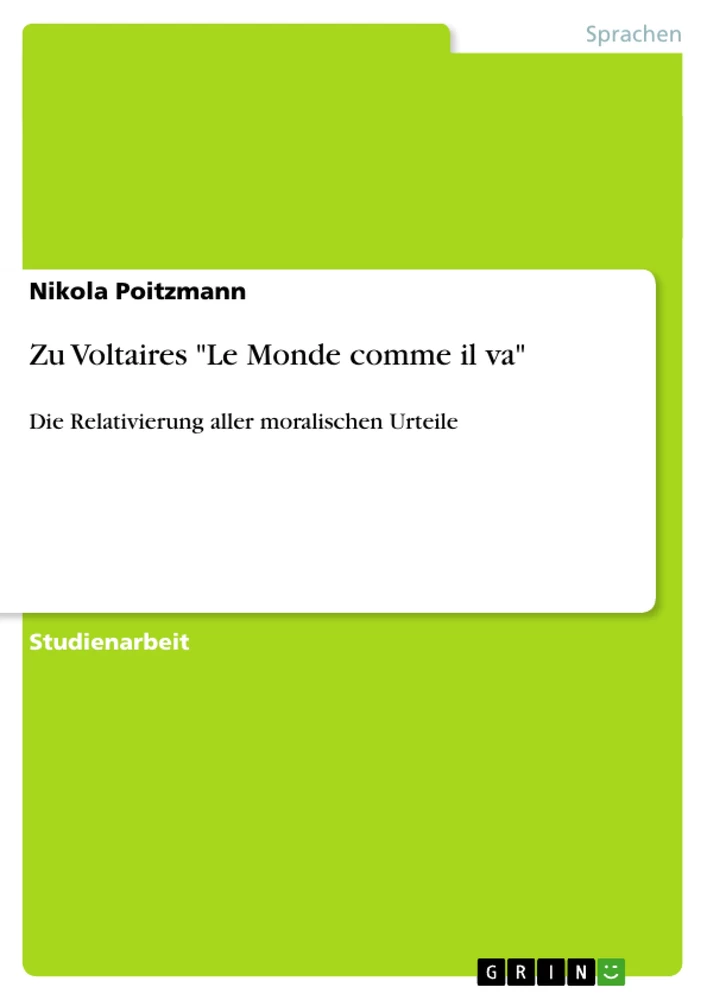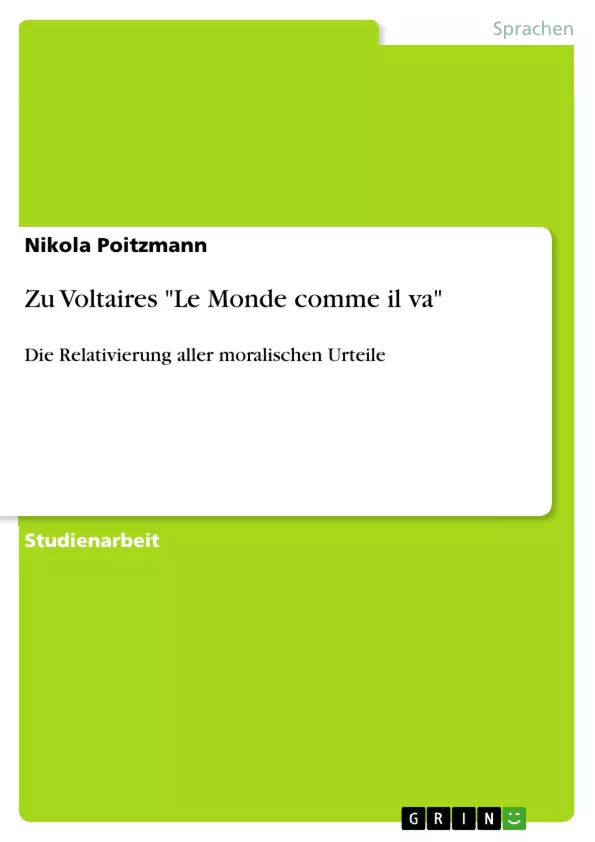Le Monde comme il va ist im Gegensatz zu anderen Erzählungen Voltaires, wie beispiels-weise Zadig, L’ingénu und Candide, weniger bekannt und wissenschaftlich untersucht worden. Dieser geringe Bekanntheitsgrad ist erstaunlich, denn Le Monde comme il va ist geradezu repräsentativ für die Gattung des „conte philosophique.“ Außerdem überzeugt die Erzählung durch eine komplexe Handlung mit weitreichenden Interpretationsmöglichkeiten und sprachlichen Raffinessen, die durch ironische Formulierungen erzielt werden. Durch den aktuellen Forschungsansatz einiger Literaturwissenschaftler, die Stadt Persepolis mit Paris gleichzusetzen, hat der Text heute ebenfalls ein historisches Interesse.
Ab 1704 wurden die Geschichten aus 1001 Nacht (um 956) von Antoine Galland (1646-1715) ins Französische übersetzt und nahmen Einzug in die literarische Welt des Abend-landes. Die orientalischen Märchen wurden allerdings als Unterhaltungsliteratur betrachtet, als nette Geschichten ohne Bedeutung. Die „contes philosphiques“ hingegen unterscheiden sich von den Erzählungen des Orients in einem wichtigen Punkt. Sie beinhalten eine „vérité fine“, einen tieferen Sinn, der den Leser nicht nur amüsieren, sondern auch zum Nachdenken anregen soll. Die „vérité fine“ ist kasuistisch, das heißt von Fall zu Fall ent-scheidend.
Auf den folgenden Seiten werde ich herausarbeiten, welche „vérité fine“ Le Monde comme il va beinhaltet und dabei den conte unter verschiedenen Aspekten untersuchen. Dabei werde ich im ersten Teil eine hauptsächlich textimmanente Analyse durchführen. Danach werde ich auf die beiden Prophetenerzählungen eingehen, die Voltaire in Le Monde comme il va mit eingebunden hat. Diese Betrachtungsweise ist nicht unerheblich, weil Voltaire die Bibel häufig als Inspirationsquelle verwendete. Im letzten Teil werde ich mich mit der Interpretation unter biographischen Gesichtspunkten befassen und diese exemplarisch verdeutlichen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Entstehungsgeschichte
- Gut und Böse in der Erzählung
- Intertextualität in Le Monde comme il va..
- Das Buch Jona
- Das Buch Daniel 2
- Le Monde comme il va als satirisches Panorama der Stadt Paris
- Die „vérité fine“ des conte: Die Relativierung aller moralischen Urteil
- Fazit: Le Monde comme il va als „conte philosphique“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zielsetzung dieser Arbeit ist die Analyse von Voltaires "Le Monde comme il va" unter verschiedenen Aspekten. Der Fokus liegt auf der Darstellung von Gut und Böse, der Intertextualität mit biblischen Erzählungen und der satirischen Kritik der Gesellschaft. Die Arbeit untersucht die "vérité fine" des Textes und beleuchtet die komplexe Handlung und die sprachlichen Raffinessen des Werkes.
- Darstellung von Gut und Böse in Persepolis
- Intertextualität und Bezug zu biblischen Erzählungen (Jona und Daniel)
- Satire auf die Pariser Gesellschaft und das Ancien Régime
- Die "vérité fine" als tieferer Sinn der Erzählung
- Analyse der ambivalenten menschlichen Psyche
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und begründet die Wahl von "Le Monde comme il va" als Forschungsgegenstand. Sie hebt die relative Unbekanntheit des Werkes im Vergleich zu anderen Werken Voltaires hervor und betont dessen Bedeutung als "conte philosophique" sowie seinen aktuellen historischen Bezug. Die Einleitung skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, der eine textimmanente Analyse, die Berücksichtigung der eingebundenen biblischen Erzählungen und eine biographische Betrachtung umfasst.
Zur Entstehungsgeschichte: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehungsgeschichte von "Le Monde comme il va", beginnend mit der ersten Lesung im Salon der Duchesse du Maine im Jahr 1747. Es beschreibt den Kontext der Entstehung im Salon und die späteren Druckfassungen mit unterschiedlichen Titeln. Das Kapitel liefert wichtige historische und literarische Hintergrundinformationen zur Entstehung des Werkes.
Gut und Böse in der Erzählung: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung von Gut und Böse im Text durch die Figur des Skythen Babouc, der als unvoreingenommener Beobachter die verschiedenen Facetten der Gesellschaft Persepolis erlebt. Es wird detailliert die Begegnung Baboucs mit den im Krieg stehenden Soldaten und deren Unkenntnis über die Kriegsursache geschildert. Der Text kontrastiert die Grausamkeiten des Krieges mit Momenten von Gastlichkeit und Nächstenliebe, und verdeutlicht damit die ambivalente Natur der menschlichen Psyche.
Intertextualität in Le Monde comme il va..: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Intertextualität und den Bezug zu biblischen Erzählungen. Die Analyse der Einbettung der Geschichten von Jona und Daniel untersucht, wie Voltaire diese nutzt, um seine eigene Kritik und seine Botschaft zu unterstreichen. Die Untersuchung der Intertextualität trägt zu einem tieferen Verständnis der Erzählung und ihrer Intentionen bei.
Le Monde comme il va als satirisches Panorama der Stadt Paris: Dieses Kapitel analysiert den Text als satirisches Panorama der Stadt Paris. Die Beschreibungen Persepolis' dienen als Spiegelbild des damaligen Paris, wodurch soziale Missstände, politische Korruption und die moralische Verkommenheit der Gesellschaft kritisiert werden. Die genaue Analyse der satirischen Elemente und deren Bedeutung wird hier beleuchtet.
Die „vérité fine“ des conte: Die Relativierung aller moralischen Urteil: Dieses Kapitel konzentriert sich auf den "tieferen Sinn" der Erzählung, die "vérité fine". Es analysiert, wie Voltaire durch die Darstellung der Ereignisse und die Charaktere eine Relativierung aller moralischen Urteile erreicht. Die Interpretation des tieferen Sinnes der Erzählung steht im Zentrum dieses Kapitels.
Schlüsselwörter
Le Monde comme il va, Voltaire, conte philosophique, Gut und Böse, Satire, Intertextualität, Bibel, Jona, Daniel, Persepolis, Paris, Ancien Régime, "vérité fine", ambivalente menschliche Psyche, moralische Relativierung.
Häufig gestellte Fragen zu Voltaires "Le Monde comme il va"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Voltaires "Le Monde comme il va" unter verschiedenen Aspekten. Der Fokus liegt auf der Darstellung von Gut und Böse, der Intertextualität mit biblischen Erzählungen (Jona und Daniel), der satirischen Kritik der Pariser Gesellschaft und des Ancien Régime, sowie der "vérité fine" des Textes und der ambivalenten menschlichen Psyche.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Darstellung von Gut und Böse, die Intertextualität mit biblischen Erzählungen, die Satire auf die Pariser Gesellschaft, die "vérité fine" als tieferer Sinn der Erzählung und die Analyse der ambivalenten menschlichen Psyche. Die Entstehungsgeschichte des Werkes wird ebenfalls beleuchtet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zur Entstehungsgeschichte, zur Darstellung von Gut und Böse, zur Intertextualität mit biblischen Erzählungen (Jona und Daniel), zur satirischen Darstellung des Pariser Lebens, zur "vérité fine" und einem Fazit. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse des jeweiligen Aspekts.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine textimmanente Analyse, berücksichtigt die eingebundenen biblischen Erzählungen und umfasst eine biographische Betrachtung. Die Analyse konzentriert sich auf die sprachlichen Raffinessen und die komplexe Handlung des Werkes.
Welche Rolle spielen die biblischen Erzählungen von Jona und Daniel?
Die Erzählungen von Jona und Daniel werden als intertextuelle Bezüge analysiert. Die Arbeit untersucht, wie Voltaire diese nutzt, um seine eigene Kritik und Botschaft zu unterstreichen und ein tieferes Verständnis der Erzählung und ihrer Intentionen zu ermöglichen.
Wie wird die "vérité fine" interpretiert?
Die "vérité fine" wird als der "tieferer Sinn" der Erzählung interpretiert. Die Arbeit analysiert, wie Voltaire durch die Darstellung der Ereignisse und Charaktere eine Relativierung aller moralischen Urteile erreicht. Die Interpretation des tieferen Sinnes steht im Mittelpunkt.
Welche Bedeutung hat die satirische Darstellung der Pariser Gesellschaft?
Die Beschreibungen Persepolis' in "Le Monde comme il va" dienen als Spiegelbild des damaligen Paris. Die Arbeit analysiert die satirischen Elemente und deren Bedeutung, um soziale Missstände, politische Korruption und die moralische Verkommenheit der Gesellschaft zu beleuchten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Le Monde comme il va, Voltaire, conte philosophique, Gut und Böse, Satire, Intertextualität, Bibel, Jona, Daniel, Persepolis, Paris, Ancien Régime, "vérité fine", ambivalente menschliche Psyche, moralische Relativierung.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und bewertet "Le Monde comme il va" als "conte philosophique", der durch seine satirische Schärfe und seine komplexe Darstellung von Gut und Böse auch heute noch aktuell ist. Die relative Unbekanntheit des Werkes wird bedauert.
- Quote paper
- M. A. Nikola Poitzmann (Author), 2001, Zu Voltaires "Le Monde comme il va", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120570