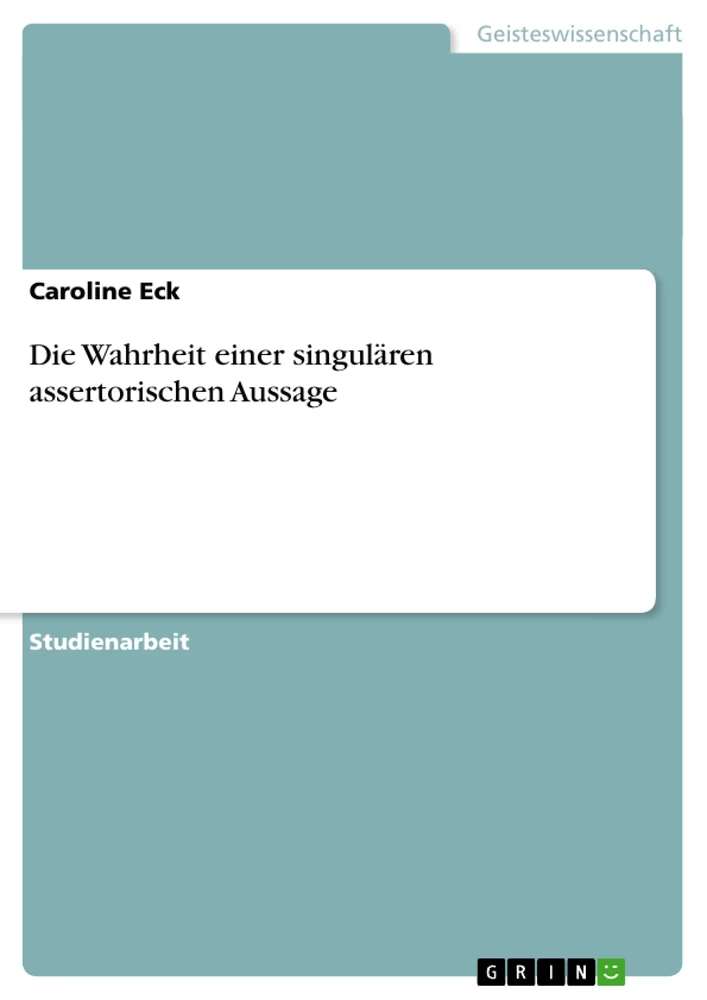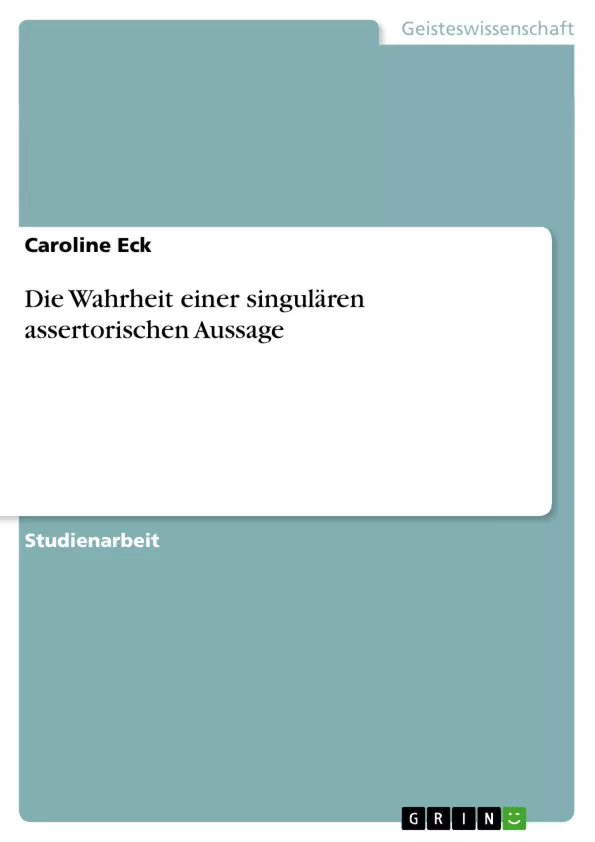Diese Hausarbeit wird sich mit dem sechzehnten. Text der „Texte zur Theorie der Erkenntnis
und der Wissenschaft“, der dort auf den Seiten 99 bis 102 zu finden ist, auseinandersetzen.
Diese Textsammlung beinhaltet verschiedene Texte der Summa Logicae des Wilhelm von
Ockham. In seiner Summa Logicae beschäftigte sich Ockham mit den logischen und
semantischen Voraussetzungen von Sprache. Er schuf damit ein systematisches Handbuch der
Logik. Er stellte dabei aber im Gegensatz zu Aristoteles nicht zuerst auf den Wahrheitsgehalt
von Aussagen ab, sondern kümmerte sich zuerst um die einzelnen Bestandteile von Aussagen.
Erst nach einer Definition und Darstellung derselben, beschäftigte er sich näher mit der Frage
nach dem Wahrheitsgehalt von Aussagen.
Innerhalb dieser Hausarbeit ist keine klare Gliederung und Unterscheidung zwischen einer
Inhaltsangabe und Analyse des Textes vorgenommen worden. Ihr Gegenstand bot es an,
beides zusammen zu fassen. Dementsprechend werden auch Begriffe von zentraler Bedeutung
nicht in einem vorangestellten Teil bzw. einem vom Text unabhängigen Teil dargestellt und
definiert, sondern dies geschieht ebenfalls innerhalb des Hauptteils. So vorzugehen, schien
aus zwei Gründen sinnvoll zu sein. Zum einen ergibt sich dadurch die Möglichkeit, Begriffe
darzustellen, ohne dass dies willkürlich erscheint. Würde vorab eine Begriffsklärung
stattfinden, so könnte der mit der Arbeit Ockhams vertraute Leser den Eindruck gewinnen,
dass die Darstellung unvollständig sei. Da diese Hausarbeit jedoch keine Zusammenfassung
der gesamten vorliegenden Textsammlung sein soll, müssen einfach bestimmte Dinge
weggelassen werden. Deshalb erschien es eben sinnvoller, nur die in Text 16 vorkommenden
Begriffe gesondert darzustellen und etwas vertiefter zu behandeln. Zum zweiten wird so ein
Leser, der mit der Gesamtmaterie weniger vertraut ist, nicht mit Fakten überhäuft, die unter
Umständen für die Rezeption des sechzehnten Textes nicht von vorrangiger Bedeutung sind.
Insgesamt muss man sagen, dass eine Begriffsklärung nicht generell unterbleiben kann, da
manche Begriffe, die im Text vorkommen, heute anders verstanden werden, bzw. weil die
Übersetzung teilweise etwas holprig ist und für das genaue Verständnis eines Textes nun
einmal das Verstehen der in ihm verwendeten Begriffe wichtig ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert den 16. Text aus Ockhams „Summa Logicae“, welcher sich mit den Wahrheitsbedingungen singulärer assertorischer Aussagen beschäftigt. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse von Ockhams Argumentation und Begrifflichkeiten, ohne eine strikte Trennung zwischen Inhaltsangabe und Analyse vorzunehmen.
- Wahrheitsbedingungen singulärer assertorischer Aussagen
- Ockhams Begriff des „Terminus“ und seine verschiedenen Ausprägungen
- Der Unterschied zwischen gedachten, gesprochenen und geschriebenen Termini
- Analyse der assertorischen Aussage als Behauptung
- Ockhams Methode der Analyse von Aussagen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Gegenstand der Hausarbeit: die Analyse des 16. Textes aus der Textsammlung „Texte zur Theorie der Erkenntnis und der Wissenschaft“, welcher Ausschnitte aus Ockhams „Summa Logicae“ beinhaltet. Es wird die Herangehensweise der Autorin erläutert, welche eine Integration von Inhaltsangabe und Analyse ohne vorherige, vom Text unabhängige Begriffserklärung beinhaltet. Diese Entscheidung wird damit begründet, dass eine umfassende Begriffsklärung den mit Ockhams Werk vertrauten Leser als unvollständig erscheinen lassen könnte, gleichzeitig aber ein Leser ohne Vorwissen nicht mit überflüssigen Informationen überhäuft werden soll. Die Übersetzungsprobleme und die unterschiedliche Bedeutung mancher Begriffe im heutigen Sprachgebrauch werden als Begründung für eine situationsbezogene Begriffserklärung innerhalb des Hauptteils angeführt.
Hauptteil: Der Hauptteil beschäftigt sich mit Ockhams Analyse der Wahrheitsbedingungen singulärer assertorischer Aussagen in der Gegenwart. Der Text gliedert sich in vier Abschnitte, wobei der erste Abschnitt Ockhams Vorgehensweise erläutert und den Fokus auf assertorische Aussagen im Präsens legt, im Gegensatz zu hypothetischen Aussagen. Es folgt eine Begriffserklärung von „assertorisch“ als „behauptend“. Ein Beispiel für eine singuläre assertorische Aussage wird gegeben („Die Katze ist ein kluges Tier.“). Der zweite Abschnitt behandelt den Begriff „Terminus“ und dessen dreifache Ausprägung (gedachte, gesprochene und geschriebene Termini), die in einem Stufenverhältnis zueinander stehen. Ockham unterscheidet zwischen der natürlichen Bedeutung des gedachten Terminus, der im Geist existiert, und dem konventionellen Charakter der gesprochenen und geschriebenen Termini. Die Beziehung zwischen diesen Termini wird als Zeichencharakter beschrieben, wobei der gesprochene Terminus ein Zeichen des gedachten und der geschriebene ein Zeichen des gesprochenen Terminus darstellt. Der Autor betont die Bedeutung des Verständnisses dieser Begriffe für die korrekte Interpretation des Textes.
Schlüsselwörter
Singuläre assertorische Aussage, Wahrheitsbedingungen, Wilhelm von Ockham, Summa Logicae, Terminus, gedachter Terminus, gesprochener Terminus, geschriebener Terminus, Behauptung, Semantik, Logik.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Analyse des 16. Textes aus Ockhams "Summa Logicae"
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit analysiert den 16. Text aus Ockhams „Summa Logicae“, der sich mit den Wahrheitsbedingungen singulärer assertorischer Aussagen befasst. Der Fokus liegt auf der Analyse von Ockhams Argumentation und Begrifflichkeiten, wobei Inhaltsangabe und Analyse integriert sind.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die zentralen Themen sind die Wahrheitsbedingungen singulärer assertorischer Aussagen, Ockhams Begriff des „Terminus“ in seinen verschiedenen Ausprägungen (gedacht, gesprochen, geschrieben), der Unterschied zwischen diesen Termini, die Analyse der assertorischen Aussage als Behauptung und Ockhams Methode der Aussagenanalyse.
Wie ist die Hausarbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in Einleitung, Hauptteil und Schlusswort. Die Einleitung beschreibt den Gegenstand und die Herangehensweise der Analyse. Der Hauptteil analysiert Ockhams Text in vier Abschnitten, wobei der Fokus auf assertorischen Aussagen im Präsens liegt. Das Schlusswort fasst die Ergebnisse zusammen (obwohl der bereitgestellte Text kein explizites Schlusswort enthält, wird dies aufgrund der Standardstruktur einer wissenschaftlichen Arbeit angenommen).
Wie wird der Begriff "Terminus" bei Ockham verstanden?
Ockham unterscheidet drei Ausprägungen des „Terminus“: den gedachten Terminus (im Geist existierend), den gesprochenen und den geschriebenen Terminus. Diese stehen in einem Stufenverhältnis zueinander, wobei der gesprochene ein Zeichen des gedachten und der geschriebene ein Zeichen des gesprochenen Terminus darstellt. Ockham betont die Bedeutung des natürlichen Sinns des gedachten Terminus im Gegensatz zum konventionellen Charakter der gesprochenen und geschriebenen Termini.
Was sind singuläre assertorische Aussagen?
Die Hausarbeit verwendet das Beispiel „Die Katze ist ein kluges Tier.“ als singuläre assertorische Aussage. Der Text erklärt „assertorisch“ als „behauptend“. Die Arbeit analysiert die Wahrheitsbedingungen solcher Aussagen im Kontext von Ockhams Philosophie.
Welche Methode wendet die Autorin bei der Analyse an?
Die Autorin integriert Inhaltsangabe und Analyse ohne vorherige, vom Text unabhängige Begriffserklärung. Dies begründet sie damit, um sowohl Leser mit Vorwissen als auch Leser ohne Vorwissen angemessen anzusprechen und Übersetzungsprobleme zu berücksichtigen. Begriffserklärungen erfolgen daher situationsbezogen innerhalb des Hauptteils.
Welche Schlüsselwörter sind für das Verständnis der Hausarbeit relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Singuläre assertorische Aussage, Wahrheitsbedingungen, Wilhelm von Ockham, Summa Logicae, Terminus, gedachter Terminus, gesprochener Terminus, geschriebener Terminus, Behauptung, Semantik, Logik.
- Arbeit zitieren
- Caroline Eck (Autor:in), 2002, Die Wahrheit einer singulären assertorischen Aussage, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12058