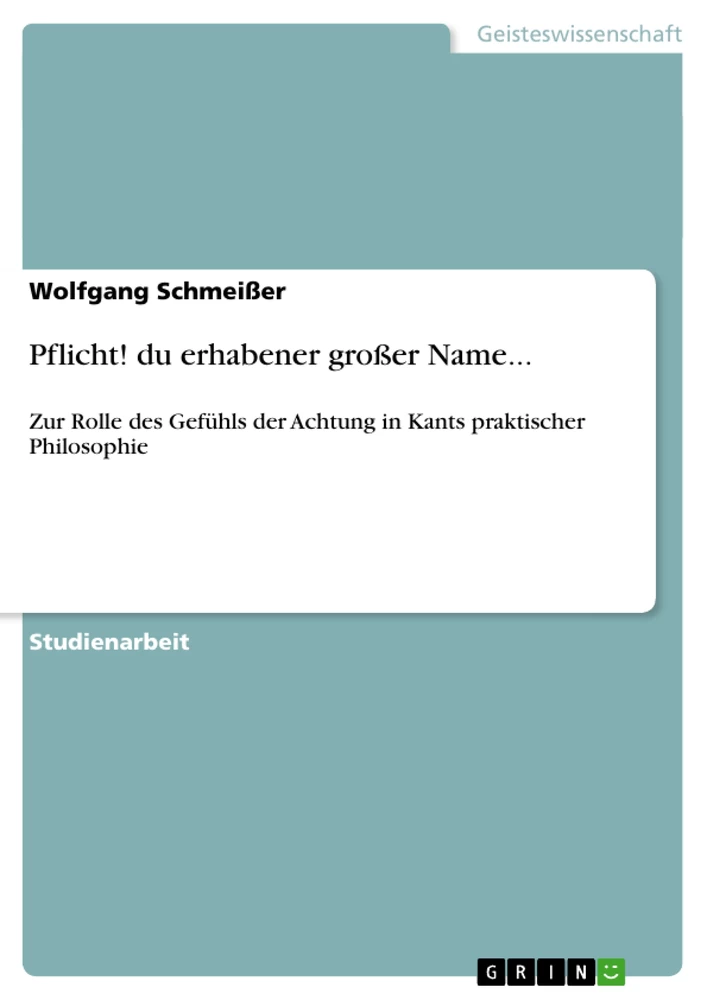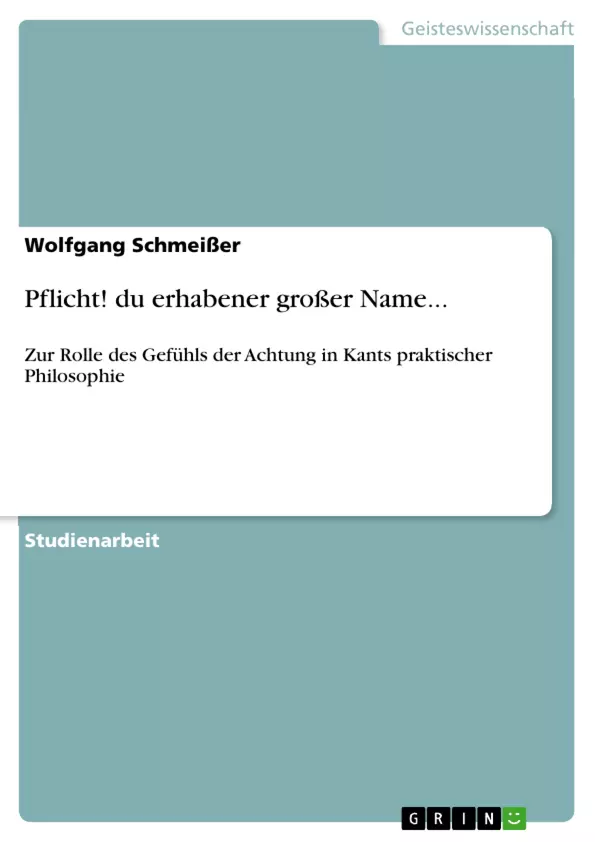„P f l i c h t ! du erhabener großer Name, der du nichts Beliebtes, was Einschmeichelung
bei sich führt, in dir fassest, sondern Unterwerfung verlangst, doch auch
nichts drohest, was natürliche Abneigung im Gemüte erregte und schreckte, um den
Willen zu bewegen, sondern bloß ein Gesetz aufstellst, welches von selbst im Gemüte
Eingang findet, und doch sich selbst wider Willen Verehrung (wenn gleich nicht immer
Befolgung) erwirbt, vor dem alle Neigungen verstummen, wenn sie gleich ihm
entgegen wirken, welches ist der deiner würdige Ursprung, und wo findet man die
Wurzel deiner edlen Abkunft, welche alle Verwandtschaft mit Neigungen stolz ausschlägt,
und von welcher Wurzel abzustammen, die unnachlaßliche Bedingung desjenigen
Wertes ist, den sich Menschen allein selbst geben können?“1
Wie pathetisch der sonst so trockene Kant doch zuweilen werden kann.
P f l i c h t ! ist ein zentraler Begriff der praktischen Philosophie Kants. Er beinhaltet
die Notwendigkeit einer Handlung aus bloßer Achtung fürs praktische Gesetz, welches
ohne Ansehung der Bedingungen oder der Gelegenheit unnachlaßlich gelten
soll. „Hier ist nun die bloße Gesetzmäßigkeit überhaupt (ohne ein auf gewisse Handlungen
bestimmtes Gesetz zum Grunde zu legen) das, was dem Willen zum Prinzip
dient und ihm auch dazu dienen muß, wenn Pflicht nicht überall ein leerer Wahn und
chimärischer Begriff sein soll; hiemit stimmt die gemeine Menschenvernunft in ihrer
Beurteilung auch vollkommen überein und hat das gedachte Prinzip jederzeit vor Augen.“ Zu diesem Gesetz der Gesetzmäßigkeit tritt nun ein Maxime genannter, verallgemeinerter
Vorsatz einer je bestimmten Handlung hinzu, was einen, diese Handlung
fordernden, kategorischen Imperativ ergibt, d.i. einer, welcher, im Unterschiede zu
dem hypothetischen, vermöge seiner Einstimmung mit dem praktischen Gesetze, so
fern also die Maxime überhaupt als allgemeines Gesetz gedacht werden kann, ohne
dabei mit sich selbst in Widerstreit zu geraten, als ein solches unbedingt ist und mithin
jederzeit gelten kann. „Unerfahren in Ansehung des Weltlaufs, unfähig auf alle sich ereignenden Vorfälle
desselben gefaßt zu sein, frage ich mich nur: Kannst du auch wollen, daß deine Maxime ein allgemeines Gesetz werde? [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Zum Begriff der Pflicht
- Erster Abschnitt: Über die Natur
- Natur und Kausalität der Natur
- Wille und Heteronomie des Willens
- Zweck und Zweckmäßigkeit
- Zweiter Abschnitt: Über die Freiheit
- Dinge an sich und die Möglichkeit der Freiheit
- Autonomie des Willens und Achtung vorm Gesetz
- Endzweck und Selbstzweck
- Dritter Abschnitt: Freiheit in der Erscheinung
- Vernünftige Wesen und das transzendentale Subjekt
- Würde und Demütigung
- Über das erhabene Gefühl
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Rolle des Gefühls der Achtung in Kants praktischer Philosophie. Sie beleuchtet den zentralen Begriff der Pflicht und seine Verbindung zur Autonomie des Willens. Die Arbeit analysiert den kategorischen Imperativ und dessen Bedeutung für die moralische Gesetzgebung.
- Der Begriff der Pflicht in Kants Philosophie
- Die Autonomie des Willens und die Achtung vor dem moralischen Gesetz
- Der kategorische Imperativ als Prinzip moralischer Handlung
- Die Beziehung zwischen Vernunft, Wille und Handlung
- Die Rolle des Gefühls der Achtung im moralischen Handeln
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Zum Begriff der Pflicht: Die Einleitung zitiert Kant pathetisch über den Begriff der Pflicht, der als zentrale Komponente der praktischen Philosophie eingeführt wird. Die Notwendigkeit einer Handlung aus bloßer Achtung fürs praktische Gesetz, unabhängig von Bedingungen oder Gelegenheiten, wird hervorgehoben. Der Unterschied zwischen hypothetischem und kategorischem Imperativ wird angedeutet, wobei letzterer auf der Gesetzmäßigkeit und Allgemeingültigkeit der Maxime beruht. Die Einleitung legt den Fokus auf die zentrale Frage nach dem Ursprung und der Bedeutung der Pflicht in Kants Denken.
Erster Abschnitt: Über die Natur: Dieser Abschnitt untersucht die Natur und deren Kausalität, beleuchtet die Heteronomie des Willens im Gegensatz zur Autonomie, und analysiert die Konzepte von Zweck und Zweckmäßigkeit. Es wird die Frage nach dem freien Willen im Kontext der Naturgesetze diskutiert, um den Boden für die spätere Betrachtung der Freiheit zu bereiten. Die verschiedenen Aspekte der Natur werden hier als Grundlage für das Verständnis des Willens und der moralischen Handlungsfähigkeit des Menschen betrachtet.
Zweiter Abschnitt: Über die Freiheit: Der zweite Abschnitt befasst sich mit der Möglichkeit der Freiheit im Lichte der „Dinge an sich“. Die Autonomie des Willens als Grundlage der Moral und die Achtung vor dem Gesetz werden ausführlich behandelt. Der Abschnitt analysiert die Konzepte von Endzweck und Selbstzweck, um die ethische Dimension des freien Willens zu beleuchten. Die zentrale Frage hier ist, wie Freiheit im Rahmen der kantischen Philosophie überhaupt möglich ist und welche Rolle das moralische Gesetz dabei spielt.
Dritter Abschnitt: Freiheit in der Erscheinung: Dieser Abschnitt verbindet die zuvor behandelten Konzepte von Freiheit und moralischem Gesetz mit der menschlichen Erfahrung. Die Würde des Menschen und die Möglichkeit seiner Demütigung werden im Kontext der Freiheit diskutiert. Besonderes Augenmerk liegt auf dem "erhabenen Gefühl" und seiner Bedeutung für das moralische Bewusstsein. Die Untersuchung der Freiheit in der Erscheinung schließt die Brücke zwischen der transzendentalen und der empirischen Ebene der kantischen Philosophie.
Schlüsselwörter
Pflicht, Autonomie, kategorischer Imperativ, Achtung, moralisches Gesetz, Freiheit, Vernunft, Wille, Zweck, praktische Philosophie, Kant.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Seminararbeit zur Kantischen Pflicht
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit analysiert die Rolle des Gefühls der Achtung in Kants praktischer Philosophie, insbesondere den zentralen Begriff der Pflicht und seine Verbindung zur Autonomie des Willens. Ein Schwerpunkt liegt auf dem kategorischen Imperativ und seiner Bedeutung für die moralische Gesetzgebung.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt zentrale Themen der Kantischen Ethik wie den Begriff der Pflicht, die Autonomie des Willens, die Achtung vor dem moralischen Gesetz, den kategorischen Imperativ als Prinzip moralischer Handlung, die Beziehung zwischen Vernunft, Wille und Handlung und die Rolle des Gefühls der Achtung im moralischen Handeln.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in vier Abschnitte gegliedert: Eine Einleitung zum Begriff der Pflicht, einen Abschnitt über die Natur (Natur und Kausalität, Wille und Heteronomie, Zweck und Zweckmäßigkeit), einen Abschnitt über die Freiheit (Dinge an sich und Freiheit, Autonomie und Achtung, Endzweck und Selbstzweck) und einen Abschnitt über Freiheit in der Erscheinung (Vernünftige Wesen, Würde und Demütigung, das erhabene Gefühl).
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt den Begriff der Pflicht als zentrale Komponente der praktischen Philosophie ein und hebt die Notwendigkeit einer Handlung aus bloßer Achtung fürs praktische Gesetz hervor. Der Unterschied zwischen hypothetischem und kategorischem Imperativ wird angedeutet.
Worüber handelt der erste Abschnitt ("Über die Natur")?
Dieser Abschnitt untersucht die Natur und ihre Kausalität, die Heteronomie des Willens im Gegensatz zur Autonomie und die Konzepte von Zweck und Zweckmäßigkeit. Er legt den Grundstein für das Verständnis des Willens und der moralischen Handlungsfähigkeit im Kontext der Naturgesetze.
Worum geht es im zweiten Abschnitt ("Über die Freiheit")?
Der zweite Abschnitt befasst sich mit der Möglichkeit der Freiheit, der Autonomie des Willens als Grundlage der Moral, der Achtung vor dem Gesetz und den Konzepten von Endzweck und Selbstzweck. Die Frage nach der Möglichkeit von Freiheit im Rahmen der Kantischen Philosophie steht im Mittelpunkt.
Was wird im dritten Abschnitt ("Freiheit in der Erscheinung") behandelt?
Der dritte Abschnitt verbindet Freiheit und moralisches Gesetz mit der menschlichen Erfahrung. Die Würde des Menschen, die Möglichkeit seiner Demütigung und das "erhabene Gefühl" und dessen Bedeutung für das moralische Bewusstsein werden diskutiert. Die Freiheit in der Erscheinung wird hier mit der transzendentalen und empirischen Ebene der Kantischen Philosophie verknüpft.
Welche Schlüsselwörter sind für das Verständnis der Arbeit relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Pflicht, Autonomie, kategorischer Imperativ, Achtung, moralisches Gesetz, Freiheit, Vernunft, Wille, Zweck, praktische Philosophie, Kant.
Welche Zusammenfassung der Kapitel bietet die Arbeit?
Die Arbeit bietet für jedes Kapitel eine kurze, prägnante Zusammenfassung der behandelten Inhalte und Fragestellungen, die die zentralen Argumente und Ergebnisse jedes Abschnitts hervorhebt.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke konzipiert und eignet sich für Personen, die sich mit der praktischen Philosophie Kants auseinandersetzen möchten. Sie bietet eine strukturierte Übersicht über zentrale Themen und Konzepte.
- Citation du texte
- Magister Artium Wolfgang Schmeißer (Auteur), 2001, Pflicht! du erhabener großer Name... , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120645