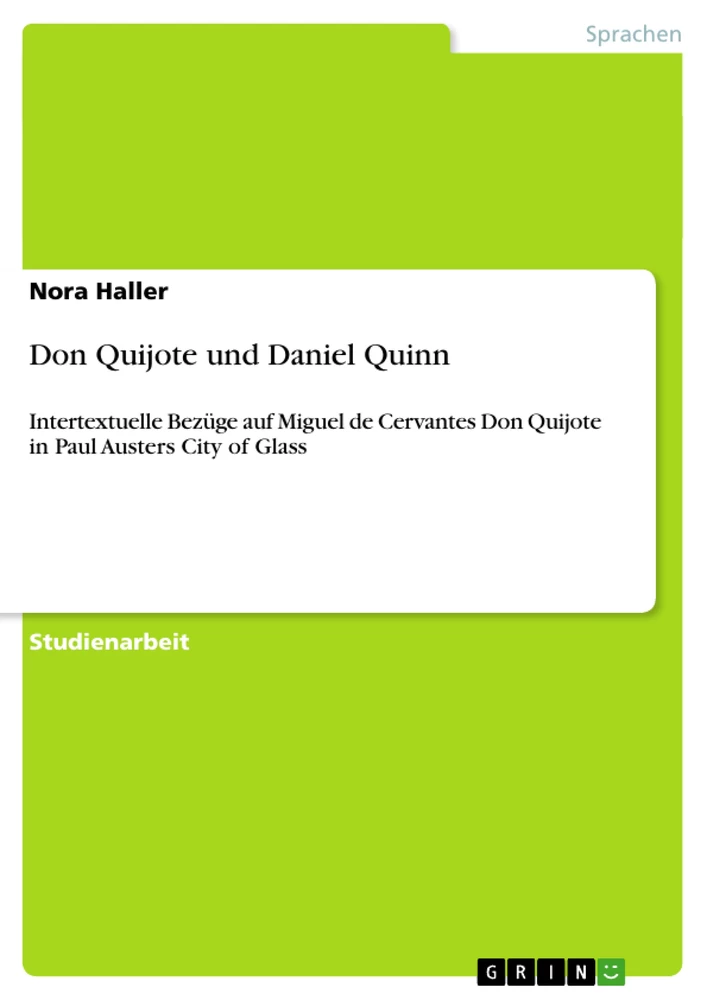Neben Calderón, Lope de Vega und Francisco de Quevedo ist Miguel de Cervantes wohl der wichtigste Literat des Siglo de Oro. Sein zweiteiliges Werk "El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha" schrieb Geschichte und gehört noch heute zum Kanon der Weltliteratur.
Es ist kein Wunder, dass dieser eigentliche Hypertext – um mit Genettes Begriffen zu arbeiten – zu einem Hypotext geworden ist. Viele Werke haben Jahrhunderte später Elemente dieses Romans wieder aufgenommen und sie neu verarbeitet. Flaubert mit seiner bücherkranken "Madame Bovary", Jorge Luis Borges in Gedichten wie "Sueña Alonso Quijano" oder "El testigo", Thomas Mann mit seinem Essay "Meerfahrt mit Don Quijote" (1934) und viele andere Schriftsteller haben sich von Don Quijote inspirieren lassen.
In der vorliegenden Arbeit soll nun ein weiteres Buch betrachtet werden, dessen Bezug zum Don Quijote bis lang noch nicht ausführlich untersucht wurde: Paul Austers "City of Glass", der erste Teil seiner "New-York-Trilogie" (1978).
Explizit bestätigte Paul Auster allerdings nie eine intertextuelle Beziehung zwischen Don Quijote und City of Glass. Dennoch, und gerade aus diesem Grund, möchte ich anhand dieser beiden Texte beweisen, dass dem so ist, um damit auch zu veranschaulichen, wie zeitlos und aktuell Cervantes Werk heute noch ist.
Dafür werde ich zunächst einige Begriffe von Gerard Genette klären, die mir für die folgende Untersuchung als besonders wichtig erscheinen. Anschließend werde ich die strukturellen und formalen Gemeinsamkeiten der beiden Romane herausarbeiten und dann auf den Inhalt eingehen. Ein Fazit wird die erarbeiteten Ergebnisse darstellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Drei Schlüsselbegriffe der Erzähltheorie nach Gérard Genette
- Transtextualität
- Fokalisierung und Stimme
- Kommunikationsmodell narrativer Texte
- Metalepse und Mise en abyme
- Paul Auster, City of Glass – Zusammenfassung des Inhalts
- Inhaltliche Bezüge auf Don Quijote in City of Glass
- Intertextualität in Form einer expliziten Anspielung
- Der Wahn der Bücher
- Strukturelle Bezüge auf Don Quijote in City of Glass
- Die Erzählkonstellation – Ein Spiel mit den Identitäten
- Zur Metalepse
- Die Bedeutungen der Namen
- Imitation und Transformation
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die intertextuellen Bezüge zwischen Miguel de Cervantes' Don Quijote und Paul Austers City of Glass. Ziel ist es, die zeitlose Aktualität von Cervantes' Werk aufzuzeigen und die Art und Weise zu beleuchten, wie Auster Elemente des Don Quijote in seinem Roman verarbeitet hat.
- Intertextualität zwischen Don Quijote und City of Glass
- Analyse der strukturellen und formalen Gemeinsamkeiten beider Romane
- Untersuchung der narrativen Strategien und der Rolle der Identität
- Die Bedeutung von Wahnsinn und Realität in beiden Werken
- Cervantes' Werk als Hypertext und seine Rezeption in der Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Entstehungszeit des Don Quijote ein und erläutert den Hintergrund des Werkes im Kontext des Siglo de Oro. Sie begründet die Wahl von City of Glass als Vergleichstext und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit. Das zweite Kapitel erklärt zentrale Begriffe der Erzähltheorie nach Gérard Genette, die für die Analyse relevant sind. Kapitel drei bietet eine kurze Zusammenfassung des Inhalts von City of Glass. Die Kapitel vier und fünf untersuchen die inhaltlichen und strukturellen Bezüge zwischen den beiden Romanen, fokussiert auf Intertextualität, narrative Strategien und die Thematik der Identität. Kapitel sechs beleuchtet die Aspekte der Imitation und Transformation.
Schlüsselwörter
Don Quijote, City of Glass, Paul Auster, Miguel de Cervantes, Intertextualität, Erzähltheorie, Gérard Genette, Identität, Wahnsinn, Realität, Siglo de Oro, Hypertext, Ritterroman, Satire.
Häufig gestellte Fragen
Welche Verbindung besteht zwischen Don Quijote und Paul Austers City of Glass?
Obwohl Auster es nie explizit bestätigte, weist City of Glass starke intertextuelle, strukturelle und inhaltliche Bezüge zum Don Quijote auf, insbesondere in der Thematik von Wahn und Identität.
Was bedeutet „Transtextualität“ nach Gérard Genette?
Transtextualität ist ein Oberbegriff für alles, was einen Text in Beziehung zu anderen Texten setzt, wie etwa Zitate, Anspielungen oder Gattungsbezüge.
Welche Rolle spielt der „Wahn der Bücher“ in beiden Romanen?
Sowohl Don Quijote als auch Daniel Quinn (in City of Glass) verlieren sich in der Welt der Bücher und beginnen, die Realität nach literarischen Vorbildern umzudeuten.
Was ist eine Metalepse in der Erzähltheorie?
Eine Metalepse bezeichnet den Grenzübergang zwischen verschiedenen Erzählebenen, etwa wenn der Autor selbst als Figur in der Geschichte auftaucht, wie es bei Auster und Cervantes der Fall ist.
Wie wird das Thema Identität in City of Glass verarbeitet?
Durch ein Spiel mit Namen und Rollen (Quinn wird zu Auster, der zu einem Detektiv wird) löst Auster die feste Identität seiner Hauptfigur auf, ähnlich wie Alonso Quijano zu Don Quijote wird.
Warum wird Don Quijote als „Hypotext“ bezeichnet?
Nach Genette ist ein Hypotext ein früherer Text, auf dem ein späterer Text (Hypertext) basiert oder auf den er sich bezieht, was die zeitlose Bedeutung von Cervantes' Werk unterstreicht.
- Arbeit zitieren
- Nora Haller (Autor:in), 2007, Don Quijote und Daniel Quinn, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120655