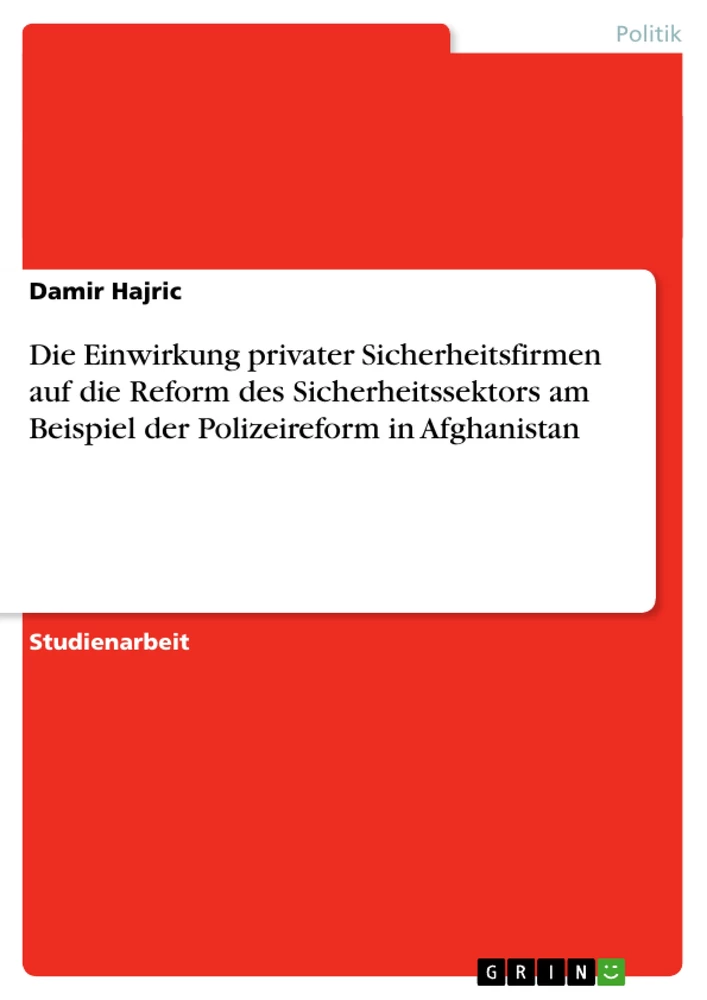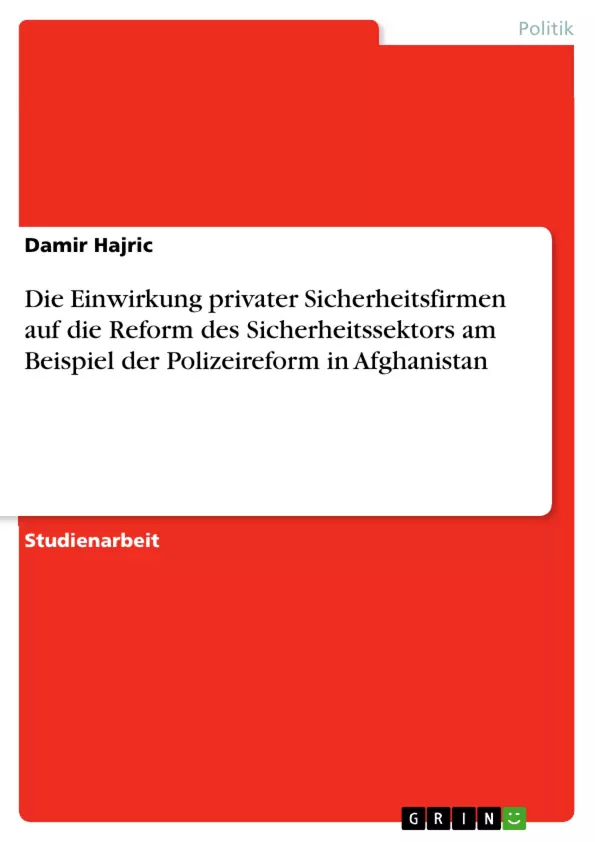In dieser Arbeit soll der Fokus auf die Polizeireform als eine der Säulen der Reform des
Sicherheitssektors gelegt werden. Das Ausbilden, die Personalbesetzung sowie ein unter dem
Aspekt der Nachhaltigkeit verlaufender Aufbau der Polizei stellen die vitalen Elemente für langfristige Gewährleistung der Sicherheit und damit für den Wiederaufbau des staatlichen
Gewaltmonopols dar. Diese Aufgabe erwies sich insofern als schwierig, als in Afghanistan die
Anzahl der nichtstaatlichen Konfliktakteure sehr hoch und dementsprechend die Haltung
gegenüber dem zentralen Staat bzw. zum Aufbau Afghanistans zu einem zentralen Staate
regressiv gewesen ist. Im Falle Afghanistans war zusätzlich zu bedenken, dass aus kollektiver
historischer Erfahrung heraus, jede durch Dritte unterstützte Stärkung staatlicher Strukturen von
der Bevölkerung als fortgesetzte militärische Intervention fremder Mächte betrachtet werden
könnte – es erforderte eine besondere Sensibilität, um eine langfristig effiziente, selbsttragende
sowie transparente und verantwortliche Polizei aufzubauen.
[...]
Um dieser Fragestellung nachgehen zu können, skizziere ich im ersten Teil des Hauptteils
der vorliegenden Arbeit das Konzept der Reform des Sicherheitssektors. Dabei wird der Fokus auf
den Wiederaufbau des Sicherheitssektors in Post-Konflikt-Situationen gesetzt. Hierdurch soll der
theoretische Rahmen für den zweiten, empirischen Teil des Hauptteils gegeben werden. Im
empirischen Teil dieser Untersuchung gilt es vorab den Kontext, in dem die Reform des
Sicherheitssektors statt zu finden hatte zu umreißen. Dabei wird der Schwerpunkt auf die
Komplexität der Sicherheitslage in Post-Taliban-Afghanistan und die Rolle der externen Akteure
in der Stärkung des informellen Sektors durch die unklare Strategie bei der Rekonstruktion des Sicherheitssektors gelegt. Angelehnt an die Thematik, diskutiere ich anschließend das von der
US-Regierung beauftragten privaten Sicherheitsfirma DynCorp International implementierte
Training der Polizei in Afghanistan. Hier beleuchte ich, wie sich zwar durch stärkere Involvierung
der Vereinigten Staaten quantitativ betrachtet die Situation der afghanischen Polizei verbesserte,
vor allem aber wie als Folge eines nicht auf die Zivilbevölkerung gerichteten sowie nicht auf
Nachhaltigkeit zielenden Trainings, bereits im Fundament der Aufbau einer nach demokratischen
Prinzipien funktionierenden Polizei gehemmt wurde.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Rekonstruktion des Sicherheitssektors im Rahmen des State-Building
- 2.1 Die Genese des Konzeptes
- 2.2 Das Konzept
- 2.3 Die Akteure, ihre Interessen und der Kontext
- 2.4 Die Prinzipien einer demokratischen Polizei
- 3. SSR in Afghanistan: Intensivierung des informellen Sektors statt des Staates
- 3.1 (Un)Sicherheit in Afghanistan und die Rolle der externen Akteure
- 3.2 SSR als Komplexitätssyndrom – und/oder die (Dys)Funktion der externen Akteure
- 4. contradictio in adjecto? Der US-amerikanische Einsatz der privaten Sicherheitsfirma DynCorp International bei der Aufbau der Polizei in Afghanistan
- 4.1 Divergierende Interessen: Die Polizeireform in Afghanistan
- 4.2 Quantität statt Qualität: Die Ausbildung der Polizeirekruten durch DynCorp International
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen privater Sicherheitsfirmen auf die Reform des Sicherheitssektors, speziell die Polizeireform in Afghanistan. Sie analysiert die Rolle dieser Firmen im Kontext des State-Building und beleuchtet die Herausforderungen und Konflikte, die durch ihr Engagement entstehen.
- Die Rolle privater Sicherheitsfirmen (PSCs) im State-Building
- Die Polizeireform in Afghanistan als Teil des Sicherheitssektorreform-Prozesses (SSR)
- Konflikte zwischen den Interessen der PSCs und den Zielen der Polizeireform
- Die Auswirkungen der Privatisierung von Sicherheitsaufgaben auf die Qualität der Polizeiarbeit
- Herausforderungen der Regulierung und Kontrolle privater Sicherheitsfirmen im internationalen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 (Einleitung): Die Einleitung beschreibt den Wandel der Sicherheitskonzepte nach dem Ende des Kalten Krieges und die zunehmende Bedeutung privater Sicherheitsfirmen. Sie führt in die Thematik der Privatisierung von Sicherheitsaufgaben und deren Auswirkungen auf den Staat ein.
Kapitel 2 (Rekonstruktion des Sicherheitssektors): Dieses Kapitel rekonstruiert das Konzept des State-Building und die Rolle des Sicherheitssektors darin. Es analysiert die beteiligten Akteure, deren Interessen und den Kontext, in dem die Reformen stattfinden.
Kapitel 3 (SSR in Afghanistan): Dieses Kapitel fokussiert auf die Sicherheitslage in Afghanistan und die Herausforderungen des SSR-Prozesses. Es beleuchtet die Rolle externer Akteure und die Komplexität des Problems.
Kapitel 4 (DynCorp International): Dieses Kapitel analysiert den konkreten Fall des Einsatzes von DynCorp International in der afghanischen Polizeireform, die divergierenden Interessen und die Kritik an der Ausbildungsqualität.
Schlüsselwörter
Sicherheitssektorreform, State-Building, Private Sicherheitsfirmen (PSCs), Polizeireform, Afghanistan, DynCorp International, good governance, (Un)Sicherheit, Konfliktforschung, Post-Konflikt-Situationen.
- Quote paper
- Bachelor of Arts Damir Hajric (Author), 2008, Die Einwirkung privater Sicherheitsfirmen auf die Reform des Sicherheitssektors am Beispiel der Polizeireform in Afghanistan, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120713