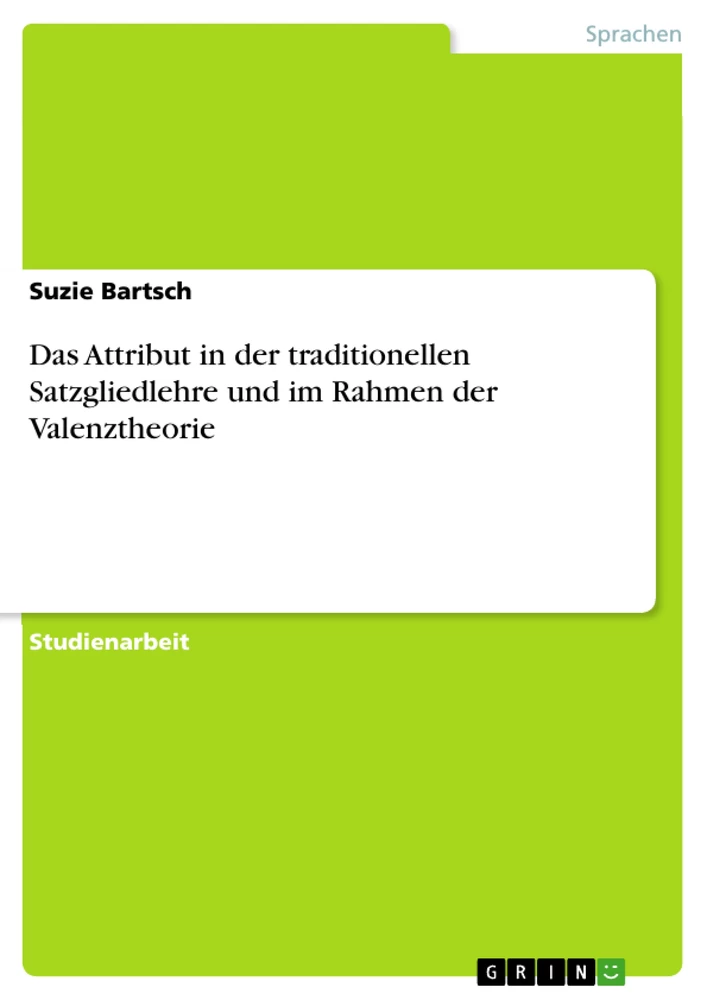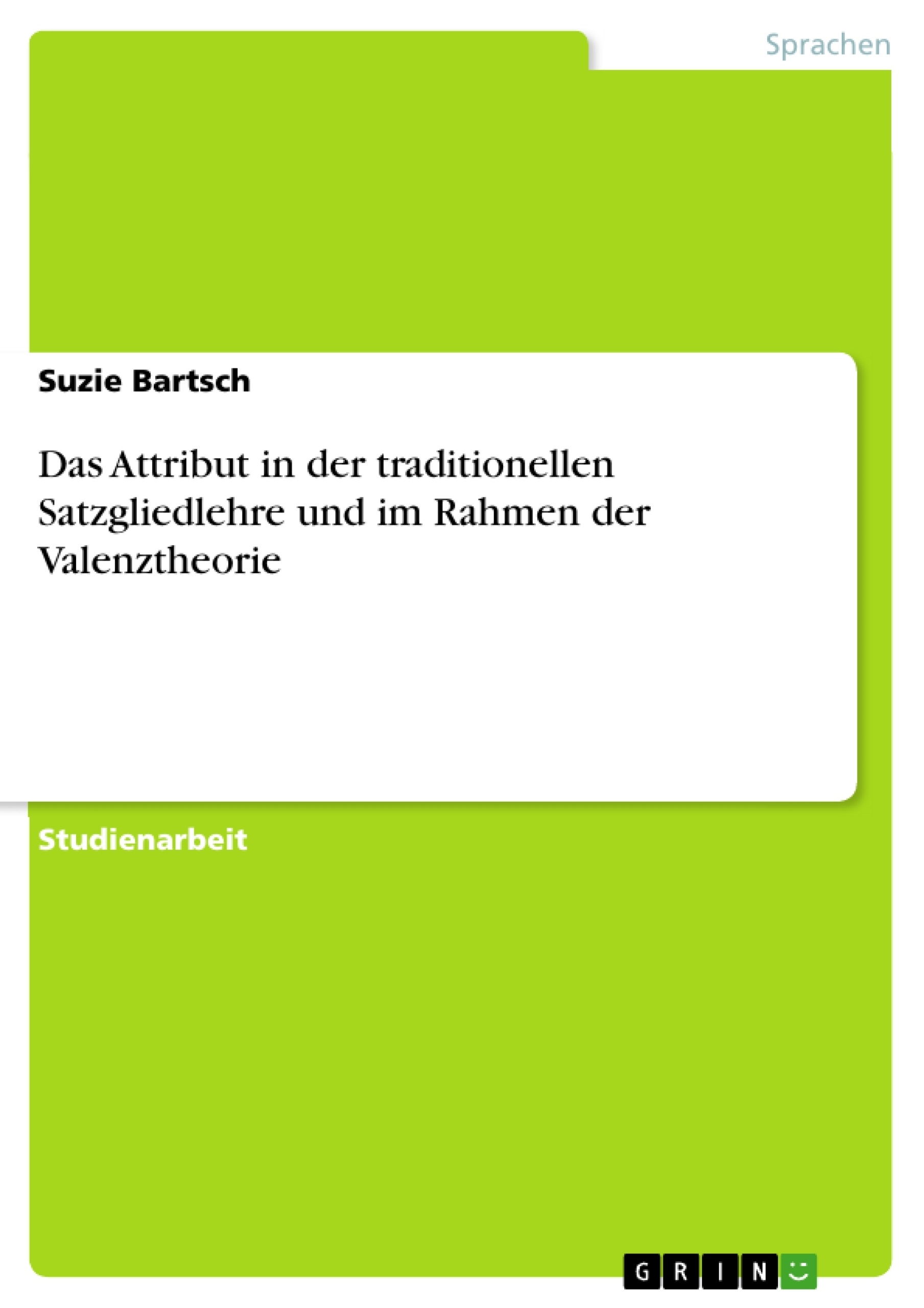In dieser Seminararbeit war mein ursprüngliches Anliegen, einen Vergleich von grammatischen Modellen am Beispiel der syntaktischen Relation des Attributs zu unternehmen.
Ich wollte in dieser Arbeit das zu verwirklichen versuchen, was ich bereits für den Vortrag vorgehabt und doch nicht erreicht hatte: Es sollte hier eine Art Querschnitt durch grammatische Theorien versucht werden, und zwar mit dem Ziel, deren wichtigsten Vorzüge und Nachteile gegenüberzustellen und zu diskutieren.
Anfangen wollte ich bei der traditionellen Satzgliedlehre in ihrer moderneren Ausformung, wie sie z. B. in WÖLLSTEIN-LEISTEN [u.a.] (1997) und HELBIG/BUSCHA (1993) zu finden ist. Darauf würde ich mich mit dem Begriff des Attributs innerhalb eines valenztheoretischen Rahmens beschäftigen, wie es von ENGEL (1994) und WELKE (1988) plädiert wird. Anschließend sollten generativistische Darlegungen im Rahmen der Rektions- und Bindungstheorie - wie z. B. bei FANSELOW/FELIX (1993-2) - und funktionalistische Ansätze - wie z. B. bei GIVÓN (1984 und 1990) - diskutiert werden.
Diese Reihenfolge von theoretischen Ansätzen sollte und dürfte nicht in einem positivistischen Sinne verstanden werden. Das heißt: mit dieser Reihenfolge wollte ich keineswegs für eine ‚evolutionistische′ Ansicht zur Entwicklung von grammatischen Theorien nach dem Motto ‚von niederen zu höheren Formen′ oder ähnliches plädieren. Es sollte sich schlicht und einfach um eine halbwegs chronologische Reihenfolge handeln.
Allerdings ist es tatsächlich kaum möglich und außerdem auch nicht gerade angebracht, sich mit verschiedenen Auffassungen zu einem Phänomen zu beschäftigen, ohne dabei ideologisch vorzugehen, d.h. ohne Werturteile zu fällen und Präferenzen zu entwickeln. Leider Gottes stellt man aber in der Linguistik und in anderen Wissenschaften - ebenso wie so oft im alltäglichen Leben - häufig fest, daß in vielen Fällen eine ‚fundamentalistische′ Praxis herrscht: eine bestimmte Theorienrichtung wird gewissermaßen als die ‚einzig Richtige′ präsentiert, während alle andere fast von vornherein und nicht selten nur aufgrund deren Herkunftslagers als abwegig abgetan werden.
Ich wollte mich in dieser Arbeit für eine differenziertere Verhaltens- und Verfahrensweise aussprechen, nämlich für eine kritische Auseinandersetzung mit unterschiedlichen grammatischen Modellen.
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
0. Einleitung
1. Das Attribut in der traditionellen Satzgliedlehre
1.1 Syntaktische und semantische Charakterisierung
1.1.1 Syntaktische Gebundenheit
1.1.2 Prädikative Eigenschaft
1.1.3 Vorrang des semantischen Kriteriums
1.1.4 Verwirrung in der Definitions- und Terminusgebung
1.2 Typisierung des Bezugselements
1.2.1 Die ältere Auffassung
1.2.2 Die neuere Auffassung
1.3 Typisierung des Attributs
1.4 Zwischenfazit
2.Das Attribut im Rahmen der Valenztheorie
2.1. Formale Charakterisierung von Valenz und das Attribut
2.2 Semantischer und funktional-pragmatischer Valenzbegriff und das Attribut
3.Fazit
Literaturangaben
0. Einleitung
In dieser Seminararbeit war mein ursprüngliches Anliegen, einen Vergleich von grammatischen Modellen am Beispiel der syntaktischen Relation des Attributs zu unternehmen.
Ich wollte in dieser Arbeit das zu verwirklichen versuchen, was ich bereits für den Vortrag vorgehabt und doch nicht erreicht hatte: Es sollte hier eine Art Querschnitt durch grammatische Theorien versucht werden, und zwar mit dem Ziel, deren wichtigsten Vorzüge und Nachteile gegenüberzustellen und zu diskutieren.
Anfangen wollte ich bei der traditionellen Satzgliedlehre in ihrer moderneren Ausformung, wie sie z. B. in Wöllstein-Leisten [u.a.] (1997) und Helbig/Buscha (1993) zu finden ist. Darauf würde ich mich mit dem Begriff des Attributs innerhalb eines valenztheoretischen Rahmens beschäftigen, wie es von Engel (1994) und Welke (1988) plädiert wird. Anschließend sollten generativistische Darlegungen im Rahmen der Rektions- und Bindungstheorie – wie z. B. bei Fanselow/Felix (1993-2) – und funktionalistische Ansätze – wie z. B. bei Givón (1984 und 1990) – diskutiert werden.
Diese Reihenfolge von theoretischen Ansätzen sollte und dürfte nicht in einem positivistischen Sinne verstanden werden. Das heißt: mit dieser Reihenfolge wollte ich keineswegs für eine ‚evolutionistische‘ Ansicht zur Entwicklung von grammatischen Theorien nach dem Motto ‚von niederen zu höheren Formen‘ oder ähnliches plädieren. Es sollte sich schlicht und einfach um eine halbwegs chronologische Reihenfolge handeln.
Allerdings ist es tatsächlich kaum möglich und außerdem auch nicht gerade angebracht, sich mit verschiedenen Auffassungen zu einem Phänomen zu beschäftigen, ohne dabei ideologisch vorzugehen, d.h. ohne Werturteile zu fällen und Präferenzen zu entwickeln. Leider Gottes stellt man aber in der Linguistik und in anderen Wissenschaften – ebenso wie so oft im alltäglichen Leben – häufig fest, daß in vielen Fällen eine ‚fundamentalistische‘ Praxis herrscht: eine bestimmte Theorienrichtung wird gewissermaßen als die ‚einzig Richtige‘ präsentiert, während alle andere fast von vornherein und nicht selten nur aufgrund deren Herkunftslagers als abwegig abgetan werden.
Ich wollte mich in dieser Arbeit für eine differenziertere Verhaltens- und Verfahrensweise aussprechen, nämlich für eine kritische Auseinandersetzung mit unterschiedlichen grammatischen Modellen. ‚ Kritisch‘ bedeutet m. E. nicht nur, auf Schwachstellen bestimmter Theorien aufmerksam zu machen – was übrigens vielfach ohne genügende Sach- und Hintergrundkenntnis getrieben wird –, sondern auch deren Pluspunkte herauszustellen, denn nur so kann es erreicht werden, daß ganz oder teilweise, tatsächlich oder nur scheinbar gegensätzliche Theorien mittels sachlicher und möglichst unvoreingenommener Überlegungen sich gegenseitig befruchten und bereichern.
Die Begründung dafür ist, daß es meiner Meinung nach sehr wünschenswert ist, der erstarrten Orthodoxie entgegenzuwirken, die in der Wissenschaft – wie auch im Alltag – teilweise herrscht, indem eine ‚eklektische‘ Haltung bezogen wird. Dabei denke ich keineswegs an die negativ besetzte Bedeutung des Wortes ‚Eklektismus‘, wie es im deutschen Sprachgebrauch verstanden wird als einfallslose und unschöpferische „Zusammenstellung von verschiedenen Gedanken od. Stilelementen zu etwas scheinbar Neuem“ [1]. Ich denke an die ursprünglich neutrale Bedeutung des griechischen Verbs eklegein (‚auswählen; auslesen‘), und an die in einigen romanischen Sprachen positive Bedeutung des Substantivs ‚Eklektismus‘ als kritische und kreative Kombination von Elementen aus unterschiedlichen Systemen zu einem differenzierten, neuartigen, ‚ökumenischen‘ Gefüge.
Bezogen auf grammatische Modelle kann dieser Anspruch im Rahmen einer Hauptseminar-Arbeit selbstverständlich nicht eingelöst werden. Es sollte hier kein neuartiges Syntaxmodell vorgestellt werden. Alles, was ich versuchen wollte, war, von einem ‚synkretistischen‘ Gesichtspunkt ausgehend, verschiedene Theorienrichtungen möglichst vorurteilslos aber mit kritischem Auge miteinander zu vergleichen, und zwar am Beispiel derer Auffassungen zum Attribut. Die klassiche Satzgliedlehre sollte dabei ausführlicher als die anderen Modelle behandelt werden, da sie die Grundlage bzw. Ausgangspunkt für einen Vergleich zu anderen Ansätzen bildet. Oder anders ausgedrückt: die Entwicklung vieler anderer Ansätze ergeben sich vielfach aus dem Versuch, Problemen gerechtzuwerden, die in der traditionellen Satzlehre ungelöst bleiben bzw. nicht zufriedenstellend gelöst werden. Das anzustrebende Ergebnis dieser Arbeit war, einige Punkte herauszustellen, in denen sich diese Theorien möglicherweise ergänzen können.
Es stellte sich aber schnell heraus, daß die bestrebte modellvergleichende Analyse des Attributs selbst ein zu anspruchsvolles Unterfangen für eine Seminararbeit darstellt, denn sie führt notgedrungen zu Überlegungen, Problemen und Erkenntnissen, die die Analyse des ganzen Satzes betreffen, d. h. zu zentralen Fragen der Syntax, die wiederum sehr umfassende Antworten verlangen.
Aus diesem Grunde beschränkt sich die vorliegende Analyse des Attributs auf das Satzgliedmodell – weiterhin verstanden als Ausgangspunkt zum Modellvergleich – und das Valenzmodell (allerdings mit einigen Verweisen auf funktionale Ansätze), denn schon diese beiden Modelle liefern eine ganze Menge an interessanten Reflexionen, Fragen und gegenseitigen Ergänzungsmöglichkeiten.
Die vorliegende Arbeit soll darum nicht als abgeschlossenes Ganzes verstanden werden, sondern eher als eine mehr oder minder systematisch angelegte Sammlung von Überlegungen, die ein Teil eines größeren Vorhabens darstellen, das hier unvollendet bleiben muß.
1. Das Attribut in der traditionellen Satzgliedlehre
1.1 Syntaktische und semantische Charakterisierung
1.1.1 Syntaktische Gebundenheit
In der deutschen Satzgliedlehre werden Attribute als Satzgliedteile bezeichnet, im Gegensatz zu den Satzgliedern, wie Subjekt, Objekt oder Adverbialbestimmung, wobei sich diese Abgrenzung in manchen Werken stark vereinfachend nur auf formalen Kriterien stüzt.
So ist beispielsweise bei Wöllstein-Leisten [u.a.] (1997:41) einerseits von einer stellungsmäßigen Gebundenheit des Attributs an ihr Bezugselement die Rede. Wöllstein-Leisten [u.a.] (1997) beziehen sich hier auf die allgemein anerkannte Beobachtung, daß das Attribut bei der Umstellprobe, anders als Satzglieder, im allgemeinen nicht allein verschoben werden kann, sondern nur mit dem ganzen Satzglied, in dem es vorkommt:
(1a)Gummistiefel sind bei feuchtem Wetter ratsam.
(1b)→ Bei feuchtem Wetter sind Gummistiefel ratsam. [Adverbialbestimmung]
(1c)→* feuchtem sind Gummistiefel bei Wetter ratsam. [Attribut]
Andererseits erwähnen Wöllstein-Leisten [u.a.] (1997:41) die Fakultativität, das „freie Auftreten“ der Attribute als ein weiteres formales Argument dafür, Attribute als Satzgliedteile anzusehen. Die Autoren erklären nicht weiter, wie sie Fakultativität verstehen; nach ihren Beispielen zu beurteilen, scheinen sie Fakultativität mit genereller Weglaßbarkeit – sofern das Weglassen keine ungrammatische Konstruktion erzeugt – gleichzusetzen. Nach dieser Interpretation wären Attribute immer weglaßbar, da ihr Nicht-Vorkommen die Grammatikalität der betreffenden Konstruktion niemals beeinträchtigen würde. Wie pauschal eine solche Ansicht ist, wird v. a. im valenzorientierten Rahmen klar, wobei allerdings einige Phrasen, die tradionellerweise als Attribute bezeichnet werden, unter Beachtung von Valenzeigenschaften nicht länger als solches gesehen werden können, wie wir noch sehen werden. Aber selbst ohne bezug auf Valenzeigenschaften finden sich viele Beispiele, in denen ein Attribut sinnotwendig ist, d.h. nicht weggelassen werden kann, sollte die Konstruktion weiterhin ihre Grammatikalität beibehalten:
(1d)→ *Gummistiefel sind bei Wetter ratsam.
Außerdem ist Weglaßbarkeit nicht nur bei Attributen möglich. Auch Adverbialbestimmungen – die unumstritten Satzglieder darstellen – sind vielfach, ja sogar meistens weglaßbar.
Aber davon einmal abgesehen, sind Fakultativität und Sinnotwendigkeit schwer zu erfassende und zu handhabende Begriffe, die in vielen Fällen nur als zusätzliche Kriterien herangezogen werden sollten. Mehr dazu im 2. Kapitel.
1.1.2 Prädikative Eigenschaft
Bei Helbig/Buscha (1993:585f.) ist eine differenziertere Betrachtungsweise zu finden: dort kommt außer dem stellungsmäßigen Unterschied zu den Satzgliedern (bei diesen Autoren ist von Fakultativität nicht die Rede) auch jene semantische Eigenschaft des Attributs zur Sprache, die einer alten und zutreffenden Intuition entspricht, nämlich: daß Attribute nähere Bestimmungen von ihrem Bezugselement darstellten.
Diese Intuition spiegelt sich wieder in der lateinischen Bezeichnung attributum mit der Bedeutung ‚das beigelegte [Merkmal] ‘ (< attribuere ‚zuschreiben, beilegen, hinzufügen‘) und auch im deutschen Terminus Beifügung.
Helbig/Buscha (1993:585) werden dieser Intuition gerecht, indem sie das Attribut als „eine potentielle Prädikation“ charakterisieren, und zwar eine Prädikation „ zu einem Wort, das nicht Verb ist“. So wird im Beispiel (1) das Nomen ‹ Wetter › durch das Adjektiv ‹ feucht › semantisch näher bestimmt. Genauer: dem Referenten (dem Sachverhalt) ‹ Wetter › wird die Prädikation (die Eigenschaft) ‹ feucht › zugesprochen.
1.1.3 Vorrang des semantischen Kriteriums
Die vorrangige Wirksamkeit des semantischen Kriteriums gegenüber dem syntaktischen wird bei der Analyse des sog. ‚prädikativen Attributs‘ deutlich: dieses weist wegen seiner freien Permutierbarkeit zwar Satzgliedcharakter auf, wird aber aufgrund seiner prädikativen Eigenschaft gegenüber seinem Bezugselement als Attribut angesehen; dieses Bezugselement darf kein Verb sein, was das prädikative Attribut wiederum von den Adverbialbestimmungen unterscheidet (vgl. Helbig/Buscha 1993:585f. und 554f.):
(2a)Er starb jung. [Prädikatives Attribut zum Subjekt]
(2b)→ Als er starb, war er jung.
(2c)→ * Sein Sterben/Tod war jung.
(3a) Er starb qualvoll. [Adverbialbestimmung]
(3b)→ Sein Sterben/Tod war qualvoll.
(3c)→ * Als er starb, war er qualvoll.
Auf indirekter Weise verweisen auch Wöllstein-Leisten [u.a.] (1997:44) auf diese prädikative Eigenschaft, wenn sie das prädikative Attribut – von ihnen gar nicht einmal zu Unrecht „Subjekts- und Objektsattribut“ genannt –, entgegen der eingangs von ihnen gestellten Bedingung der syntaktischen Gebundenheit, als einen Typ von Attribut vorstellen, denn sie berufen sich dabei – allerdings nur ziemlich vage – auf eine „modifizieren [de] “ Eigenschaft des „Subjekts- und Objektsattributs“.
1.1.4 Verwirrung in der Definitions- und Terminusgebung
Wöllstein-Leisten [u.a.] (1997) scheinen so einer nicht verkehrten Intuition Folge zu leisten, wenn sie die Bezeichnung ‚prädikatives Attribut‘ ablehnen und stattdessen von ‚Subjekts- und Objektsattribut‘ reden. Aufgrund der Vagheit in ihrer Kriteriensetzung sind die Autoren aber nicht in der Lage, die logische Begründung dafür anzugeben, daß nämlich die Bezeichnung ‚prädikatives Attribut‘ an sich irreführend ist, da jedes Attribut semantisch gesehen nun einmal prädikative Eigenschaften innehat.
Das Problem hier ist, daß der Zusatz ‚prädikativ‘ bei der Bezeichnung ‚prädikatives Attribut‘ wohl doch nicht nur mit dessen semantischen, sondern auch mit dessen syntaktischen Eigenschaften zu tun hat: das prädikative Attribut verhält sich nämlich semantisch (nähere Bestimmung eines Bezugselements) und syntaktisch (freie Permutierbarkeit) wie das sog. ‚Prädikativum‘:
[Prädikatives Attribut zum Subjekt]
(2a) Er starb jung.
(2d)→ Jung starb er.
[Subjektsprädikativum]
(4a) Der Transrapid ist zweifellos eines der Lieblingsspielzeuge aller Technikgläubigen.
(4b)→ Eines der Lieblingsspielzeuge aller Technikgläubigen ist zweifellos der Transrapid.
‚Prädikativum‘ stellt allerdings aus dem bereits genannten Grund eine weitere irreführende Bezeichnung in der deutschen Satzlehre dar, denn: das Merkmal [+prädikativ] ist sowohl für Prädikativa, wie auch für Attribute und prädikative Attribute konstitutiv. Die Bezeichnung ‚Prädikativum‘ wird aber bisweilen indirekt auch dadurch erklärt, daß es sich dabei um einen Sinnteil des zusammengesetzten Prädikats – in welchem das Verb semantisch leer ist – handelt (vgl. z.B. Helbig/Buscha 1993:539) .
In bezug auf die (syntaktisch gebundenen) Attribute sorgen auch Helbig/Buscha (1993:585) für ein wenig Verwirrung, denn sie vermengen formale und inhaltliche Eigenschaften, wenn sie sagen, daß das Attribut „grundsätzlich eine potentielle Prädikation [ist] [...] , d.h., es läßt sich auf eine prädikative Grundstruktur zurückführen“[2]. Denn sie beziehen sich dabei – allerdings ohne es zu explizieren – auf das semantische Merkmal [+prädikativ ] und zugleich auf die Fähigkeit des syntaktisch gebundenen Attributs, mittels Transformationen zu einem syntaktisch frei umstellbaren Prädikativum zu werden:
(1a) Gummistiefel sind bei feuchtem Wetter ratsam. [Attribut]
(1d)→Wenn das Wetter feucht ist, sind Gummistiefel ratsam. [Prädikativum]
(5a) Das Wetter ist feucht. [Prädikativum]
(5b)→ Feucht ist das Wetter.
Um der Verwirrung in der Definitions- und Terminusgebung entgegenzuwirken, könnte man sich eventuell bei allen drei Fällen – Attribut, Prädikativum, prädikatives Attribut –, auf dem semantischen Kriterium basierend, für eine einzige Bezeichnung entscheiden: entweder ‚Attribut‘ oder ‚Prädikativum‘, da beides etymologisch gesehen dem semantischen Merkmal der Prädikation gerecht würden. Zur Abgrenzung zur Adverbialbestimmung müßte man hinzufügen, daß das Bezugselement des Attributs bzw. Prädikativs kein Verb sein darf. Dann müßte man nur noch zwischen syntaktisch freiem und gebundenem Attribut bzw. Prädikativum unterscheiden.
Aber selbst die Adverbialbestimmung könnte man – aufgrund des semantischen Kriteriums – zusammen mit Attribut, Prädikativum und prädikativem Attribut in einen Topf werfen (wie es im übrigen in der Schulgrammatik mancher Sprachen z.T. der Fall ist; siehe nächste Seite), denn auch sie stellt eine Prädikation dar, wenn auch meist zu einer zweiten, höherstehenden Prädikation (=dem Prädikat im konkreten Fall). Dies ist im übrigen keine Besonderheit der Relation zwischen Prädikat und Adverbialbestimmung: adjektivische Attribute beispielsweise können auch durch eine weitere, untergeordnete Prädikation näher bestimmt werden (siehe dazu die Abschnitte 1.2 und 1.3).
Es ließe sich natürlich streiten, ob es sich gerechtfertigt, primär von semantischen Kriterien auszugehen, wenn man eigentlich syntaktische Kategorien erläutern will. Tatsache ist, daß in der Praxis semantische Merkmale vielfach für die Definierung syntaktischer Erscheinungen herangezogen werden (müssen), und daß dies – wie an den Ansätzen von Wöllstein-Leisten [u.a.] (1997) und Helbig/Buscha (1993) demonstriert wurde – nicht immer mit genügender Genauigkeit in der Abgrenzung zu den syntaktischen Eigenschaften praktiziert wird.
Es ist vielleicht nicht uninteressant, zu erwähnen, daß in der traditionellen Syntax mancher Sprachen, die – anders als das Deutsche – keine freie Serialisierung kennen, die semantische Eigenschaft der Prädikation von großer Bedeutung für die syntaktische Analyse von Attribut und Adverbialbestimmung und die dabei verwendete Terminologie ist. Allerdings kommt es auch in diesen Sprachen zu einer Vermengung von semantischen und formalen Eigenschaften.
So redet man beispielsweise in der brasilianisch-portugiesischen Schulgramamatik, aufgrund der prädikativen Determinationsbeziehung, von ‚adjunto‘ (< lat. adiungere ‚an-, bei-, zufügen‘), wobei zwischen ‚adjunto adnominal‘ (näherer Bestimmung eines Nomens) und ‚adjunto adverbial‘ (näherer Bestimmung eines Verbs, Adverbs oder Adjektivs durch ein Adverb) unterschieden wird (vgl. Leme [u.a.] 1981:104ff.). Interessant ist hier die (semantisch basierte) Gleichbehandlung von Adverbialbestimmung und Attribut. Allerdings wird die Bezeichnung ‚adjunto adnominal‘ nur für diejenigen prädikativen Konstruktionen verwendet, die das Nomen unmittelbar – d. h.: nicht über das Verb – determinieren, was in der deutschen Terminologie dem Attribut entspricht. Wenn ein Nomen durch eine prädikative Konstruktion über das Verb modifiziert wird – im Deutschen handelt es sich um das Prädikativum und das prädikative Attribut –, so redet man in der ‚Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB)‘ (der Brasilianischen Grammatischen Terminologie) von ‚predicativo‘.
1.2 Typisierung des Bezugselements
1.2.1 Die ältere Auffassung
Das Element, das durch die attributive Prädikation näher bestimmt wird, wurde in bezug auf seine Realisierung bis jetzt bewußt nur als ‚Bezugselement‘ erwähnt, das kein Verb sein darf. Dies soll nun präzisiert werden.
Bei Wöllstein-Leisten [u.a.] (1997:41) werden Attribute als „Teile einer Nominalphrase“ definiert, als ob das Satzglied, in dem Attribute vorkommen, ausschließlich Nominalphrasen wären, und das Bezugselement somit nur durch (Pro-)Nomina realisiert würden. In der Tat entspricht dies einer längst überholten Annahme, deren Weiterbestehen in einem solchen neuen Werk auf den ersten Blick Verwunderung hervorruft. Wenn man aber das Gesamtanliegen der Autoren und dessen tatsächlichen Verwirklichung in Betrachtung zieht, kommt man schnell zum Schluß, daß es nicht anders werden könnte.
Wöllstein-Leisten [u.a.] (1997) versuchen nämlich Prämissen der klassischen Satzlehre mit Elementen aus „verschiedenen Grammatiktheorien“, „deren Einsichten entweder bereits allgemein anerkannt sind oder die Grundlage für die gegenwärtige Diskussion sind“, zu vereinbaren, wie es im Vorwort vorangekündigt wird (Wöllstein-Leisten [u.a.] 1997:1). Dies ist, in Hinblich auf die philosophisch-methodologische Orientierung, wie sie in der Einleitung zur vorliegenden Seminararbeit dargelegt ist, an sich ein lobenswertes Vorhaben. In ihren Darlegungen beziehen sich die Autoren allerdings – abgesehen von der traditionellen Satzlehre – beinahe nur auf die Generative Grammatik, wobei dieser Bezug vielfach nicht über den terminologischen Bereich hinausgeht.
Vor diesem Hintergrund ist es nicht weiter verwunderlich, daß die ältere, vereinfachte Auffassung vom Attribut als „nicht selbständige nähere Bestimmung von nominalen Satzgliedern “ (Bussmann 1990:108; Hervorhebung von mir) bei Wöllstein-Leisten [u.a.] (1997) bloß durch den in der GG gängigen – allerdings von ihr nicht geprägten – Terminus ‚Phrase‘ bereichert erscheint.
1.2.2 Die neuere Auffassung
Bei Helbig/Buscha (1993) ist wieder eine differenziertere Betrachtungsweise festzustellen, die einer neueren, zutreffenderen Auffassung von Attribut entspricht, in welcher das Bezugselement zwar meist ein (Pro-)Nomen ist, Attribute aber allgemein als „Beifügungen zu jeder syntaktischen Kategorie im Satz (mit Ausnahme des Verbs [sic!][3] )“ verstanden werden (vgl. Bussmann 1990:108). Von der Erkenntnis, daß das Bezugselement verschiedenen syntaktischen Kategorien entsprechen kann, leitet sich eine zweite Erkenntnis ab, nämlich, daß es sich auch durch unterschiedliche Wortarten und Phrasenstrukturen realisieren läßt.
Helbig/Buscha (1993:596 und 604ff.) führen diesen Gedanken allerdings nicht weit genug, denn außer Substantiven und substantivischen Pronomina führen diese Autoren nur noch Adverbien als Beispiele an:
(6) Streuobstwiesen zählen zu den am meisten gefährdeten Biotopen.
(7) Wer in diesem Raum ist gegen den Transrapid?
(8) Dort am Wald liegt die Streuobstwiese.
Bei Anwendung des semantischen Kriteriums der Prädikation können auch zwei andere Beispiele angeführt werden: auch Adjektive (darunter adjektivisch gebrauchte Partizipien) und ganze Sätze können nämlich durch ein Attribut näher bestimmt bzw. modifiziert werden.
(9) Der Transrapid ist zu teuer.
(10) Streuobstwiesen zählen zu den am meisten gefährdeten Biotopen.
(11) Der für Streuobstwiesen typische Unterwuchs aus Kräutern, Gräsern und Wiesenblumen kann sich hier ungehindert entwickeln, ein Beispiel, wie sich Ökolandbau mit Natur- und Umweltschutz verbinden läßt.
Interessant ist dabei festzustellen, daß eine Prädikation (z.B. realisiert durch ein Adjektiv) selbst durch eine weitere Prädikation modifiziert werden kann. Das heißt m. a. W.: das Bezugselement des Attributs ist zwar meist ein referentieller Ausdruck (d. h.: ein Ausdruck, der sich auf Personen, Dinge und Sachverhalte der realen Welt bzw. des Konzeptsystems im menschlichen Bewußtsein bezieht; Beispiel 6) oder ein propositioneller Ausdruck (ein Prädikat mitsamt seiner Argumente; Beispiel 11), es kann aber durchaus selbst ein (höher stehender) prädikativer Ausdruck sein (Beispiel 9 und 10).
Im Satz (9) beispielsweise stellt das Nomen ‹Transrapid› einen Referenten dar, welchem die Hauptprädikation ‹teuer› zugesprochen wird; diese Hauptprädikation wird wiederum durch die untergeordnete Prädikation ‹zu› modifiziert, und zwar im Sinne einer Intensivierung. In diesem Sinne sind auch Adverbialbestimmungen dem Attribut sehr nah, denn Adverbialbestimmungen modifizieren entweder eine übergeordnete Prädikation (das Prädikat) oder einen Sachverhalt (die gesamte Proposition bestehend aus Prädikat und Argumenten).
1.3 Typisierung des Attributs
Nachdem das Attribut auf semantische und syntaktische Eigenschaften, und das Bezugselement auf seine Realisierung und Charakterisierung untersucht wurden, stellt sich die Frage danach, wie die Attribute selbst typisiert werden können.
Wöllstein-Leisten [u.a.] (1997: 41ff.) stellen folgende Typen vor:
Adjektiv-, Genitiv-, Präpositional-, Adverb-, Partizipialattribut, Attributsatz, Apposition, Juxtaposition, Subjekts- und Objektsattribut.
Ein kurzer Blick auf diese Liste genügt, um festzustellen, daß – trotz ihrer weitgehenden Vollständigkeit – ihr verschiedene Kriterien (Realisierung durch Wortarten bzw. Phrasentypen; morphologischer Kasus; Serialisierungseigenschaften; syntaktische Funktion des Bezugselements) unsystematisch zugrundegelegt werden.
Wieder einmal ist bei Helbig/Buscha (1993:585ff.) eine anspruchsvollere Darlegung zu finden, die durch untenstehende Tafel vereinfacht wiedergegeben wird:
(12)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(12aa) Der für Streuobstwiesen typische Unterwuchs aus Kräutern, Gräser und Wiesenblumen kann sich dort ungehindert entwickeln.
(12ab) Dort kann sich ein Unterwuchs bunt blühender Kräuter, Gräser und Wiesenblumen ungehindert entwickeln.
(12ba) Alles begann mit der Entdeckung einer sechzig Jahre alten Streuobstwiese in Ruhlsdorf.
(12bb) Wir bieten eine intensive Unterstützung durch hauptamtliche Mitarbeiter.
(12bc) Nach 40 Jahren Nutzung wurde die Streuobstwiese sich selbst überlassen.
(12bda) Unterstützen Sie auch das Projekt Streuobstwiese !
(12bdb) Dort kann sich ein Unterwuchs bunt blühender Kräuter, Gräser und Wiesenblumen – ein Paradies vieler Tierarten – ungehindert entwickeln.
(12c) Alles begann mit der Entdeckung einer sechzig Jahre alten Streuobstwiese in Ruhlsdorf.
(12d) Wir bemühen uns auf geleiteten Geländeführungen, sehbehinderten Menschen die Möglichkeit zu geben, Natur auf ganz eigene Art und Weise zu erleben.
(12e) Streuobstwiesen bezeichnen die traditionelle Form des Obstanbaus, bei der hochstämmige, robuste Obstbäume verschiedener Sorten wie ‚verstreut‘ in großen Abständen auf einer Wiese stehen.
Hierzu sind folgende Anmerkungen anzustellen[4]:
A. Wie den Beispielen zu entnehmen ist, erscheinen Attribute vielfach in einer mehrgliedrigen Form, was sich – wie Helbig/Buscha (1993:599) richtig anmerken – durch „notwendige“ oder „nichtnotwendige Erweiterungsglieder“ im Sinne einer sekundären Valenz ergeben kann. Im Satz (12aa) z.B. wäre die PP ‹ für Streuobstwiesen › ein notwendiges (wenn auch fakultatives) Erweiterungsglied zum attributivem Adjektiv ‹ typische ›, während das Adjektiv ‹ bunt› im Satz (12ab) ein nichtnotwendiges Erweiterungsglied zum adjektivisch gebrauchten Partizip Präsens ‹ blühender › darstellen würde.
B. Merkwürdigerweise verweisen Helbig/Buscha (1993:591ff.) nicht darauf, daß gerade die sog. ‚Genitiv- und Präpositionalattribute‘ (12ba und 12bb) in vielen Fällen eher in einem valenzorientierten Rahmen adäquat zu erläutern sind. Nach Helbig/Buscha (1993) wäre z.B. im Satz (12ba) bloß vom Objekt-Prädikats-Verhältnis des attributiven Genitivus objectivus ‹ einer sechzig Jahre alten Streuobstwiese in Ruhlsdorf › zum Bezugswort ‹ Entdeckung › die Rede, aber nicht daß ein deverbales Nomen die Valenzeigenschaften des zugrundeliegenden Verbs übernehmen kann, die sich dann in Form von Nominalphrasen im Genitiv oder Präpositionalphrasen formulieren lassen.
Die wichtige Konsequenz hieraus ist, daß hier nicht mehr von ‚Attribut‘ die Rede sein kann, denn die betreffenden Phrasen im Grunde genommen keine Prädikationen mehr darstellen, sondern im Gegenteil referentielle Ergänzungen zu einer Prädikation: im Satz (12ba) wird das Nomen ‹ Entdeckung › (mit seiner verbalen, also prädizierenden Wurzel) durch die Genitiv-NP ‹ einer sechzig Jahre alten Streuobstwiese in Ruhlsdorf › nicht etwa modifiziert oder näher bestimmt, sondern ergänzt: die Genitiv-NP bezieht sich nämlich auf das Patiens-Argument des Prädikats ‹ entdeck- ›; im Satz [12bb] stellt die PP ‹ durch hauptamtliche Mitarbeiter › gleichfalls kein modifizierendes Attribut zu ‹ Unterstützung › dar, sondern das ergänzende Agens-Argument des zugrundeliegenden Prädikats ‹ unterstütz- ›.
Es wurde oben festgestellt, daß das Bezugswort des Attributs meist ein referentieller Ausdruck ist, aber auch ein prädizierender Ausdruck sein kann. Was das Attribut angeht, dieses muß für meine Begriffe immer ein prädikativer Ausdruck sein, der sein Bezugselement semantisch näher bestimmt. Sobald es als referentieller Ausdruck von seinem Bezugselement gefordert wird, anstatt dessen Bedeutung näher zu spezifizieren, handelt es sich nicht um ein Attribut zu einem Bezugselement im oben skizzierten Sinne, sondern um einen Ausdruck, dem eine valenzgebundene Argumentstelle eines Prädikates als Valenzträgers entspricht.
Der dieser Behauptung zugrundeliegende Valenz-Begriff ist, wie man es leicht merken kann, nicht nur morpho-syntaktisch basiert – d.h. beschränkt auf die vom Valenzträger bestimmte und ihn subkategorisierende Zahl (Wertigkeit) und Kasusmarkierung (Rektion) der abhängigen Konstituenten –, sondern auch semantisch und funktional-pragmatisch begründet. Im Kapitel 2 der vorliegenden Arbeit wird der semantische und funktional-pragmatische Valenzbegriff ausführlicher erläutert.
C. Auch im Fall der „notwendigen Erweiterungsglieder“ bei den mehrgliedrigen Attributen (s. oben Anmerkung A) handelt es sich m. E. nicht um Attribute, wie Helbig/Buscha (1993) behaupten, sondern um valenzdeterminierte Ergänzungen zu einer bestimmten Prädikation: im Satz (12aa) ist die PP ‹ für Streuobstwiesen › eigentlich eine referentielle Ergänzung zum valenztragenden prädikativen Adjektiv ‹ typisch ›. Im Beispiel (12ab) dagegen stellt ‹ bunt › deshalb ein echtes Attribut zum Partizip ‹ blühender › dar, weil es weiterhin eine Prädikation darstellt, wenn auch zu einer anderen, höher stehenden Prädikation.
D. Eine Reihe denominaler Adjektive, denen sonst nur attributiver Charakter zugesprochen wird, ist zudem auch vielfach im Rahmen von Argumentstrukturen zu beschreiben, v. a. wenn das Bezugselement eine prädizierende Wurzel aufweist:
(13a) ein menschliches Verhalten
(13b)→ Der Mensch verhält sich so.
(13c)→ Jemand verhält sich wie ein guter Mensch bzw. hilfsbereit.
In (13a) kann sich das Adjektiv ‹ menschlich › auf ein agentivisches, referentielles Argument zum Prädikat ‹ verhalt -› beziehen und damit kein Attribut darstellen (13b); es kann aber auch der Zuweisung der Eigenschaft ‹ menschlich › – im Sinne von ‚menschenfreundlich‘ oder ‚hilfsbereit, selbstlos‘ – zum (im Grunde gleichfalls prädizierenden, auch wenn referentiell verwendeten) Sachverhalt ‹ Verhalten › dienen (13c). Auf diese referentielle Verwendung von originären Prädikationen wird im 2. Kapitel näher eingegangen.
In anderen Fällen stellt die deutsche Sprache Paare von denominalen Adjektiven bereit – z. B. das Paar ‹ kindlich/kindisch › (14 und 15), von denen das eine oder das andere Adjektiv verwendet wird, je nach dem ob man damit eine Argumentstelle (und kein eigenschaftsverleihendes Attribut) oder eine Eigenschaft (also: ein echtes Attribut) meint:
(14a) ein kindliches Verhalten
(14b)→ Ein Kind verhält sich so.
(15a) ein kindisches Verhalten
(15b)→ Jemand Erwachsenes verhält sich wie ein Kind bzw. albern bzw. lächerlich.
Dabei könnte ‹ kindlich › – außer auf einen Referenten – auch auf eine Prädikation bezogen sein:
(16a) eine kindliche Freude
(16b)→ Ein Kind freut sich so.
(16c)→ Jemand Erwachsenes freut sich wie ein Kind bzw. auf unschuldige oder naive Art und Weise.
Allerdings ist es klar, daß selbst bei der Interpretation von ‹ menschlich › und ‹ kindlich › als referentielles Argument eine gewisse prädizierende Eigenschaft, die den Adjektiven immanent ist, nicht verleugnet werden kann:
(13a) ein menschliches Verhalten
(13d→ Das ist die Art und Weise, wie ein Mensch sich verhält.
(14a)ein kindliches Verhalten
(14c)→ Das ist die Art und Weise, wie ein Kind sich verhält.
E. Auch im Fall des sog. ‚attributiven Infinitivs mit zu‘ (12d) muß das Bezugswort (wie das zugrundeliegende Verb) vielfach als Valenzträger angesehen werden, als dessen Aktant die Infinitivkonstruktion auftritt. In unserem Beispiel muß man nur die Bedeutung der zugrundeliegenden Wurzel ‹ mög- › als ‚vermög-‘ in Erinnerung rufen, um die Infinitivkonstruktion ‹ Natur auf ganz eigene Art und Weise zu erleben › als deren Ergänzung ansehen zu können.
F. Unter den attributiven Adjektiven zählen Helbig/Buscha (1993:586ff., 312, 315, ) gemäß dem semantischen Merkmal auch adjektivisch gebrauchte Partizipien und „Zahladjektive“ (darunter Kardinalia, Ordinalia und „unbestimmnte Zahladjektive“), nicht aber „Artikelwörter“ (bestimmter und unbestimmter Artikel, „adjektivische Demonstrativ-, Possessiv-, Interrogativ- und Indefinitpronomina“).
Dabei berechtigt sich die Frage, ob die Ausklammerung der „Artikelwörter“ hier in Ordnung geht, denn sie üben bestimmte prädizierende Eigenschaften gegenüber dem zugehörigen Nomen aus. Wie Helbig/Buscha (1993:363ff.) in ihrer „Semantischen Beschreibung der Artikelwörter“ selbst feststellen, wirken diese identifizierend (Artikel und Demonstrativpronomina), zugehörigkeitsverweisend (Possessivpronomina), quantifizierend (Indefinitpronomina) u.a.
Es stellt außerdem ein Widerspruch dar, z. B. Substantive im Genitiv und „Zahladjektive“ als mögliche Repräsentationen von Attributen anzusehen, während andere Konstruktionen mit entsprechend ähnlichem semantischem Gehalt (und auch ähnlicher syntaktischer Gebundenheit), z. B. Possessiv- und Indefinitpronomina, nicht als Attribut-Typen bezeichnet werden. Für die Possessiva muß man allerdings eine Unterscheidung zwischen dem attributiven (z.B. zugehörigkeitsverweisenden) und dem valenzbedingten (z.B. urheberschaftsverweisenden) Gebrauch machen, genauso wie man zwischen dem attributiven Genitivus possessivus und dem valenzgebundenen Genitivus subjectivus bzw. objectivus unterscheiden muß.
G. Bezüglich des substantivischen Attributes im „merkmallosen Kasus“, bei dem das Bezugswort immer eine Maß- oder Mengenangabe sein soll, stellt sich die Frage, ob die betreffende Mengen- bzw. Maßangabe tatsächlich den Referenten darstellt, dem eine Eigenschaft zugeordnet wird, oder ob die Prädikationsrichtung nicht eher umgekehrt verläuft: im Beispiel (12bc) scheint mir ‹ Nutzung › eher das Bezugswort zu sein, das durch ‹ 40 Jahren › näher bestimmt wird und zwar im Sinne einer allgemeinen Quantifizierung:
(12bca) Nach 40 Jahren Nutzung...
(12bcb)→ Nach einer 40jährigen Nutzung...
(12bcc)→ Nach einer Nutzung, die 40 Jahre lang andauerte...
In der Tat können Mengen- und Maßangaben als eine besondere Art von Zähleinheiten angesehen werden, da sie es erlauben, sonst nicht zählbare Massen-Nomina zu quantifizieren:
(17) ein Glas Wein
Wenn jemand ‹ Glas › als Referenten und ‹ Wein › als eigenschaftsverleihenden Referenten ansieht, d.h. wenn jemand Glas durch Wein näher bestimmen will, dann greift er im Deutschen nicht zu einer Konstruktion mit Mengenangaben, sondern zu einem Kompositum:
(18) ein Weinglas
Somit können Maß- und Mengenangaben m. E. zu den von Helbig/Buscha (1993:310ff.) genannten „Zahladjektiven“ mit attributiver Eigenschaften – darunter Ordinalia u.a. – gerechnet werden.
1.4 Zwischenfazit
Hier sollen einige der in der Satzgliedlehre ungelöst gebliebenen bzw. nicht zufriedenstellend gelösten Probleme bezüglich des Attributs noch einmal zusammengefaßt werden:
1. Heranziehung von rein formalen Kriterien (syntaktische Gebundenheit) bzw. Verwischung in der Abgrenzung von semantischen (= prädikativen) und syntaktischen Eigenschaften.
2. Die daraus entstandene Verwirrung in der Definitions- und Terminusgebung, was Attribut, Prädikativum und prädikatives Attribut angeht.
3. Vorrang der prädikativen Eigenschaft des Attributs als konstitutives und distinktives Merkmal.
4. Widersprüchlichkeiten in der Handhabung der möglichen kategorialen Füllungen von Attributen, z.B. hinsichtlich der „Artikelwörter“.
5. Indirekte Verweise auf Valenzeigenschaften: (vermeintliche) Fakultativität des Attributs; Fälle, in denen das Attribut keine Prädikation zu einem (meist, aber nicht nur referentiellen) Bezugselement, sondern umgekehrt referentielle Ergänzung zu einer Prädikation darstellt, und somit nicht mehr als Attribut angesehen werden kann.
6. Modifikation einer Prädikation, z.B. repräsentiert durch ein Adjektiv oder Adverb, mittels einer weiteren Prädikation: Attribute zu Attributen.
7. Unklarheiten bezüglich der Prädikationsrichtung im Fall von Konstruktionen mit Maß- und Mengenangaben.
Die Erkenntnisse und Vorschläge, die in den verschiedenen moderneren Ansätzen – wie der Valenztheorie, der Generativen Grammatik und der Funktionalen Grammatik – zu finden sind, können vielfach als Versuche, sich mit diesen und anderen Aspekten auseinanderzusetzen, die in der traditionellen Satzgliedlehre zu kurz kommen, verstanden werden. Im folgenden Kapitel werden einige der Erläuterungen problematisiert, die im Rahmen der Valenztheorie vorgeschlagen wurden, wobei einige funktionalistische Ansätze an manchen Stellen mit diskutiert werden.
2. Das Attribut im Rahmen der Valenztheorie
2.1. Formale Charakterisierung von Valenz und das Attribut
„Attribute sind Satelliten (Ergänzungen oder Angaben) von Wörtern, die keine Verben sind.“
Diese Definition von Attribut findet sich in der Dependenz-Verb-Grammatik von Engel (1994:103), der auch folgendes Beispiel anführt:
(19) das Bedürfnis nach Sicherheit in unserer Zeit
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bei Engel spielt der Begriff der Valenz als „subklassenspezifische[r] Rektion“ (Engel 1994:96) eine wesentliche Rolle. Danach sind valenzgebundene Ergänzungen diejenigen „Glieder, die nur von bestimmten Elementen einer Wortklasse abhängen (können)“, und Angaben sind diejenigen „Glieder, die von allen Elementen einer Wortklasse abhängen können“ (Engel 1994:99).
Es handelt sich hier um eine richtige, aber leider nur formal begründete und daher unvollständige Valenzauffassung: zwar werden hier problematische Kriterien wie Fakultativität oder Sinnotwendigkeit vermieden, aber die semantische Prädikat-Argument-Beziehung und deren funktional-pragmatische Charakterisierung wird außer acht gelassen. Es kann daher nicht wundernehmen, daß Ergänzungen und Angaben in einen Topf geworfen und undifferenziert als Attribute bezeichnet werden, sollten sie das alleinige Kriterium erfüllen, von Nicht-Verben syntaktisch abhängig zu sein. Im Grunde genommen sind Engels Erläuterungen bezüglich des Attributs, trotz des Bezugs auf Valenzeigenschaften, genauso einseitig und vereinfacht, wie die traditionelle Auffassung von Attribut, wie sie im 1. Kapitel der vorliegenden Arbeit dargelegt und kritisiert wurde, weil die darin erwähnten Überlegungen zur semantischen Beziehung zwischen (echtem und vermeintlichem) Attribut und seinem Bezugselement auch bei Engel (1994) völlig fehlen.
Von dieser Einseitigkeit einmal abgesehen, ist es interessant festzustellen, daß Engel (1994) mit seiner oben zitierten Definition zum Attribut, anders als Helbig/Buscha (1993), auch die von Letzteren bezeichneten „Artikelwörter“ als mögliche kategoriale Füllung von Attributen anzusehen scheint. Und tatsächlich: nach Engel (1994:115ff. und 64ff.) fungieren die von ihm genannten „Determinative“ (Artikel, Possessiva, Demonstrativa, Indefinita, Interrogativa) als Attribute zu Nomina. Die Begründung für solche an sich plausible Annahme bleibt allerdings fraglich, da nur die syntaktische Abhängigkeitsbeziehung hier eine Rolle spielt.
Was die attributiven Adjektive angeht, ist bei Engel (1994) eine Inkonsequenz festzustellen: ihm zufolge sind Adjektive bzw. adjektivisch gebrauchte Partizipien innerhalb einer NP „als vom Determinativ abhängig aufzufassen“; unter Beachtung des Kriteriums von Valenz als abhängigkeitserzeugender (und auch deklinationssteuernder) Rektion und der Definition von Attribut als von Nicht-Verben (valenz)abhängigem Ausdruck müßte man folgerichtig nicht etwa das Nomen, sondern das Determinativ als Bezugselement des attributiven Adjektivs ansetzen, was natürlich nicht der Fall ist. Der Widersinn in dieser Schlußfolgerung ist dem inkonsistenten – weil nur syntaktisch begründeten – Valenzbegriff zu verdanken.
Diese unvollständige Valenz-Auffassung ist auch der Grund, weshalb Engel (1994:119f.) im Fall der Possessiva, wie auch der sog. ‚Genitivattribute‘ ein Dilemma sieht: sind das Ergänzungen oder Angaben? Engel lehnt zwar den Vorschlag ab, alle sog. ‚Genitivattribute‘ und Possessiva undifferenziert als Angaben aufzufassen, und er nennt sogar – wenn auch vage – den zutreffenden Grund für solche Ablehnung („weil hiermit ins Auge fallende semantische Relationen vernachlässigt werden“[5] ), am Ende findet er aber doch „keinen Ausweg aus diesem Dilemma“. M. E. kann er da auch keinen Ausweg finden, denn seine Valenzauffassung erschöpft sich in der Erzeugung syntaktischer Abhängigkeit. Es kommt nicht von ungefähr, daß er sein Syntaxbuch „ Dependenz -Verb-Grammatik“[6] nennt (vgl. Engel 1994:7).
Engel (1994) verzichtet also darauf, bei sog. ‚Genitivattributen‘ und Possessiva zwischen Ergänzungen und Angaben zu unterscheiden und behandelt sie alle als Attribute. Aber selbst die Abgrenzung von Ergänzung und Angabe – wie Engel (1994) sie anstellt – würde hier nichts bringen, wie oben bereits angedeutet. Im Beispiel (19) wird zwar zwischen der Ergänzung ‹nach Sicherheit› und der Angabe ‹in unserer Zeit› differenziert, beide PPs werden aber als Attribute behandelt. Dabei ist es klar, daß die PP ‹nach Sicherheit› unter Berücksichtigung von Prädikat-Argument-Relationen und zusätzlich der prädizierenden Eigenschaft von Attributen gegenüber ihrem Bezugselement kein Attribut mehr darstellt, da sie a) keine modifizierende Eigenschaft gegenüber ‹Bedürfnis› darstellt, sondern b) von der prädizierenden Wurzel ‹bedurf-› gefordert wird und sie als (Final- bzw. Objektiv-) Argument ergänzt.
2.2 Semantischer und funktional-pragmatischer Valenzbegriff und das Attribut
Es wurde bereits im 1. Kapitel der vorliegenden Arbeit auf einen Valenz-Begriff angedeutet, der sich von dem Engels unterscheidet. Es handelt sich um eine Valenzauffassung, die nicht nur morpho-syntaktisch basiert – d. h. beschränkt auf die vom Valenzträger bestimmte Zahl (Wertigkeit) und Kasusmarkierung (Rektion) der abhängigen Konstituenten –, sondern auch semantisch und funktional-pragmatisch begründet ist. Dieser Valenzbegriff wird jetzt näher erläutert.
Es geht hier einerseits zunächst um die klare Identifizierung dessen, welche Teile einer (verbal oder nominal realisierten) Proposition denn Prädikation und Referent(en) darstellen. In einem nächsten Schritt geht es auch darum, zu identifizieren, um welche Art Prädikation es sich nun handelt: ob es eine einstellige eigenschaftsverweisende oder eine ein- bzw. mehrstellige vorgangsbezogene Prädikation ist. Erst dann kann die Zuordnung von Eigenschaften zu einem Referenten (d.h. zu Personen, Gegenständen oder Sachverhalten) bzw. die durch eine Vorgangsprädikation zustandegekommene Relation zwischen Referenten (d.h. die Relation zwischen Partizipanten an einem Vorgang) ermittelt werden.
Andererseits geht es um die Valenzbeziehung, die zwischen einem Vorgangsprädikat und seinen (referentiellen) Partizipanten besteht, d. h. um die vom Prädikat vorstrukturierte Argumentstruktur, also die von ihm erforderten thematischen Rollen, die die Partizipanten übernehmen und durch welche zueinander in Beziehung treten.
Dabei ist die Erkenntnis, daß Valenzeigenschaften in diesem Sinne bei Ableitungsverfahren weiterbestehen bzw. übertragen werden (können), von ausschlaggebender Bedeutung.
Diese Erkenntnis wurde bereits von Welke (1988:130ff.) bezüglich der Valenz von deverbalen (und deadjektivischen) Nomina präsentiert, wobei Welke „quantitative“ und „qualitative“ Unterschiede in der geerbten Valenz der „nichtlexikalisierten“ und „lexikalisierten Verbalsubstantiven“ sieht.
Welkes Ausführungen sollen hier zunächst knapp wiedergegeben und dann kommentiert werden.
a) Nichtlexikalisierte vs. lexikalisierte Verbalsubstantive
Der Unterscheidung zwischen „nichtlexikalisierten“ und „lexikalisierten “ Verbalsubstantiven entspricht nach Welke (1988) die semantisch und funktional-pragmatisch fundierte Unterscheidung zwischen Prädikation (bei Nomina actionis, wie bei Verben und Adjektiven) und Referenten (bei Nomina acti und Konkreta). Oder in der Terminologie Welkes: zwischen determinierendem Funktor und determiniertem Nomen/Argument (vgl. auch Welke 1988:93ff.). Bei Welke (1988:139) heißt es:
„Mit dem Übergang in die Wortart Substantiv beginnen die ehemaligen Verben (und Adjektive) ihre prädizierende (bzw. attribuierende) Funktion zu verlieren, d. h., sie beginnen den Status als determinierende Funktoren einzubüßen. Sie übernehmen statt dessen die für originäre Substantive charakteristische nominative (benennende) Funktion.“
Welke (1988:132f.) hält (trotz einigen Vorbehalten) die kontextspezifische „Reverbalisierungsprobe“ Sandbergs[7] für „eine gute Möglichkeit“ zur Ermittlung dessen, inwieweit bzw. in welchen Kontexten der Prozeß der Lexikalisierung bei einem deverbalen bzw. deadjektivischen Nomen stattfindet:
- NPs mit nichtlexikalisiertem Kern (19a), in dem die „prädizierende Funktion“ noch sehr stark vorhanden ist, seien reverbalisierbar (19b);
- im Fall eines lexikalisierten Nomens (20a), der die „nominative Funktion“ übernommen hat, sei die Reverbalisierung dagegen nicht möglich (20b).
Dabei kann Welke zufolge ein einziges Nomen einmal nichtlexikalisiert und einmal lexikalisiert sein. In diesem Fall stellt Welke für die jeweiligen möglichen NPs „syntaktische Spezifizierungen (Einschränkungen und Erweiterungen)“ fest (19c und 20c).
Dafür führt Welke (1988:132f.) folgende Beispiele an:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
b) Quantitative Unterschiede in der geerbten Valenz
Welke (1988:134f. und 141f.) merkt bezüglich der von ihm genannten „quantitativen“ Unterschiede in der geerbten Valenz von nichtlexikalisierten und lexikalisierten Nomina, die aus Verben (bzw. Adjektiven) abgeleitet werden, Folgendes an:
- bei Ersteren (21) blieben „absolut bzw. relativ obligatorische Ergänzungen des Verbs“ erhalten, außer der Nominativergänzung des Aktivsatzes, die „kontextuell oder auch im engeren Sinne fakultativ“ werde (Welke 1988:134);
- bei Letzteren (22) sei eine Tendenz der Valenzreduktion bzw. fakultativen Valenz festzustellen: „Ergänzungen, die beim Verb obligatorisch oder höchstens kontextuell fakultativ sind, werden fakultativ im engeren Sinne“ (Welke 1988:141).
Einige Beispiele Welkes (1988:134 und 141) werden hier – zur Veranschaulichung z. T. leicht verändert bzw. ergänzt – übernommen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
c) Funktor-Argument- und Argument-Funktor-Verhältnis
Die Unterscheidung zwischen „obligatorischen Ergänzungen“ und „fakultativen Ergänzungen im engeren Sinne“ basiert auf dem Kriterium der Sinnnotwendigkeit.
Es ruft ein wenig Verwunderung hervor, es hier wiederzufinden, da dieses eher formale Kriterium für die Erklärung von Valenz von Welke in seinem einführenden Kapitel Ergänzungen und Angaben, obligatorische und fakultative Valenz eigentlich mehr oder minder abgewiesen wird zugunsten des semantisch und funktional-pragmatisch basierten Kriteriums der Determiniertheit (zusammen mit dem der Subkategorisierung), wonach „die determinierenden Verbkomplemente Angaben und die determinierten Verbkomplemente Ergänzungen“ seien (Welke 1988:45f.).
Nach dem Kriterium der Determiniertheit bestehe zwischen Valenzträger und seinen Ergänzungen eine Funktor-Argument-Beziehung: man könnte hier ergänzen, daß die Ergänzungen durch den Valenzträger insofern determiniert werden, als sie dadurch zueinander in Beziehung gesetzt werden. Zwischen Valenzträger und seinen Angaben sei die Determinationsrichtung umgekehrt: der Valenzträger werde von den Angaben näher bestimmt.
Nach Welke (1988:142) besteht zwischen einem nichtlexikalisierten Verbalsubstantiv und seinen Ergänzungen weiterhin ein Funktor-Argument-Verhältnis. Dieses Verhältnis werde bei einem lexikalisierten Verbalsubstantiv dagegen zu einem Argument-Funktor-Verhältnis, so daß die Ergänzungen als determinierenden Angaben, also als Attributen verwendet und verstanden würden:
„Die Genitivergänzung, andere präpositionale Ergänzungen, Nebensätze und Infinitivkonstruktionen werden auch semantisch zu dem, was sie in der traditionellen Satzgliedlehre unterschiedslos aus formal-grammatischen Gründen genannt werden: zu Attributen“.
Nach Welke (1988:142) handelt es sich bei den lexikalisierten Verbalsubstantiven zwar um eine „wechselseitige Determination“, die „intendierte Funktion“ sei aber z. B. in (222d), den Referenten ‹ Liebe › durch die Prädikation ‹ zu Tieren › „hinsichtlich einer Beschaffenheit zu determinieren“ und „genauer zu charakterisieren“. Lexikalisierte Verbalsubstantive verhielten sich in dieser Hinsicht wie die meisten originären Substantive, die den Kern von NPs bilden, bei denen die „Determinationsrichtung Attribut – Bestimmungswort“ zwischen beispielsweise einer Genitiv-NP (23) oder einer PP (24) und dem nominalen Kern festzustellen sei; Beispiele von Welke (1988:142):
(23) das Auto meines Vaters
(24) der Roman von Erhard Agricola
Wenn ich Welke richtig interpretiere, heißt es zusammengefaßt:
– all das, was man in der klassischen Satzgliedlehre innerhalb einer NP als Attribut bezeichnet, sei im Fall der lexikalisierten Verbalsubstantive (wie der originären Nomina) tatsächlich Attribut;
– was die nichtlexikalisierten Verbalsubstantive angeht, hier seien Attribute nur diejenigen Konstruktionen, die (determinierende) Angaben zum zugrundeliegenden Verb darstellen; die (valenzbedingten, determinierten) Ergänzungen blieben weiterhin Ergänzungen.
d) Qualitative Unterschiede in der geerbten Valenz[8]
Was die „qualitativen“ Unterschiede in der geerbten Valenz deverbaler und deadjektivischer Substantive angeht, hier geht es Welke (1988) um die Kasusmarkierung von Ergänzungen (bei nichtlexikalisierten Nomina) und Attributen (bei lexikalisierten Nomina).
Welke (1988:131 und 136) verweist z. B. auf die Verwendung vom „Genitiv als Mittel der morphologischen Kennzeichnung des syntaktischen Kombinationspartners, den das Verb mit der Substantivierung von den originären Substantiven übernimmt“. Dabei könne der Genitiv entweder das Agens (25a) oder (bei transitiven Verben) das Patiens (25b) markieren, wobei das Auftreten von zwei Genitiv-NPs (25c und d) durch die Voranstellung einer der NPs eingeschränkt werde (Beispiele von Welke 1988:136):
(25a) Emils Eingestehen
(25b) das Eingestehen der Schuld
(25c) *das Eingestehen Emils der Schuld
(25d) Emils Eingestehen der Schuld
Dabei könne es zu Ambiguitäten kommen (Welke 1988:138) :
(26a) die Beobachtung der Polizei
(26b)← die Polizei beobachtet
(26c)← die Polizei wird beobachtet
Außerdem sei die Kennzeichnung der Ergänzungen auch durch Präpositionalphrasen möglich, entweder zur Desambiguierung (26d) oder zur Aufnahme des Agens bei Verwendung des Genitivs für das Patiens (25e) (Welke 1988:137f.):
(26a) die Beobachtung der Polizei
(26d)→ die Beobachtung durch die Polizei
(25e) das Eingestehen der Schuld durch Emil
Folgende Unterschiede sieht Welke (1988:138f.) in der „qualitativen Valenz“ von lexikalisierten und nichtlexikalisierten Verbalsubstantiven:
– „bei nichtlexikalisierten Verbalsubstantiven [27] kennzeichnet der Genitiv das Patiens transitiver Verben“, während „bei lexikalisierten Verbalsubstantiven [28] das Agens im Genitiv stehen [kann] “ (Welke 1988:138).
– Blockierung der Dativergänzung bei nichtlexikalisierten Nomina (29) und Aufnahme der Dativergänzung durch PP bei lexikalisierten Nomina (30).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Soweit eine knappe Wiedergabe der Welkeschen Darlegungen. Diese sollen nun kommentiert werden.
A. Welkes Valenzbegriff – gewonnen durch die Kombination des Kriteriums der Determiniertheit mit dem der Subkategorisierung – liefert m. E. eine sehr ergiebige formale und v. a. semantisch-funktionale Grundlage zur plausiblen Beschreibung und Erklärung syntaktischer Strukturen, und zwar nicht nur derjenigen, die traditionell als Attribute bezeichnet werden.
Durch die Berücksichtigung der semantisch und auch funktional-pragmatisch basierten Unterscheidung zwischen Prädikation und Referent (bzw. Funktor und Nomen/Argument) wird Schnittstellen zwischen Sprache und außersprachlicher Erscheinungs- bzw. Erfahrungswelt verwiesen.
Dadurch wird Givóns Annahme der „iconicity of syntax“ bestätigt, wonach Syntax als Teil eines komplexen Kodierungssystems verstanden werde, das sich auf zwei Entitäten bezieht, welche wiederum in einer semiotischen Relation zueinanderstehen:
– die (kodierende) Struktur und
– die (kodierte) Funktion.
Dabei bestehe zwischen Kodiertem und Kodierendem eine ikonische Relation. Das bedeutet, daß man syntaktische Strukturen (das Kodierende) als Abbildungen von bestimmten Funktionen (dem Kodierten) verstehen und umgekehrt, aus den Strukturen, die Funktionen ermitteln könne bzw. müsse (Givón 1984:29,33f.). Oder anders ausgedrückt: syntaktischen Strukturen liegen funktionale (semantisch-pragmatische) Motivationen zugrunde. Diese funktionalen Motivationen können Kategorien im Rahmen der funktionalen Satzperspektive – innerhalb eines Satzes oder eines Textes – betreffen. Sie können sich aber auch auf die Bausteine propositionaler Konstruktionen beziehen, seien sie verbal oder nominal realisiert.
B. Eben darum würde ich die Bezeichnungen „quantitative“ und „qualitative Valenz“ durch ‚inhaltliche‘ und ‚formale‘ Valenz ersetzen, oder durch (funktionsgebundene) ‚Valenz‘ und (kasusdeterminierende) ‚Rektion‘. Am besten wäre allerdings die einfache Unterscheidung zwischen (semantisch-pragmatischer) Funktion und (struktureller) Markierung, denn dadurch würde auf den ikonischen Charakter der (Morpho-) Syntax verwiesen.
C. Eine andere terminologische (aber letzlich auch inhaltliche) Frage bezieht sich auf die Unterscheidung zwischen „prädizierend“ und „attribuierend“ in bezug auf Verben und Adjektive. Die Art und Weise, wie diese Bezeichnungen von Welke (1988:139) verwendet werden, könnte zu Mißverständnissen führen, die von ihm sicherlich nicht beabsichtigt werden:
– daß die attribuierende Funktion die prädizierende ausschließen würde;
– daß die attribuierende Funktion Adjektiven vorbehalten wäre, während die prädikative Funktion den Verben eigen wäre;
– daß Adjektive immer attribuierende Funktion innehätten.
Es gibt tatsächlich einen Unterschied zwischen Verben und (attribuierenden) Adjektiven, was ihre semantisch und funktional basierten Bedeutung angeht.
Und es gibt auch einen Unterschied zw. ‚prädizierend ‘ und ‚attribuierend‘. Dieser Unterschied ist allerdings derjenige, den zwischen einem Hyperonym und seinen Hyponymen festzustellen ist: Attribution ist eine Art Prädikation; die andere wichtige Prädikationsart ist die des Vorgangs; Vorgang und Eigenschaft sind Kohyponyme untereinander und Hyponyme des Oberbegriffs Prädikation. Das heißt m. a. W.: eine Attribution (z. B. durch attribuierende Adjektive) ist immer eine Prädikation, und zwar qualitativer Art (eigenschaftsverweisend) im Gegensatz zur vorgangsverweisenden Prädikation, die verbalen Wurzeln immanent ist.
Allerdings ist dieser vorgangsverweisende Charakter nicht nur bei verbalen Wurzeln zu finden, sondern auch bei bestimmten Adjektiven. Oder anders herum formuliert: es ist doch nicht immer der Fall, daß jedes Adjektiv attribuierenden Charakter hat.
(31a) Die Mutter ist stolz auf ihre Tochter
(31b) die auf ihre Tochter stolze Mutter
In der Satzgliedlehre würde man ‹ stolz auf ihre Tochter › in (31a) als Subjektsprädikativum (also als Teil des Prädikats), ‹ auf ihre Tochter stolze › in (31b) dagegen als Attribut analysieren. Dabei handelt es sich in beiden Fällen um einen zugrundeliegenden prädikativen Vorgang ‹ stolz sein ›, an dem die Partizipanten ‹ die Mutter › und ‹ die Tochter › beteiligt sind und durch welchen diese Partizipanten zueinander in Beziehung gesetzt werden.
Anders verhält es sich in folgenden Beispielen, in denen ‹ stolz › ganz klar als attributive (eigenschaftsverweisende) Prädikation verstanden werden muß:
(32a) Der Häuptling ist stolz (mutig, stark, ruhig, ...).
(32b) der stolze (mutige, starke, ruhige, ...) Häuptling
Andererseits – und das sei nur am Rande erwähnt – können Verbalwurzeln offenbar eigenschaftsverleihend sein, und somit wie Attribute funktionieren, wie z. B. in (33a) und (33b), wo es sich nicht um einen Vorgang, sondern um eine Fähigkeit, also eine Eigenschaft handelt. In (33c) und (33d) dagegen handelt es sich um Vorgangsprädikationen.
(33a) Ich denke.
(33b)→ Ich kann denken.
(33c) Ich denke an dich.
(33d) Ruhe! Ich denke !
Bei einigen Autoren wird die Unterscheidung zwischen Eigenschaft und Vorgang nicht sehr klar gezogen. So bei Lock (1996:60): „the noun ‹height› represents not a process but a quality, which in the original was represented by an adjective (‹tall›)“, was meiner Sichtweise entspricht. Einige Zeilen höher hatte er Eigenschaften („ being “) allerdings als Vorgänge bezeichnet: „A term used to refer in general to ‹going-on› like ‹doing, happening, seeing, feeling, thinking›, as well as ‹being and having›, is process “.[9]
D. Meine Hauptkritik an Welke (1988) bezieht sich auf den Kern seines Kapitels zur Valenz des Substantivs, also auf die Unterscheidung zwischen „nichtlexikalisierten und lexikalisierten Verbalsubstantiven“, und die Annahme, daß die Funktor-Argument-Beziehung bei Ersteren zu einer Argument-Funktor-Beziehung bei Letzteren wird.
Wie gesagt, ist die Unterscheidung Prädikation-Referent (Determiniertheitskriterium) meiner Meinung nach ein fruchtbarer Ausgangspunkt für die Begründung von Valenz und für die Abgrenzung zwischen Ergänzungen und Angaben. Im Fall der NPs liefert die Unterscheidung Prädikation-Referent (bzw. Funktor-Argument) folglich die Grundlage dafür, zwischen valenzbedingten, nicht attribuierenden (da nicht prädizierenden, sondern referentiellen) Ergänzungen und echten (da nicht nur prädizierenden, sondern genauer: attribuierenden) Attributen zu unterscheiden.
Aber man kann m. E. bei einem sog. „lexikalisierten Verbalsubstantiv“ nun einmal wirklich nicht sagen, daß die zugrundeliegende Verbalwurzel ihren prädizierenden Charakter dermaßen eingebüßt hätten, daß sie die – vom zugrundeliegenden Verb erforderten – Ergänzungen nun nicht mehr semantisch determiniert, sondern von ihnen determiniert werden. M. a. W.: ich kann der Annahme nicht zustimmen, daß die Funktor-Nomen-Relation zu einer Argument-Funktor-Relation wird.
Welke merkt es selbst an: bei den „lexikalisierten Verbalsubstantiven“ ist zwar „Hervortreten der benennenden Funktion“ festzustellen (Welke 1988:141), aber bei ihnen ist auch feststellbar, „daß beide Funktionen gleichzeitig vorhanden sein können, also neben der nominativen Funktion auch eine reduzierte prädizierende Funktion“ (Welke (1988:140).
Aber inwiefern kann von „eine [r] reduzierte [n] prädikative [n] Funktion“ die Rede sein?
Welke (1988) scheint, dies mit der reduzierten „quantitativen Valenz“ zu korrelieren, also mit der Tatsache, daß – bei den „lexikalisierten Verbalsubstantiven“ – „Ergänzungen, die beim Verb obligatorisch oder höchstens kontextuell fakultativ sind, [...] fakultativ im engeren Sinne [werden] “ (Welke 1988:141). Wenn meine Interpretation der Welkeschen Darlegungen diesbezüglich so richtig ist, dann ist es sehr schade drum, denn es würde bedeuten, daß bei Welke (1988) die formalen und oft irreführenden Kriterien der Sinnnotwendigkeit und Fakultativität doch oberhand gewinnen würden.
Von „eine [r] reduzierte [n] prädikative [n] Funktion“ kann m. E. nur in einem ganz anderen Zusammenhang die Rede sein. Und zwar wenn eine Vorgangsprädikation – ob mit seiner Argumentstruktur oder nicht – als Proposition so verwendet wird, als ob es sich dabei um einen Referenten handeln würde. Das ist der Fall bei der Prädikation ‹ lieb -› in den Beispiele unter (22):
(22b) Emil spricht über die Liebe.
(22c) Emil spricht über die Liebe Pauls.
(22d) Emil spricht über die Liebe zu Tieren.
(22e) Emil spricht über die Liebe Pauls zu Tieren.
Die „intendierte Funktion“ ist beispielsweise in (22d) m. E. nicht etwa die, einen Referenten ‹ Liebe › durch ein Attribut ‹ zu Tieren› „zu determinieren“ und „genauer [zu] charakterisieren“ (Welke 1988:142), denn eine prädizierende Charakterisierung von ‹ Liebe › würde eher folgendermaßen aussehen:
(34a) die heimliche Liebe Pauls zu Sarah
Die prädizierende Charakterisierung wäre also dieselbe sowohl im Nominal- wie im Verbalstil:
(34b) Paul liebt Sarah heimlich.
Also ist die „intendierte Funktion“ in (22d) m. E. nicht, ‹ Liebe › durch ‹ zu Tieren › näher zu bestimmen, sondern vielmehr handelt es sich bei ‹ die Liebe zu Tieren › um eine im Kontext untergeordnete Proposition, die als Partizipant zur übergeordneten Vorgangsprädikation ‹ sprech- über › verwendet wird.
Wie Lock (1996:59f.) es erklärt: „nouns typically represent that part of our experience that we perceive as things or entities“. Und er fährt fort: „however, it is possible to rearrange this relationship [zwischen Vorgang und Partizipanten] and represent processes by nouns“. Und ich bin der Meinung, daß dies für alle deverbale Nomina zutrifft, ob lexikalisiert oder nicht.
Lock (1996:61) nennt auch einige funktionale Gründe für die Verwendung einer Proposition (oder Prädikation) als Referenten durch die Nominalisierung:
- „the potential advantage of conciseness“;
- „it is much easier to begin a clause or a sentence with a noun group than with a verb group“;
- in der Wissenschaftssprache: „it is often necessary to treat processes as if they were things“.
Man könnte sich einen weiteren Grund vorstellen:
- die Ausblendung von Partizipanten aus der Proposition: z. B. wie in manchen Diathesen die Ausblendung vom Agens (22d) oder, was in den meisten Diathesen nicht möglich ist, die Ausblendung vom Patiens/Thema/Resultat, also dem Direktobjekt aktiver Sätze (22c).
Dies ist aber wieder eine formale Eigenschaft, die nicht zur Charakterisierung von Valenz verwendet werden sollte. Diese formale Eigenschaft kann nicht als Argument dafür verwendet werden, Ergänzungen bei „nichtlexikalisierten Verbalsubstantiven“ als Ergänzungen zu sehen, während im Fall der „lexikalisierten Substantiven“ die formale Fakultativität der Ergänzungen sie zu Attributen machen soll. Ich habe den Eindruck, daß bei Welke (1988) eine Korrelation in dieser Art zwischen den Zeilen zu lesen ist, aber ich schließe Irrtüme meinerseits natürlich nicht aus.
Festzuhalten ist, daß, wie Welke (1988:143) es selbst anmerkt, bei Beispielen wie (22) oben oder den folgenden Beispielen unter (35) „indirekt das Agens oder Patiens (Objekt) des zugrunde liegenden Geschehens mitgeteilt“ wird und „die verbale Valenz noch mit [schwingt] “
(35a) Der Vorschlag des Meister gefiel mir.
(35b) Der Vorschlag, die Sitzung zu vertagen, wurde begeistert aufgenommen.
Das Ausschlaggebende hier ist also meiner Meinung nach die Tatsache, daß eine Proposition nicht aufhört, eine Proposition darzustellen, also bestehend aus Prädikation und Partizipant(en), selbst wenn sie als Referent einer übergeordneten Proposition auftritt.
Das bedeutet, daß das Nomen ‹ Liebe › – selbst bei referentieller Verwendung – eine Vorgangsprädikation bleibt, denn ihm liegt eine Proposition (Prädikat + seine Argumente) zugrunde:
(22f) ein Experiencer x liebt ein Goal y
Es spielt dabei keine Rolle, ob die Argumente Experiencer und Goal sprachlich realisiert werden oder nicht. In der realen Welt impliziert der Vorgang des Liebens die Existenz eines Liebenden und eines Geliebten, also in dem Fall die Existenz zweier Instanzen, die man im weitesten Sinne als Quelle und Ziel des Vorgangs verstehen könnte. Diese Tatsache ändert sich nicht in Beispiel (22b):
(22b) Emil spricht über die Liebe.
Was die Reverbaliserungsprobe Sandbergs angeht, da ist Welke selbst sehr kritisch und ich noch mehr, denn selbst die „kontextspezifische“ Verwendung der Reverbalisierungsprobe ist kein Garant für die Unterscheidung zwischen referentiellen und prädizierenden Verbalsubstantiven, sondern nur höchstens für die Unterscheidung zwischen referentieller und prädizierender Verwendungsweise von immanent prädizierender Verbalwurzeln. Und diese sind immer reverbalisierbar, soweit synchron gesehen das Verb noch vorhanden ist, auch wenn der Kontext verändert bzw. erweitert werden muß:
(20a) Ihr Schreiben vom 10. Juni 1986 haben wir dankend erhalten.
(20d)→ Den Brief, den Sie am 10. Juni 1986 geschrieben haben, haben wir dankend erhalten.
3. Fazit
Es wurde in der Einleitung angedeutet, daß eine modellvergleichende Analyse des Attributs grundlegende Fragen der Syntax betreffen. Die Untersuchung von Prämissen aus der Satzgliedlehre und der Valenztheorie bestätigen das.
Wenn man für das Attribut das herkömmliche semantische Kriterium der Prädikation durch das valenztheoretische Kriterium der Determiniertheit erweitert und präzisiert, stellt man fest, daß die Relation zwischen dem Attribut und seinem Bezugselement eine semantisch begründete Relation darstellt zwischen:
– einer eigenschaftsverleihenden oder -modifizierenden Prädikation und
– einem referentiellen oder propositionellen Sachverhalt bzw. einer zweiten, übergeordneten, selbst eigenschaftsverleihenden oder vorgangsbezeichnenden Prädikation.
Damit erreicht man eine vereinheitlichte Charakterisierung für die syntaktischen Relationen, die traditionell als Attribut, Prädikativum, prädikatives Attribut und Adverbialbestimmung bezeichnet werden. Die kategoriale Füllung von Attributen ist hiermit um einige Kategorien erweitert. Das formale Kriterium der Gebundenheit und Ungebundenheit kann man zur Unterdifferenzierung des Attributs anwenden.
Wenn man diese Charakterisierung der Definition von Proposition als aus einem Prädikat und deren Ergänzungen (Argumenten) bestehend – unabhängig von der formalen Realisierung derselben und unabhängig davon, ob die Argumente im konkreten Fall tatsächlich realisiert werden – entgegenstellt, stellt man fest, daß bestimmte Konstruktionen, die traditionell als Attribute angesehen werden, es eigentlich nicht sind, denn die Funktor-Argument-Relation zwischen Vorgangsprädikat und seinen Argumenten nicht umzukehren ist.
Eine nominal realisierte Proposition (ob mit einer Vorgangs- oder Eigenschaftsprädikation als Kern) kann allerdings jederzeit als Partizipant einer höherstehenden Vorgangsprädikation auftreten bzw. von einer untergeordneten Eigenschaftsprädikation modifiziert werden.
Sätze stellen, wie man sieht, höchst komplex gebaute Propositionen dar, die wiederum aus untergeordneten, hierarchisch geordneten Propositionen bestehen (können), wobei ein gewisses Binaritätsprinzip nicht fehlt, denn Grundbausteine sind immer Prädikationen (ob eigenschafts- oder vorgangsbezeichnend) und Partizipant(en).
Folgendes Schema soll dies verdeutlichen:
(22g) Paul spricht über die innige Liebe Emils zu Tieren.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Literaturangaben
Bussmann (1990)
Bussmann , Hadumod: Lexikon der Sprachwissenschaft.– 2., völlig neu bearb. Aufl.– Stuttgart: Kröner, 1990.–
Engel (1994)
Engel , Ulrich: Syntax der deutschen Gegenwartssprache.- 3., völlig neu bearb. Aufl.- Berlin: Schmidt, 1994.-
Fanselow/Felix (1993)
Fanselow , Gisbert / Felix, Sascha W.: Sprachtheorie: eine Einführung in die generative Grammatik.- Bd. 2: Die Rektions- und Bindungstheorie.– 3. Aufl.– Tübingen/Basel: Francke, 1993.- [ UTB für Wissenschaft; Uni-Taschenbücher; 1442]
Givón (1984)
Givón , Talmy: Syntax: a functional-typological introduction.- Vol. I.- Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 1984.- Stabi 2: 651959-1.
Givón (1990)
Givón , Talmy: Syntax: a functional-typological introduction.– Volume II.– Amsterdam / Philadelphia: Benjamins, 1990.– [Stabi 2: 651 959-2]
Helbig/Buscha (1993)
Helbig , Gerhard / Buscha, Joachim: Deutsche Grammatik: Ein Handbuch für den Ausländerunterricht.- 15., durchges. Aufl.- Leipzig [u.a.]: Langenscheidt, 1993.-
Leme [ u.a.] (1981)
Leme , Odilon Soares / Serra, Stella Maria Garrafa / Pinho, José Albetoni de: Assim se escreve... Gramática – Assim escreveram... Literatura : Brasil – Portugal.- São Paulo: EPU, 1981.-
Lock (1996)
Lock , Graham: Functional English grammar: an introduction for second language teachers.- Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1996.-
Welke (1988)
Welke , Klaus M.: Einführung in die Valenz- und Kasustheorie.- 1. Aufl.- Leipzig: Bibliographisches Institut, 1988.- Kapitel 5.2. Valenz des Substantivs, S. 130-149.-
Wöllstein-Leisten [ u.a.] (1997)
Wöllstein-Leisten , Angelika / Heilmann, Axel / Stepan, Peter / Vikner, Sten: Deutsche Satzstruktur: Grundlagen der syntaktischen Analyse.- Tübingen: Stauffenburg, 1997.- [ Stauffenburg-Einführungen ]
[...]
[1] Wahrig, Gerhard: Deutsches Wörterbuch – mit einem „Lexikon der deutschen Sprachlehre“.- Gütersloh; München: Bertelsmann, 1986.-
[2] Hier wird indirekt auf die alte Annahme zweier Strukturebenen der Sprache verwiesen, die in der Generativen Grammatik als Tiefen- und Oberflächenstruktur wiederaufgenommen wurde.
[3] Es müßte hier natürlich heißen: „mit Ausnahme des Prädikats “.
[4] Es wird in der vorliegenden Arbeit darauf verzichtet, das sententiale Attribut – das von Helbig/Buscha (1993:675ff.) auch nicht im Kapitel zum Attribut, sondern zusammen mit anderen Nebensazttypen behandelt werden – zu diskutieren.
[5] Hervorhebung von mir.
[6] Hervorhebung von mir.
[7] Sandberg, B.: Die neutrale –(e)n- Ableitung der deutschen Gegenwartssprache. Zu dem Aspekt der Lexikalisiserung bei den Verbalsubstantiven. Göteborg: 1976.- ders.: Zur Repräsentation, Besetzung und Funktion einiger zentraler Leerstellen bei Substantiven.- Göteborg: 1979.- Zitiert in: Welke (1988:132f.).
[8] Auf die Darlegung einiger Besonderheiten bezüglich der nichtlexikalisierten Nomina wird hier verzichtet.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptziel dieser Arbeit zum Attribut?
Das Hauptziel dieser Arbeit ist es, einen Vergleich verschiedener grammatischer Modelle am Beispiel der syntaktischen Relation des Attributs zu unternehmen. Es wird versucht, einen Querschnitt durch grammatische Theorien zu erstellen, um deren Vor- und Nachteile gegenüberzustellen und zu diskutieren.
Welche grammatischen Modelle werden in der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit konzentriert sich hauptsächlich auf die traditionelle Satzgliedlehre, das Valenzmodell und verweist an einigen Stellen auf funktionale Ansätze. Ursprünglich war geplant, auch generativistische Darlegungen im Rahmen der Rektions- und Bindungstheorie sowie funktionalistische Ansätze zu diskutieren, dies wurde aber aus Gründen des Umfangs eingeschränkt.
Was sind die Hauptkritikpunkte an der traditionellen Satzgliedlehre bezüglich des Attributs?
Die Hauptkritikpunkte umfassen: die Heranziehung rein formaler Kriterien (syntaktische Gebundenheit), die Verwischung in der Abgrenzung von semantischen und syntaktischen Eigenschaften, die daraus resultierende Verwirrung in der Definitions- und Terminusgebung, Widersprüchlichkeiten in der Handhabung der möglichen kategorialen Füllungen von Attributen, indirekte Verweise auf Valenzeigenschaften, die Modifikation einer Prädikation mittels einer weiteren Prädikation und Unklarheiten bezüglich der Prädikationsrichtung im Fall von Konstruktionen mit Maß- und Mengenangaben.
Wie wird das Attribut im Rahmen der Valenztheorie betrachtet?
Im Rahmen der Valenztheorie wird das Attribut als Satellit von Wörtern, die keine Verben sind, definiert. Es wird auf die Valenz als subklassenspezifische Rektion eingegangen, wobei valenzgebundene Ergänzungen von Angaben unterschieden werden. Allerdings wird kritisiert, dass Engels formale Valenzauffassung die semantische Prädikat-Argument-Beziehung und deren funktional-pragmatische Charakterisierung außer Acht lässt.
Was ist die Rolle der Valenz bei der Analyse des Attributs?
Die Valenz spielt eine entscheidende Rolle bei der Identifizierung dessen, welche Teile einer Proposition Prädikation und Referent(en) darstellen. Es geht darum, die vom Prädikat vorstrukturierte Argumentstruktur zu erkennen, d.h. die vom Prädikat erforderten thematischen Rollen der Partizipanten.
Was sind die Kritikpunkte an Welkes Unterscheidung zwischen "nichtlexikalisierten" und "lexikalisierten" Verbalsubstantiven?
Die Hauptkritik bezieht sich auf Welkes Annahme, dass die Funktor-Argument-Beziehung bei nichtlexikalisierten Substantiven zu einer Argument-Funktor-Beziehung bei lexikalisierten Substantiven wird. Es wird argumentiert, dass die zugrundeliegende Verbalwurzel ihren prädizierenden Charakter nicht dermaßen einbüßt, dass sie die vom zugrundeliegenden Verb erforderten Ergänzungen nicht mehr semantisch determiniert.
Welche Schlussfolgerungen werden in der Arbeit gezogen?
Es wird geschlussfolgert, dass die Relation zwischen dem Attribut und seinem Bezugselement eine semantisch begründete Relation darstellt zwischen einer eigenschaftsverleihenden Prädikation und einem referentiellen oder propositionellen Sachverhalt. Damit wird eine vereinheitlichte Charakterisierung für die syntaktischen Relationen, die traditionell als Attribut, Prädikativum, prädikatives Attribut und Adverbialbestimmung bezeichnet werden, erreicht.
Wie wird die Unterscheidung zwischen Vorgangsprädikation und eigenschaftsverleihender Prädikation erklärt?
Es wird argumentiert, dass es einen Unterschied zwischen Verben und (attribuierenden) Adjektiven gibt, was ihre semantisch und funktional basierten Bedeutung angeht. Vorgang und Eigenschaft sind Kohyponyme untereinander und Hyponyme des Oberbegriffs Prädikation. Attribution ist eine Art Prädikation, und zwar qualitativer Art (eigenschaftsverweisend) im Gegensatz zur vorgangsverweisenden Prädikation, die verbalen Wurzeln immanent ist.
Wie wird in der Arbeit argumentiert, dass Propositionen, die als Referenten verwendet werden, dennoch prädizierenden Charakter beibehalten?
Es wird dargelegt, dass das Nomen – selbst bei referentieller Verwendung – eine Vorgangsprädikation bleibt, denn ihm liegt eine Proposition (Prädikat + seine Argumente) zugrunde. Es spielt dabei keine Rolle, ob die Argumente sprachlich realisiert werden oder nicht. Im Kontext impliziert der Vorgang eine existenzielle Beziehung zu seinen Partizipanten, die nicht durch Nominalisierung aufgehoben wird.
- Quote paper
- Suzie Bartsch (Author), 1998, Das Attribut in der traditionellen Satzgliedlehre und im Rahmen der Valenztheorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12076