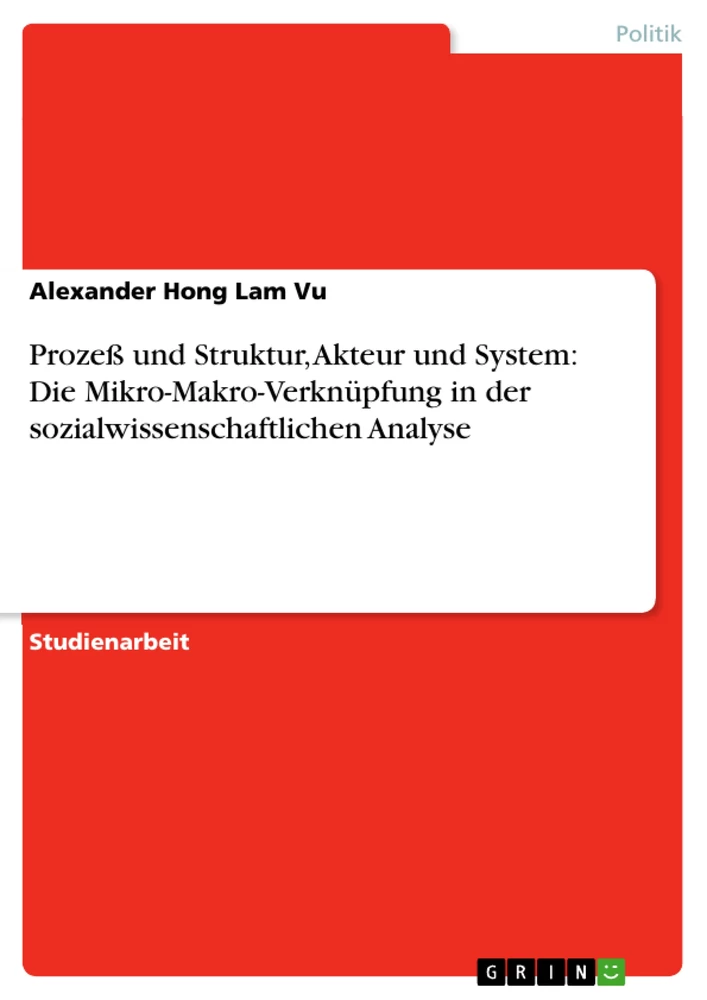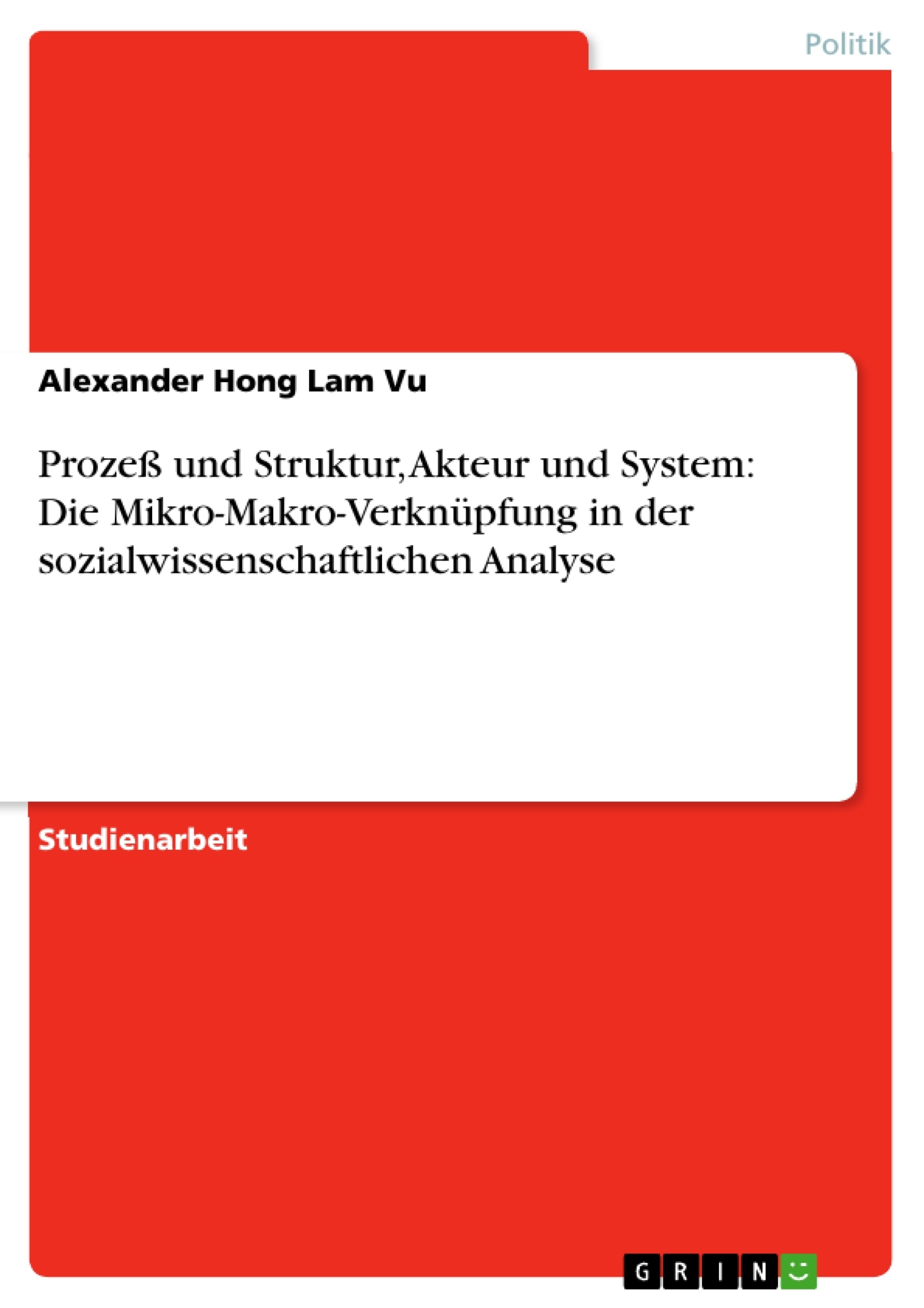Einleitung
Zwei große Schulen, die man methodologischer Individualismus und methodologischer Kollektivismus nennt, polarisieren den methodologischen Horizont der Sozialwissenschaften. Der methodologische Individualismus ist der Ansicht, daß
letztendlich das ‘Individuum’ die Quelle aller sozialen Erscheinungen ist: Der Mensch mache die Geschichte. Während dessen unterstellt der methodologische Kollektivismus (auch methodologischer Funktionalismus genannt), daß die ‘Gesellschaft’ individuelles Handeln in eine Art Logik zwingt: Die Geschichte verlaufe nach ihrer eigenen Logik. Dieser methodologische Unterschied – manchmal sogar Antagonismus – erzeugt in der
Sozialwissenschaften das sogenannte Mikro-Makro-Problem. Im Lauf der Zeit kommen Wissenschaftler immer wieder zur Einsicht, daß eine Trennung der beiden Ebenen und die Ignoranz der anderen Ebene das Verstehen und die Erklärung des sozialen Lebens lähmen. Bemühungen zur Verknüpfung und zur Zusammenführung der Mikro- und der
Makroebene werden versucht.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Mikro-Makro-Beziehung
- Makrobedingungen für Mikrointeraktionen
- Mikrodynamik und Makrologik
- Probleme der Mikro-Makro-Verknüpfung
- Strategien der Integration der beiden Perspektiven
- Tiefenerklärung: Mikrofundierung für Makrostrukturen
- Interpenetration: Makrorahmen für Mikroprozesse
- Jenseits der Dichotomie: Die Figuration und das Machtspiel-Modell
- Bilanz und Perspektiven
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das Mikro-Makro-Problem in den Sozialwissenschaften. Sie analysiert die beiden methodologischen Pole des Individualismus und des Kollektivismus und beleuchtet die Schwierigkeiten, die bei der Verknüpfung von Mikro- und Makroebene auftreten.
- Die unterschiedlichen Perspektiven des methodologischen Individualismus und Kollektivismus
- Die Herausforderungen der Mikro-Makro-Verknüpfung in der sozialwissenschaftlichen Analyse
- Strategien zur Integration der beiden Perspektiven
- Die Rolle von Akteur und System in der Mikro-Makro-Beziehung
- Bedeutung von Prozeß und Struktur in der Sozialtheorie
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt das Mikro-Makro-Problem in den Sozialwissenschaften vor, das aus der Dichotomie des methodologischen Individualismus und Kollektivismus resultiert.
- Die Mikro-Makro-Beziehung: Dieses Kapitel untersucht die Beziehung zwischen Mikro- und Makroebene in verschiedenen sozialwissenschaftlichen Theorien, darunter die ökonomische Theorie, der symbolische Interaktionismus, die Ethnomethodologie, der Marxismus und die funktionalistischen Ansätze.
- Strategien der Integration der beiden Perspektiven: Dieses Kapitel stellt drei Ansätze zur Integration der Mikro- und Makroebene vor: den Rational-Choice-Ansatz, das neo-funktionalistische Modell Münchs und den Figurationsansatz Elias'.
Schlüsselwörter
Mikro-Makro-Problem, methodologischer Individualismus, methodologischer Kollektivismus, Akteur, System, Prozeß, Struktur, Interaktion, Rational-Choice, Funktionalismus, Figuration, Machtspiel, Sozialtheorie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Mikro-Makro-Problem in den Sozialwissenschaften?
Es beschreibt die Schwierigkeit, individuelles Handeln (Mikroebene) und gesellschaftliche Strukturen (Makroebene) theoretisch und analytisch miteinander zu verknüpfen.
Was unterscheidet methodologischen Individualismus von Kollektivismus?
Individualismus sieht das Individuum als Quelle aller sozialen Erscheinungen, während Kollektivismus davon ausgeht, dass die Gesellschaft das Handeln nach einer eigenen Logik zwingt.
Welche Strategien gibt es zur Integration beider Ebenen?
Die Arbeit nennt Ansätze wie die Mikrofundierung (Rational-Choice), den Makrorahmen (Neo-Funktionalismus) und den Figurationsansatz von Norbert Elias.
Welche Rolle spielt der Figurationsansatz von Norbert Elias?
Elias versucht, die Dichotomie aufzuheben, indem er soziale Prozesse als Geflechte (Figurationen) von interdependenten Individuen betrachtet.
Warum ist die Trennung der Ebenen problematisch?
Die Ignoranz einer Ebene lähmt das Verstehen und die Erklärung des sozialen Lebens, da Akteure und Systeme sich gegenseitig bedingen.
- Citation du texte
- Alexander Hong Lam Vu (Auteur), 1997, Prozeß und Struktur, Akteur und System: Die Mikro-Makro-Verknüpfung in der sozialwissenschaftlichen Analyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1208