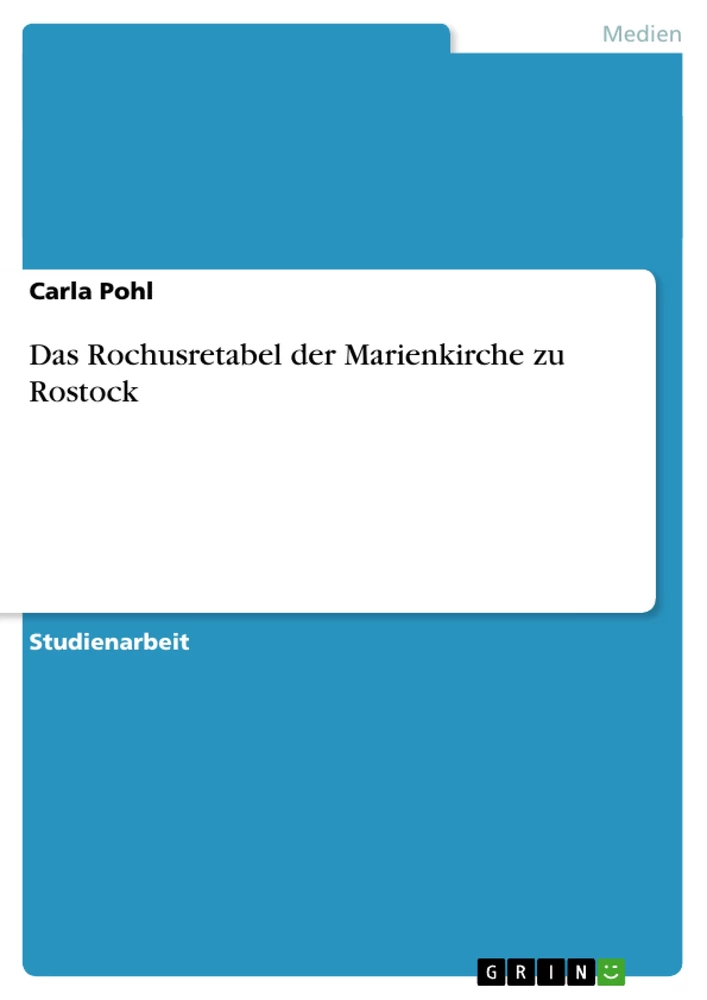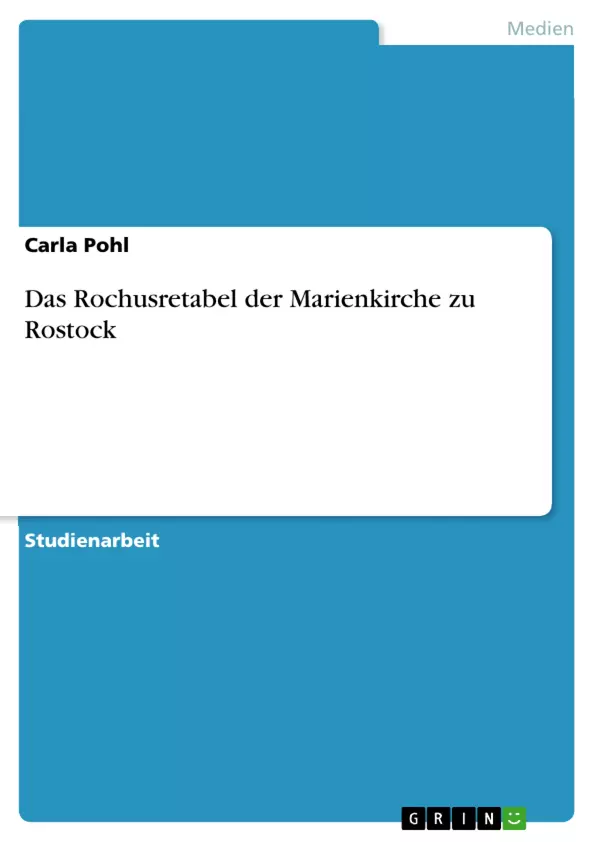Die Marienkirche zu Rostock besaß in der vorreformatorischen Zeit um 1500 bis zu vierzig Altäre. Von diesen vierzig Altären sind heute nur noch ein Seitenflügel eines Altarretabels und ein Rochusaltar vorhanden. Des weiteren gibt es noch eine Mutter Gottes auf der Mondsichel, eine mittelalterliche Fünte, eine astronomische Uhr und den heutigen barocken Hauptaltar.
Diese Arbeit widmet sich dem Rochusaltar (Abb. 1). Das Altarretabel ist in die Entstehungszeit um 1534 datiert. Die Künstlerzuschreibung ist in der Forschungsliteratur sehr schwankend und geht von Benedikt Dreyer über Claus Berg bis hin nach Schwaben und zur niederrheinischen Schnitzkunst. Vorwiegend wird das Retabel Benedikt Dreyer bzw. seinem Umfeld zugeschrieben.
Das Interesse dieser Arbeit liegt auf der Verehrung der Heiligen, welche im Retabel dargestellt sind und wie diese auf den Gläubigen gewirkt haben könnten. Dabei ist zu bedenken, dass durch den Verlust der restlichen Altäre das zu behandelnde Retabel eine andere Wirkung auf den Betrachter ausübt. Des Weiteren steht die Legitimation eines solchen Retabels zur Frage.
Die dargestellten Heiligen sind: der hl. Rochus, der hl. Antonius der Eremit, der hl. Sebastian, die hl. Ärzte Kosmas und Damian, der hl. Christophorus, ein unidentifizierter Bischof, sowie weibliche Heiligenfiguren aus dem Gesprenge. Die Heiligen sind alle Schutzheilige gegen Pest und Krankheit. Über die Entstehungsumstände des Altares ist nichts bekannt, daher lässt sich anhand der Figuren vermuten, dass das Retabel eine Stiftung der Zunft der Wundärzte und Bartscherer war, da deren Patronatsheilige zu finden sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2.0 Das Retabel - Kurzbeschreibung
- 2.1 Der Mittelschrein mit dem hl. Rochus, den hl. Sebastian und dem hl. Antonius
- 2.2 Der linke Seitenflügel mit Kosmas und Damian
- 2.3 Der rechte Seitenflügel mit Christophorus und einem Bischof
- 3. Gesprenge
- 4.1 Kontext I - die Pest
- 4.2 Kontext II - Die Stiftung der Wundärzte und Barbiere
- 4.3 Kontext III - der Rochuskult und ein kurzer Stilvergleich
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Rostocker Rochusaltar, datiert um 1534, und konzentriert sich auf die Verehrung der dargestellten Heiligen und deren Wirkung auf die Gläubigen. Berücksichtigt wird der Verlust der anderen Altäre der Marienkirche und die Frage nach der Legitimation eines solchen Retabels. Die Künstlerzuschreibung wird ebenfalls thematisiert.
- Verehrung der Heiligen und deren Wirkung auf die Gläubigen
- Künstlerische Zuschreibung und Stilmerkmale des Retabels
- Der Kontext der Pest und die mögliche Stiftung durch die Wundärzte und Barbiere
- Ikonographische Analyse der dargestellten Heiligen
- Die Bedeutung des Retabels im Kontext der Rostocker Marienkirche
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den Kontext des Rostocker Rochusaltars innerhalb der Marienkirche. Die Kurzbeschreibung des Retabels beschreibt dessen Maße und architektonische Besonderheiten. Die Analyse des Mittelschreins konzentriert sich auf die Heiligenfiguren Rochus, Sebastian und Antonius, deren Ikonographie und Legenden. Weitere Kapitel befassen sich mit den Seitenflügeln und dem Gesprenge, sowie dem historischen Kontext, einschließlich der Pest und der möglichen Stiftung durch die Zunft der Wundärzte und Barbiere. Die Kapitel vermeiden jegliche Schlussfolgerungen und Spoiler.
Schlüsselwörter
Rostocker Rochusaltar, Benedikt Dreyer, Claus Berg, norddeutsche Schnitzkunst, Pest, hl. Rochus, hl. Sebastian, hl. Antonius, hl. Kosmas und Damian, hl. Christophorus, Ikonographie, Heiligenverehrung, Wundärzte, Barbiere, Marienkirche Rostock.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Rochusaltar in der Marienkirche Rostock?
Es handelt sich um ein Altarretabel aus der Zeit um 1534, das einer der wenigen erhaltenen Altäre aus der vorreformatorischen Zeit in Rostock ist.
Welchem Künstler wird das Rochusretabel zugeschrieben?
Die Forschung schreibt das Werk vorwiegend Benedikt Dreyer oder seinem Umfeld zu, wobei auch Claus Berg als möglicher Urheber diskutiert wurde.
Welche Heiligen sind auf dem Altar dargestellt?
Dargestellt sind unter anderem der hl. Rochus, der hl. Sebastian, der hl. Antonius sowie die Ärzte Kosmas und Damian – allesamt Schutzheilige gegen Pest und Krankheit.
Wer könnte den Altar gestiftet haben?
Aufgrund der dargestellten Patronatsheiligen wird vermutet, dass das Retabel eine Stiftung der Zunft der Wundärzte und Bartscherer war.
Welche Bedeutung hatte der Altar für die Gläubigen der damaligen Zeit?
Der Altar diente der Verehrung von Pestheiligen und sollte den Menschen in Zeiten von Epidemien Hoffnung und göttlichen Beistand vermitteln.
- Arbeit zitieren
- Carla Pohl (Autor:in), 2008, Das Rochusretabel der Marienkirche zu Rostock, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120881