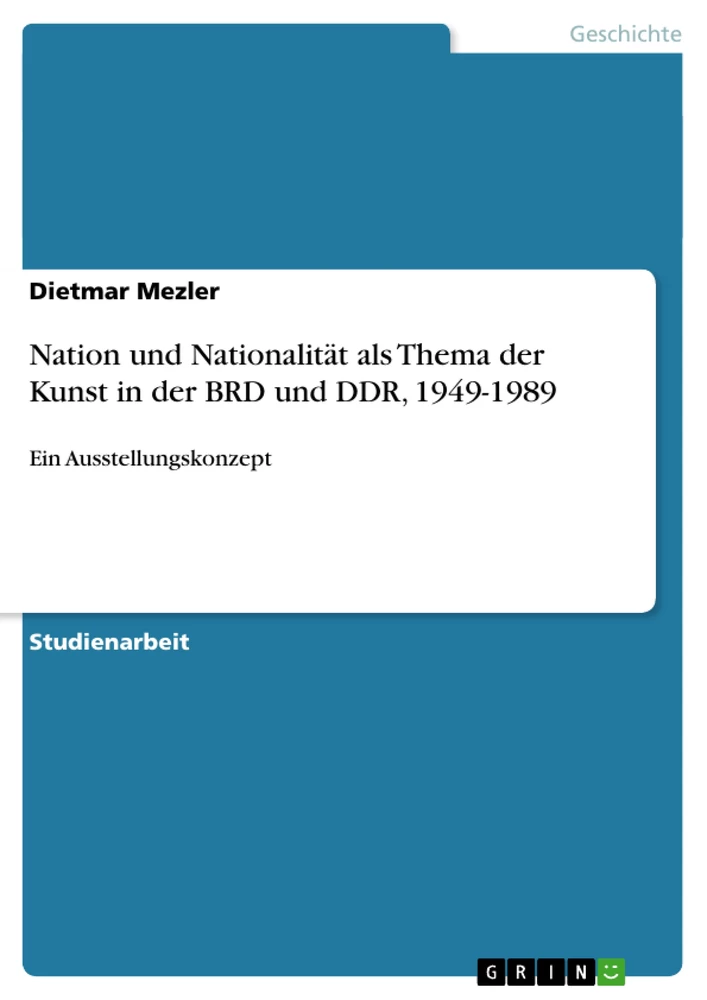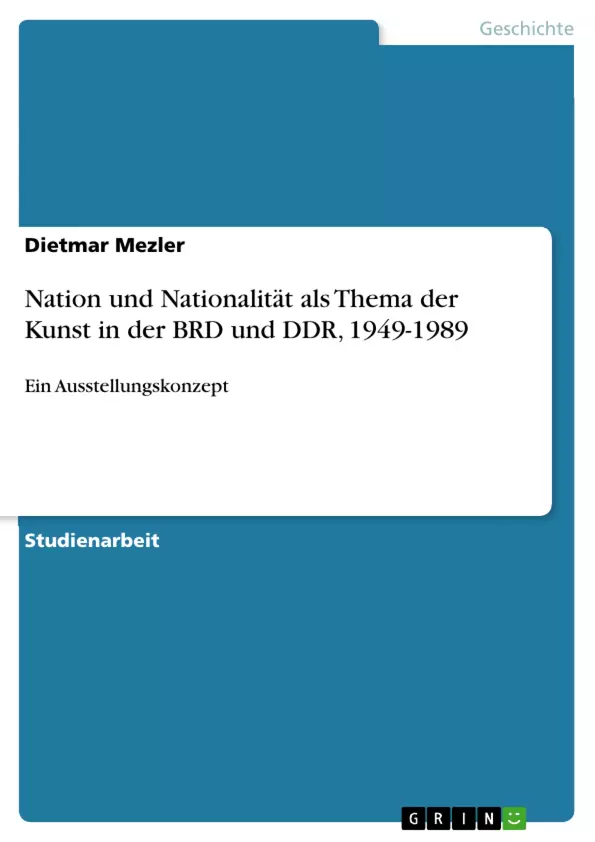Europaweit bildet Deutschlands nationale Geschichte einen Ausnahmefall. Während andere Länder eine relativ homogene Nationalgeschichte durchschritten haben, durchlief die deutsche Nation unterschiedliche Entwicklungsstadien, deren Nachwirkungen immer noch spürbar sind. Die Sonderstellung der „Nation“ lässt sich ebenso auf die besondere Stellung der deutschen Kunst übertragen.
Diese Hausarbeit beschäftigt sich in erster Linie mit den kulturpolitischen Entwicklungen in der DDR. Von diesen ausgehend soll zunächst die Situation der Kunst und der Literatur in der Zeit zwischen 1949 bis 1989 untersucht werden. In zweiten Schritt soll hieraus ein fiktives Ausstellungskonzept entwickelt werden, das jedoch nicht nur die Kunst der DDR zum Thema hat, sondern die Kunstentwicklung beider Staaten in einen Dialog zu stellen vermag.
Der erste Teil dieser Hausarbeit beschäftigt sich mit den kulturpolitischen Tendenzen und ihren Entwicklungsstufen in der DDR. Anhand einiger Eckdaten und wichtiger Ereignisse werden chronologisch die Umstände nachgezeichnet, die sich auf die Arbeit der Künstler der DDR teils hemmend und einschränkend, teils fördernd ausgewirkt haben. Hierbei orientiere ich mich hauptsächlich am Artikel von Rüdiger Thomas . Im Rahmen dieser Hausarbeit ist es mir leider nicht möglich parallel dazu die kulturpoliti-sche Entwicklung in der BRD zu untersuchen, um die Motivation der westdeutschen Künstler verständlicher zu machen.
Im nächsten Schritt stelle ich zwei Künstler vor, die stellvertretend für die weitere Auswahl auszustellender Kunstwerke sein sollen. Als einen kritisch-politischen Künstler der BRD habe ich Jörg Immendorff und seinen Zyklus „Café Deutschland“ gewählt; ihm gegenüber stelle ich Bernhard Heisig vor und seine Auseinandersetzung mit dem Faschismus in seiner Lithographiefolge „Der faschistische Alptraum“. Das konzeptionelle, selbstreflexive Arbeiten mit den Themen der Vergangenheit und der Gegenwart und die Suche nach einer nationalen Identität eint die Werke beider Künstler und erlaubt einen zonenübergreifenden Dialog, der zu der Zeit der Deutschlandteilung nicht möglich gewesen war.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Deutschlands innerpolitische Spannungen
- Das Ausstellungskonzept
- Kulturpolitische Entwicklung in der SBZ/DDR, 1945-1989
- Kriegsende - Neuanfang?
- Instrumentalisierung der Kunst
- Formalismuskritik
- Zuspitzung des kulturpolitischen Konfliktes
- Kontrolle des künstlerischen Schaffens
- Sozialistischer Realismus als Richtlinie
- Rehabilitierung der Kunst der Romantik
- „Die Zwei-Linien-Sicht“ – ein Modell der historischen Legitimierung
- Historisierende Tendenzen
- Dialogversuche mit dem Westen
- Bitterfelder Weg
- Neue Tendenzen in der Kunst – Leipziger Schule
- Fortschreitende Abgrenzung
- Ingrid Mittenzwei – Revision des Geschichtsbildes
- Autonomieansprüche der Kunst
- Überreste der Staatskunst
- Jörg Immendorff - Café Deutschland
- Bernhard Heisig - Der faschistische Albtraum
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die kulturpolitische Entwicklung in der DDR von 1949 bis 1989 und entwickelt daraus ein Ausstellungskonzept, das die Kunstentwicklung beider deutscher Staaten in einen Dialog bringt. Ziel ist es, gängige negative Beurteilungen der DDR-Kunst zu hinterfragen und das künstlerische Streben nach Aufklärung und Auseinandersetzung mit der Vergangenheit in den Vordergrund zu stellen.
- Kulturpolitische Entwicklung in der DDR
- Die Instrumentalisierung der Kunst in der DDR
- Der Dialog zwischen Ost und Westdeutscher Kunst
- Die Suche nach nationaler Identität in der Kunst
- Künstlerische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die innerdeutschen Spannungen und das Konzept der geplanten Ausstellung. Kapitel 2 analysiert die kulturpolitische Entwicklung in der DDR, von den widersprüchlichen Gefühlen nach dem Kriegsende bis hin zu neuen Tendenzen in der Kunst und der kritischen Auseinandersetzung mit dem Geschichtsbild. Die Kapitel 3 und 4 präsentieren Jörg Immendorff und Bernhard Heisig als exemplarische Künstler, deren Werke den geplanten Dialog zwischen Ost und West repräsentieren.
Schlüsselwörter
DDR, BRD, Kunst, Kulturpolitik, Sozialistischer Realismus, nationale Identität, Geschichtsbild, Jörg Immendorff, Bernhard Heisig, Deutschlandteilung, Bitterfelder Weg, Formalismuskritik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptziel dieser Hausarbeit?
Ziel ist es, die kulturpolitische Entwicklung in der DDR von 1949 bis 1989 zu untersuchen und ein fiktives Ausstellungskonzept zu entwerfen, das die Kunstentwicklung von Ost- und Westdeutschland in einen Dialog bringt.
Welche Rolle spielte der Sozialistische Realismus in der DDR-Kunst?
Der Sozialistische Realismus diente als offizielle Richtlinie zur Kontrolle des künstlerischen Schaffens und zur Instrumentalisierung der Kunst für politische Zwecke.
Welche Künstler werden als Repräsentanten für Ost und West gegenübergestellt?
Jörg Immendorff (BRD) mit seinem Zyklus „Café Deutschland“ wird Bernhard Heisig (DDR) und seiner Lithographiefolge „Der faschistische Alptraum“ gegenübergestellt.
Was war der „Bitterfelder Weg“?
Der Bitterfelder Weg war eine kulturpolitische Programmatik in der DDR, die darauf abzielte, die Trennung zwischen Kunst und Leben bzw. zwischen Künstlern und Arbeitern aufzuheben.
Wie wurde die Kunst der Romantik in der DDR behandelt?
Die Arbeit beschreibt eine Phase der Rehabilitierung der romantischen Kunst als Teil der historischen Legitimierung und Revision des Geschichtsbildes in der DDR.
Was eint die Werke von Immendorff und Heisig laut der Autorin?
Beide Künstler eint das selbstreflexive Arbeiten mit Themen der Vergangenheit und Gegenwart sowie die Suche nach einer nationalen Identität trotz der Deutschlandteilung.
- Arbeit zitieren
- MA Dietmar Mezler (Autor:in), 2006, Nation und Nationalität als Thema der Kunst in der BRD und DDR, 1949-1989, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120887