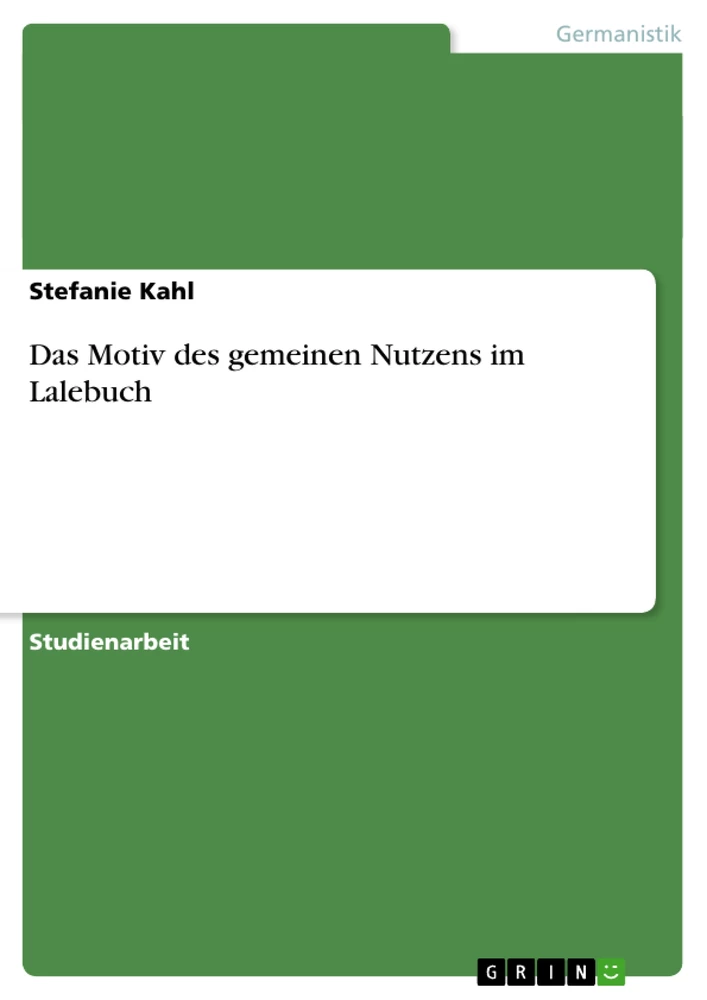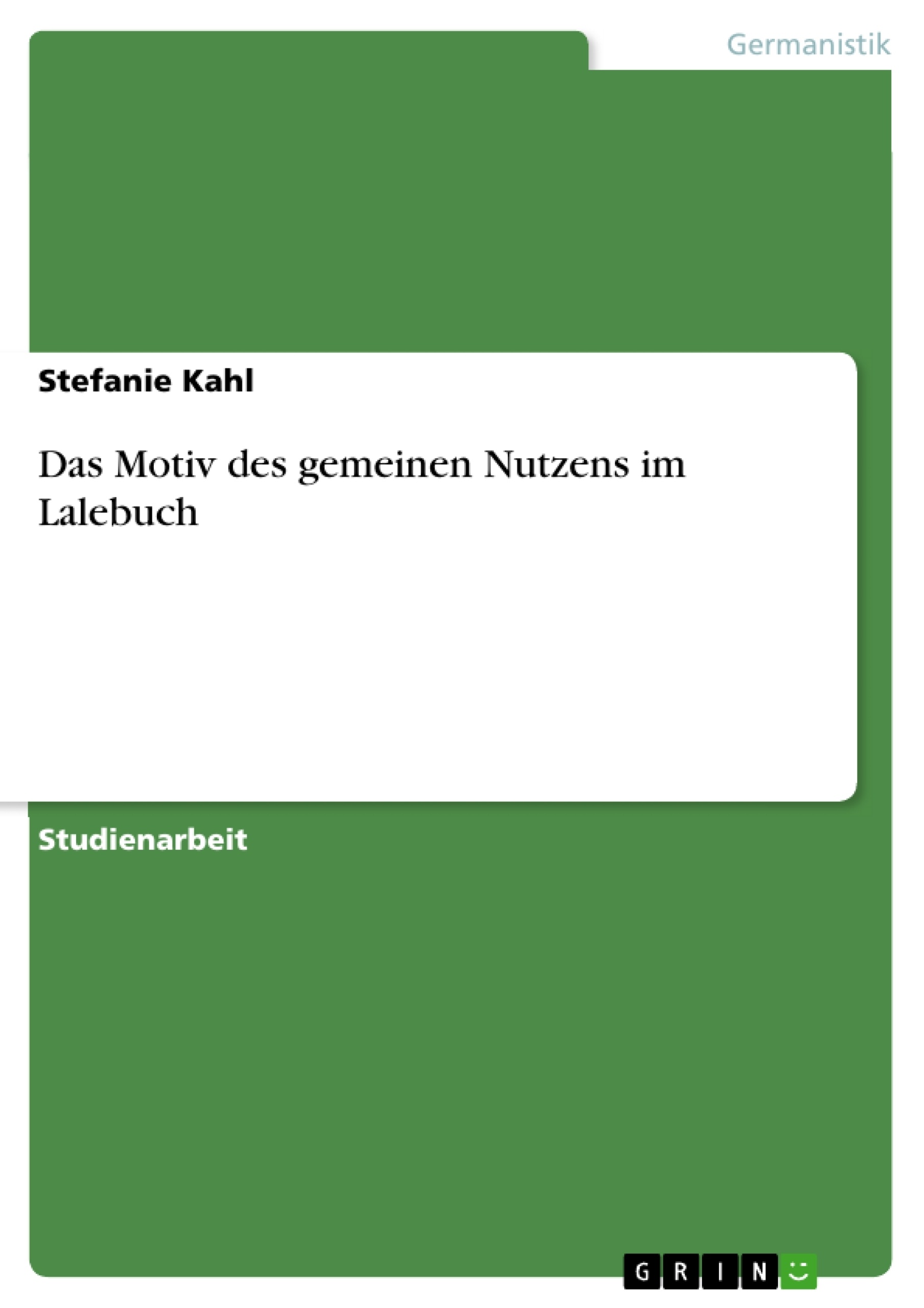In dem Grundkurs „Narrenfigurationen in der Literatur des Spätmittelalters“ beschäftigten wir
uns mit den verschiedenen Formen der Narrheit in besonderen und berühmten Werken dieser
Epoche. Dazu zählten unter anderem Iwein, Lancelot und Tristan, aber auch die Narren von
Brants „Narrenschiff“. Den Inhalt eines Seminars bildete das Thema „Alle gemeinsam oder
Wie aus Weisen Narren werden“. Die Grundlage dieser Diskussion fanden wir im
„Lalebuch“, einer 1597 erstmals gedruckten Schwanksammlung, die sich bis heute im
Original und in vielen Bearbeitungen großer Beliebtheit erfreut. Die Geschichte der Lalen hat
mich besonders fasziniert und angesprochen und ich möchte mich deshalb im Folgenden
näher mit ihr auseinandersetzen.
Um den Text später genau untersuchen zu können, gebe ich zunächst eine kurze
inhaltliche Zusammenfassung. Meinen Schwerpunkt werde ich jedoch auf das Motiv des
Gemeinen Nutzens, das sich durch das gesamte Werk zieht, legen. Da das Streben nach
diesem Nutzen eng mit der angenommenen Narrheit der Lalen verbunden ist, möchte ich
zuvor allerdings die Entwicklung der Narrheit erläutern.
Außerdem hoffe ich, eine Antwort auf die Frage zu finden, inwieweit es sich bei den
Anstrengungen der Lalen um Aktionen zum Wohle aller handelt, oder ob es vielleicht doch
manchmal eher der Gedanke des Eigennutzes ist, der sie zu ihren Taten anspornt.
Beim Lesen des Textes kann man auch erkennen, dass aus dem erwünschten Nutzen
schnell und oft eher ein großer Schaden für die ganze Lalengemeinschaft entsteht. Ich möchte
versuchen, diesen Gegensatz darzulegen und zu klären, in welchem Maße der Nutzen oder
Schaden im Vergleich mit der Narrheit steigt beziehungsweise sinkt.
Stützen werde ich mich in meinen Erläuterungen hauptsächlich auf die Artikel von
Werner Röcke, Hans Joachim Behr und Fritz Stroh, (und natürlich auf „Das Lalebuch“ in der
Ausgabe von 1998, herausgegeben von Stefan Ertz), die wie alle anderen Hilfsmittel genauer
im Literaturverzeichnis angegeben sind.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einführung
- II. Inhaltliche Zusammenfassung
- III. Entwicklung der Narrheit
- IV. Alle gemeinsam oder Jeder für sich?
- a. Das Motiv des gemeinen Nutzens
- b. Der gemeinsame Eigennutz
- c. Vom Gemeinnutzgedanken zum Egoismus
- V. Gemeiner Nutz vs. Gemeiner Schaden
- VI. Abschlussbetrachtung
- VII. Literaturverzeichnis
- a. Primärliteratur
- b. Sekundärliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Motiv des gemeinen Nutzens im „Lalebuch“, einer Schwanksammlung aus dem Jahr 1597. Die Analyse fokussiert auf die Verbindung zwischen dem Streben nach gemeinsamem Nutzen und der dargestellten Narrheit der Lalen. Es wird die Frage beleuchtet, inwieweit altruistische oder egoistische Motive das Handeln der Lalen bestimmen und wie sich der angestrebte Nutzen in Schaden verwandelt.
- Das Motiv des gemeinen Nutzens im „Lalebuch“
- Die Verbindung zwischen Narrheit und dem Streben nach Nutzen
- Der Gegensatz zwischen angestrebtem Nutzen und resultierendem Schaden
- Die Entwicklung der Narrheit im Kontext der Geschichte der Lalen
- Analyse der Handlungen der Lalen und ihrer Motivationen
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einführung: Diese Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und beschreibt den Kontext des Seminars „Narrenfigurationen in der Literatur des Spätmittelalters“, in dem die Arbeit entstanden ist. Die Autorin erklärt ihre Faszination für die Geschichte der Lalen und skizziert ihren Forschungsansatz, der sich auf das Motiv des gemeinen Nutzens konzentriert und die Entwicklung der Narrheit im „Lalebuch“ untersucht. Die Arbeit zielt darauf ab, die Motivationen der Lalen zu analysieren und den Gegensatz zwischen angestrebtem Nutzen und daraus resultierendem Schaden zu beleuchten. Die Autorin benennt die wichtigsten Quellen, auf die sie sich stützt.
II. Inhaltliche Zusammenfassung: Dieses Kapitel bietet eine knappe Inhaltsangabe des „Lalebuchs“. Es beschreibt die Lalen als eine Gemeinschaft, deren Vorfahren einst weise Berater an Fürstenhöfen waren, die aber nach erlittenem Undank in die Bauernwelt flohen. Die Lalen erben sowohl die Weisheit ihrer Vorfahren als auch den Bauernstand, was zu einem Konflikt führt. Sie stehen vor der Wahl, entweder die Weisheit oder den Bauernstand aufzugeben, um die göttliche Ordnung wiederherzustellen. Trotz des vorhersehbaren Scheiterns, folgen sie erneut dem Ruf der Fürsten als Berater, was zu weiteren Problemen führt. Schliesslich geben sie die Weisheit zugunsten der Narrheit auf um die Beratertätigkeit zu meiden.
Schlüsselwörter
Lalebuch, Gemeiner Nutzen, Narrheit, Spätmittelalter, Schwanksammlung, Eigennutz, Weisheit, Bauernstand, Gemeiner Schaden, altruistische Motive, egoistische Motive.
Häufig gestellte Fragen zum Lalebuch
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit analysiert das Motiv des gemeinen Nutzens in der Schwanksammlung „Lalebuch“ (1597). Im Mittelpunkt steht die Verbindung zwischen dem Streben nach gemeinsamem Nutzen und der dargestellten Narrheit der Lalen. Untersucht wird, wie altruistische und egoistische Motive das Handeln der Lalen beeinflussen und wie angestrebter Nutzen in Schaden umschlägt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet folgende Themen: Das Motiv des gemeinen Nutzens im „Lalebuch“, die Verbindung zwischen Narrheit und Nutzenstreben, den Gegensatz zwischen angestrebtem Nutzen und resultierendem Schaden, die Entwicklung der Narrheit im Kontext der Geschichte der Lalen sowie die Analyse der Handlungen und Motivationen der Lalen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Eine Einleitung, eine inhaltliche Zusammenfassung des „Lalebuchs“, ein Kapitel zur Entwicklung der Narrheit, ein Kapitel zum Verhältnis von „Alle gemeinsam“ und „Jeder für sich“ (mit Unterkapiteln zum Motiv des gemeinen Nutzens, gemeinsamen Eigennutzes und dem Übergang vom Gemeinnutz zum Egoismus), ein Kapitel zum Gegensatz zwischen gemeinem Nutzen und gemeinem Schaden, eine Abschlussbetrachtung und ein Literaturverzeichnis (mit Primär- und Sekundärliteratur).
Was wird in der Einleitung besprochen?
Die Einleitung stellt das Thema vor, beschreibt den Kontext des Seminars „Narrenfigurationen in der Literatur des Spätmittelalters“, erläutert die Forschungsfrage und den Forschungsansatz der Autorin, benennt die wichtigsten Quellen und skizziert die Zielsetzung der Arbeit: die Analyse der Motivationen der Lalen und den Gegensatz zwischen angestrebtem Nutzen und resultierendem Schaden aufzuzeigen.
Welche Zusammenfassung des „Lalebuchs“ wird gegeben?
Kapitel II bietet eine knappe Inhaltsangabe des „Lalebuchs“. Es beschreibt die Lalen als Gemeinschaft, deren Vorfahren einst weise Berater waren, die aber nach erlittenem Undank in die Bauernwelt flohen. Die Lalen erben sowohl Weisheit als auch den Bauernstand, was zu einem Konflikt führt. Sie stehen vor der Wahl, Weisheit oder Bauernstand aufzugeben, um die göttliche Ordnung wiederherzustellen. Trotz vorhersehbaren Scheiterns folgen sie erneut dem Ruf als Berater, was zu Problemen führt. Schließlich geben sie die Weisheit zugunsten der Narrheit auf, um die Beratertätigkeit zu vermeiden.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Lalebuch, Gemeiner Nutzen, Narrheit, Spätmittelalter, Schwanksammlung, Eigennutz, Weisheit, Bauernstand, Gemeiner Schaden, altruistische Motive, egoistische Motive.
- Quote paper
- Stefanie Kahl (Author), 2001, Das Motiv des gemeinen Nutzens im Lalebuch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12091