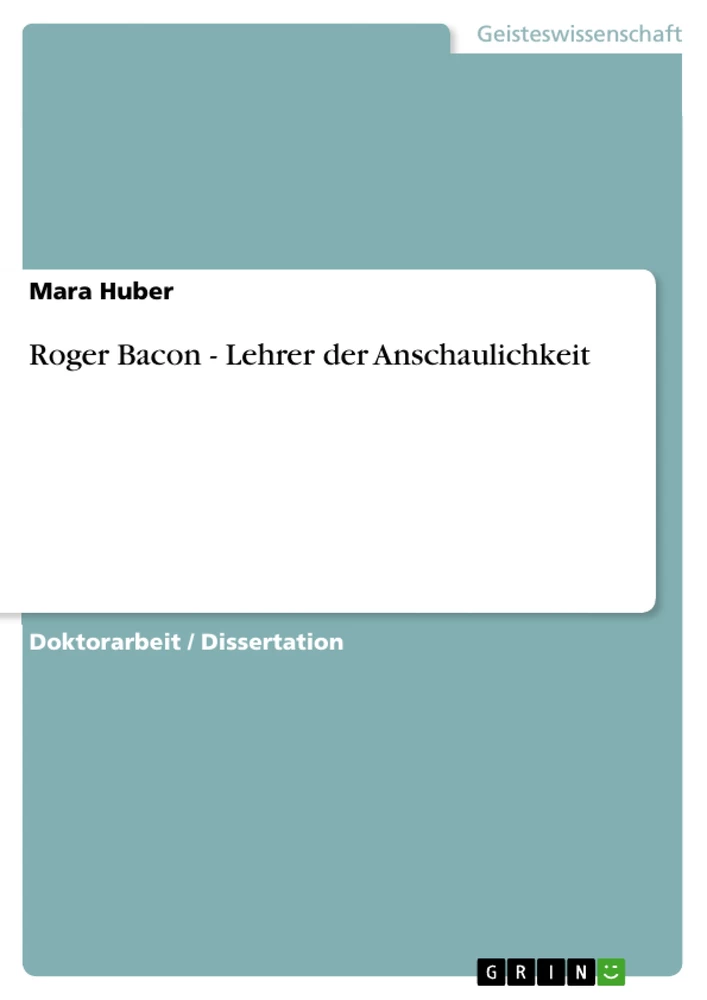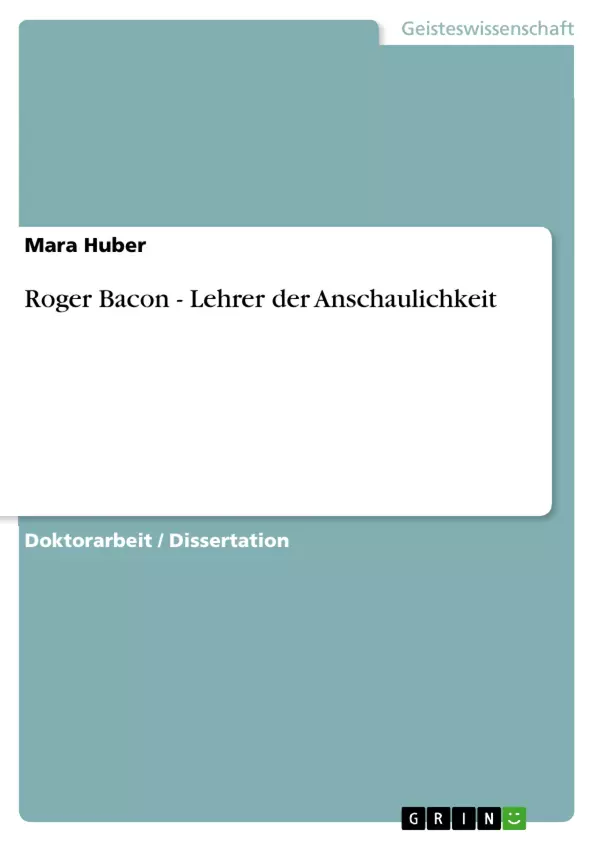Roger Bacons Philosophie wurde zu seinen Lebzeiten wie in der Forschung bis heute häufig als "unfranziskanisch" angesehen. Während ausgewogene Darstellungen selten blieben, machte die eine "Schule" aus ihm das unerkannte, weil leider mittelalterliche und leider katholische Genie ihrer eigenen Vorstellung von "moderner Wissenschaftlichkeit", die andere einen Querschläger und Wirrkopf. Auf diesem Stand blieb die Gesamteinschätzung Bacons, und in den letzten Jahrzehnten wurden nur noch Teil- und Randaspekte seiner Philosophie behandelt. In dieser Arbeit wird gezeigt, daß gerade der zentrale und spektakuläre Teil dieser Philosophie, die wissenschaftstheoretische Begründung des Experiments und ihre metaphysisch-epistemologischen Voraussetzungen, eine Ausprägung franziskanischer Geistigkeit ist – dabei wird auch zum erstenmal eine Deutung des neugefundenen Texts de signis vorgetragen.
INHALTSVERZEICHNIS:
I. DIE BEDEUTUNG DES EINZELNEN UND DIE FRANZISKANISCHE BEWEGUNG
1. Einzelnes und Allgemeines, ein Grundproblem der Philosophie
2. Der franziskanische "Weg der Bejahung" – die Transzendenz im Einzelnen
3. Die Vermittlung der Idee Franz von Assisis: Anschaulichkeit
4. Von der Praxis der Anschaulichkeit zur Philosophie der Anschaulichkeit
5. Zwischen Anschaubarkeit und Verstehbarkeit – die Sprache der Bilder
6. Roger Bacon OFM – Transzendenz des Einzelnen in einer anschaulichen Philosophie
II. DAS VERHÄLTNIS VON EINZELNEM UND ALLGEMEINEM BEI BACON
1. Das Sein der Einzeldinge und der Universalien
2. Das Einzelne und das Universale in der Erkenntnis
III. BACONS THEORIE DER VERANSCHAULICHUNG
1. Zeichen
2. Die experimentelle Wissenschaft
IV. EXKURS: Einzelnes und Universale bei Giotto
V. AUSBLICK: Wissenschaft vor und nach Descartes
VI. BIBLIOGRAPHIE
Addenda
I. DIE BEDEUTUNG DES EINZELNEN UND DIE FRANZISKANISCHE BEWEGUNG
1. Einzelnes und Allgemeines, ein Grundproblem der Philosophie
Eines der herausragendsten Merkmale abendländischer Zivilisation sei der Vorrang des Einzelnen vor dem Allgemeinen, des Individuums vor dem Kollektiv; dies ist eine oft geäußerte und schwer zu widerlegende Wahrheit, also eigentlich eine Binsenwahrheit. Auf solche Selbstdefinitionen wird in dem Maße mehr und mehr Wert gelegt, in dem man sich mit asiatischer Geistigkeit auseinandersetzt, die viele Probleme leichter zu meistern und, aus der Ferne gesehen, ungebrochener zu sein scheint als die des Westens. Aber trotz des geschichtsträchtigen Begriffes "abendländische Zivilisation" fehlt jener Positionsbestimmung oft genug die geschichtliche Tiefe. Bezieht man diese Dimension in die Überlegungen ein, so zeigt sich alsbald, wie wenig selbstverständlich der Vorrang des Einzelnen vor dem Allgemeinen in Europa tatsächlich ist: schon in der "Wiege des Abendlandes" findet sich mit der Feier der griechischen Tragödie ein Phänomen, das man getrost als kollektive Psychohygiene bezeichnen kann. Auch im mittelalterlichen Christentum ist es zunächst das Ganze, das zählt – trotz aller Absetzung vom Judentum – wie im gregorianischen Choral sinnenfällig wird, wenn die einzelne Stimme im einheitlichen Schwingen des Gesanges untertaucht. Der Christ ist ein Baustein im Tempel Gottes, er ist an seinem Platz, eingefügt, unsichtbar fast.
Am Ausgang des Mittelalters finden wir diese Einstellung nicht mehr, wohl aber in unserer eigenen jüngsten Vergangenheit, wo es zwar nicht das Volk Gottes, aber das Deutsche Volk zu leben galt. Man mag sich fragen, ob es gerade daran liegt, daß die Suche nach dem eigenen Ort und dem eigenen Weg – eine Suche, die umso dringlicher wird, je mehr Ort und Weg aus den Augen verloren sind – auf die Dimension der Geschichte so oft verzichtet, oder ob man nicht eine Krise des Denkens von noch größeren Ausmaßen vor sich hat. Doch in jedem Fall wird man sich nur dann orientieren können, wenn man weiß, woher man kommt.
Noch weniger als im gesellschaftlichen Leben trifft es in der Philosophie zu, daß in Europa immer das Einzelne das Eigentliche gewesen sei: im Gegenteil, denn Philosophie ist auf Sprache angewiesen, auf Begriffe, und diese ihrerseits sind das Ergebnis von Abstraktion und Verallgemeinerung des Einzelnen. Wenn ein Begriff wie "Mensch" verwendet wird, der nicht nur für ein Individuum gilt, sondern für die ganze Gattung der federlosen Zweibeiner, so wird von den Besonderheiten des Einzelwesens abstrahiert und etwas benannt, das allen Menschen gemeinsam ist – etwas Allgemeines. Sprache und Begriffe sind in sich von vornherein allgemein. Deshalb ist es für die Philosophie quasi die Quadratur des Kreises, Einzelnes adäquat zu erfassen.
Die Quadratur des Kreises ist aber nicht nur unwahrscheinlich – auch ihre Notwendigkeit oder Nützlichkeit ist nicht selbstevident. Dasselbe scheint für die Notwendigkeit oder Nützlichkeit des philosophischen Begreifens von Einzelnem zuzutreffen, denn die Philosophie Europas hat viele Jahrhunderte lang ganz ohne Bedauern darauf verzichtet. Für Platon war die Welt der Dinge, die wir heute die "real existierenden" nennen, der sinnlich erfaßbaren Einzeldinge, nur die Welt der Erscheinungen; ein Fluß von Werden und Vergehen, eine nur abgeleitete Wirklichkeit. Die ursprüngliche Wirklichkeit ist die Welt der Ideen, der unveränderlichen, dauerhaften Prinzipien des Seins. Diese Prinzipien waren etwas Allgemeines, und die Einzeldinge bezogen ihr Wesen aus ihrer Teilhabe an ihnen. So Ist schon im Euthyphron das Fromme aus keinem anderen Grunde gut als dem, daß es an der Idee des Frommen teilhat.
Ideen waren Seins- und gleichzeitig Erkenntnisprinzipien. Dies bedeutet, daß menschliche Erkenntnis sich nur im Allgemeinen vollzieht. Zwar waren sinnliche Wahrnehmungen, die ja von den Einzeldingen verursacht werden, der Ausgangspunkt der Erkenntnis – doch nur insofern, als sie den Erkennenden an die Ideen erinnerten, die er auf einer vorbewußten Stufe bereits besaß.
Auf diese Lehre stieß Augustinus und fand, daß sie in die christliche Weltsicht gut zu integrieren sei; so wurde Platon für die christliche Philosophie vereinnahmt. Ein kurzer Satz aus "De libero arbitrio" genügt, um die Affinität zu verdeutlichen:
Simul etiam te videre arbitror in illa (lege) temporali nihil, esse iustum atque legitimum quod non ex hac aeterna.
Die Autorität des Augustinus und Boethius sorgte nun dafür, daß Platons Lehre von den ewigen Ideen, die das eigentliche Sein der einzelnen Dinge – ihre Urbilder – darstellten, nicht in Vergessenheit geriet, sondern zunächst unangefochtene Lehrmeinung der Universitäten war. Die Welt der Ideen wurde nach Augustinus "in mente divina", im Geist des christlichen Gottes lokalisiert.
Als moderner Christ fragt man sich vielleicht, warum es denn ganz ohne Frage dem Christentum entspreche, die eigentliche Bedeutung der geschaffenen Welt außerhalb ihrer und getrennt von ihr zu sehen – es könnte ja auch so sein, daß ein Geschöpf seine Transzendenz in sich trägt. Man denkt hier vielleicht an Schlagworte wie "Vertröstung aufs Jenseits" und "Religion ist Opium fürs Volk", die angesichts solcher Lehrmeinungen einer gewissen Berechtigung nicht zu entbehren scheinen. Man erinnert sich an Heilige wie Antonius von Ägypten, der mit seinem "Weg der Entsagung", dem Weg der Abkehr von allem irdisch-Vergänglichen, um sich nur dem Ewigen zuzuwenden, ja der Lehre des Augustinus entspricht, und dessen Frömmigkeit heute unverständlich, befremdlich, ja bedenklich anmutet. Für eine solche Fragestellung war aber die Zeit zunächst noch nicht gekommen. G. K. Chesterton hat in diesem Zusammenhang eine faszinierende Vermutung geäußert: er interpretiert jene Geringschätzung des Irdischen als Mittel, um das Christentum von den Naturreligionen abzusetzen, mit denen es ursprünglich zu konkurrieren hatte.
Nothing could purge this obsession but a religion that was literally unearthly. It was no good telling such people to have a natural religion full of stars and flowers; there was not a flower or even a star that had not been stained. They had to go into the desert where they could find no flowers or even into the cavern where they could see no stars. Into that desert and that cavern the human intellect entered for some four centuries; and it was the very wisest thing it could do. Nothing but the stark supernatural stood up for its salvation; if God could not save it, certainly the Gods could not.
Ob nun wirklich, wie Chesterton mit engagierten Worten darlegt, die Verquickung mit der Fleischeslust den Bankrott der griechischen Religion verschuldet hat, braucht hier nicht entschieden zu werden – es wird nur ein wenig bezweifelt. Doch der Gedanke, daß das Christentum zur Ausgrenzung der Naturreligionen das Element der Ferne und gänzlichen Andersartigkeit Gottes so stark hervorhob (für heutige Bedürfnisse sicher zu stark), kann auch dem Zweifler einleuchten. "Die Natur, die Schöpfung ist nicht Gott": das mußten die neuen Christen lernen. Inzwischen haben sie es gelernt, und erschreckend gut.
Mit dem Auftreten Franz von Assisis vollzog sich hier eine Wende, zeitlich etwa parallel mit der Wende von der Frühscholastik zur Hochscholastik. Doch der Dissens über die Bedeutung der Ideen bzw. Formen oder auch Universalien begann nicht erst hier, sondern hatte bereits Geschichte. In Johannes von Salisburys Metalogicon findet sich ein kurzer Abriß der Geschichte des Universalienstreites bis zum Ende der Frühscholastik; es scheint zweckmäßig, ihn hier kurz zu paraphrasieren. Johannes von Salisbury beschreibt acht verschiedene Positionen; die drei ersten sind Varianten des Nominalismus:
1) Universalien sind Namen, "voces", oder genauer noch, Klanggebilde. Dies ist Rosselins Position.
2) Sie sind Redeweisen, "sermones", oder auch in etwa Wortinhalte, wie Abaelard meint. Dieser gebraucht auch manchmal den Ausdruck "status", den Salisbury nicht erwähnt, und der in die Richtung eines gemäßigten Realismus weist. Den vorgestellten Standpunkt des "Peripateticus Palatinus Abaelardus noster" hält Salisbury im übrigen bei aller Freundschaft für eine Verdrehung.
3) Universalien sind Verstandesdinge, rein innerpsychische Wirklichkeit als "genus" oder "species", laut Salisbury nach einer Verdrehung der Worte von Aristoteles, Boethius und Cicero.
Zwischen den Positionen 3 und 4 vollzieht sich der Übergang zum gemäßigten Realismus, der Auffassung, daß Universalien auch außerhalb des Verstandes eine Wirklichkeit zukommt, allerdings verbunden mit und abhängig von den Einzeldingen. Diese Auffassung war zu Bacons Zeit die allgemeingültige geworden und wurde auch von ihm geteilt – mit Modifikationen und Eigenheiten, von denen noch die Rede sein wird – und soll daher im Ganzen wiedergegeben werden:
1) Eorum uero qui rebus inherent, multe sunt et diuerse opiniones. Siquidem hic, ideo quod omne quod est, unum numero est, rem uniuersalem aut unam numero esse aut omnino non esse concludit. Sed quia impossibile substantialia non esse, existentibus his quorum sunt substantialia, denuo colligunt uniuersalia singularibus quod ad essentiam unienda, Partiuntur itaque status, duce Gautero de Mauretania, et Platonem, in eo quod Plato est, dicunt indiuiduum; in eo quod homo, speciem; in eo quod animal, genus, sed subalternum; in eo quod substantia, generalissimum. Habuit hec opinio aliquos assertores; sed pridem hanc nullus profitetur.
Das hier angesprochene Problem, von Boethius im Porphyrius-Kommentar überliefert, hat auch Bacon beschäftigt, ohne daß er es mehr als aufzeigen konnte. Es ist der anscheinend unauflösliche Widerspruch zwischen dem Axiom, daß alles Seiende ein Eines und Individuiertes ist, und der Definition des Universale als ein allgemeines Seiendes. Die Zusatzbemerkung, daß die Lehre des gemäßigten Realismus obsolet geworden sei, entspricht vielleicht wiederum mehr Salisburys Präferenzen als dem tatsächlichen Sachverhalt. Seine Sympathien nämlich lagen recht eindeutig beim sogen. "extremen" bzw. "exzessiven" Realismus, der das Erbe des Neoplatonismus bewahrte und an der Idee, dem Universale als dem Urbild der Dinge festhielt, das unvergänglich und unveränderlich sei und in einem volleren Sinne Sein besitze als die aus ihm individuierten Einzeldinge. Allerdings ist diese Auffassung, der Salisbury als einziger nicht heftig widerspricht, nicht von Aristoteles herleitbar, der ja die platonischen Ideen zu "formae", den Dingen innewohnenden Formprinzipien umdeutete; dies konnte aber Johannes von Salisbury nicht daran hindern, die neoplatonische Lösung für die richtige zu erklären.
2) Nur species und genus bzw. Idee oder Universale sind im eigentlichen Sinne wirklich. Als Vertreter dieser Lehre werden Platon, Augustinus und Bernhard von Chartres genannt, dazu Seneca mit dem Satz "bis in idem flumen descendimus et non descendimus." Die Deutung soll die Dauerhaftigkeit des Universale und damit seinen höheren Seinswert belegen: der Fluß als Äquivalent der species bleibt derselbe, wenn auch die Wellen, quasi als Individuen, vergehen.
Der nächste Standpunkt ist der des Aristoteles in der Deutung des Gilbertus Pictavensis, der zum gemäßigten Realismus zugeordnet werden kann. Sein und anderer Lehrer (wie Bernhard von Chartres’) Bemühen, Aristoteles und Platon miteinander in Einklang zu bringen, findet Salisbury überflüssig und auch hoffnungslos, doch wurde es eines der Hauptanliegen der Hochscholastik. Der Abschnitt über den Versuch des Bischofs Gilbert ist daher als Ganzer von Interesse:
3) Porro alius, ut Aristotilem exprimat, cum Gilleberto episcopo Pictauensi uniuersalitatem formis natiuis attribuit et in earum conformitate laborat. Est autem forma natiua originalis exemplum et que non in mente Dei consistit, sed in rebus creatis inheret. Hec Greco eloquio dicitur idos, habens se ad ideam ut exemplum ad exemplar; sensibilis quidem in re sensibili, sed mente concipitur insensibilis; singularis quoque in singularis, sed in omnibus universalis.
Es fällt auf, daß Gilbert eine eigene Welt der Ideen "in mente divina" nicht leugnen will, sondern statt dessen die Identität der Ideen mit den Universalien. Das Universale ist nicht "idea", sondern "idos" und verhält sich zur Idee wie Abbild zu Urbild. Seine Seinsweise richtet sich nach der "res", der es innewohnt: Sinnenfällig im Sinnenfälligen, geistig im Geistigen und, unbeschadet seiner allgemeinen Natur, einzeln im Einzelnen. Die Seinsweise des Universale wird bei Roger Bacon ganz ähnlich verstanden. Gilbert aber konnte durch die Unterscheidung von "idos" und "idea" die Lehre des Aristoteles vertreten, ohne sich in dieser Frage auf einen Konflikt mit dem Platonismus einzulassen, und folglich auch ohne die Kritik Johannes von Salisburys herauszufordern. Umso mehr zog sich Josselin diese Kritik zu mit seiner Meinung, Universalität entstünde erst bei der Zusammenfassung von Vielem zu Einem.
4) Universalien wohnen den Einzeldingen nicht inne; sie sind ein Produkt von Zusammenfassung.
Warum Salisbury diese Lehre nicht zu den nominalistischen zählt, wie er es ja mit Abaelard tut, ist nicht ganz ersichtlich; doch ist sie trotz ihrer Plausibilität für den heutigen Menschen für ihn so absurd, daß sie darin nur noch von dem Versuch übertroffen wird, das Universalienproblem mit Hilfe lebendiger Sprachen zu lösen. Die Zuflucht zu ihnen kann nur ein Motiv haben: mangelnde Kenntnis des Lateinischen.
5) Universalien sind manieres, wobei die Bedeutung dieses Wortes unklar bleibt.
Was nicht lateinisch oder in einer anderen toten Sprache ausgedrückt wurde, brauchte kein Wissenschaftler ernst zu nehmen. Latein war die Sprache, die für hohe Dinge allein angemessen war – die "Vulgärsprachen" waren für das niedere Volk, den "vulgus", und die niederen Dinge. Zwar gab es schon den provenzalischen Minnesang, doch war dieser für die Elite an den Hochschulen eben auch "vulgär". Vor Franz von Assisis "Cantico di Frate Sole" auf Umbrisch gab es praktisch keine vulgärsprachliche Literatur in Italien, und erst Dante mit den Dichtern des "dolce stil novo" verhalf der Volkssprache zum Durchbruch als Medium für anspruchsvolle Inhalte – obwohl auch sein Verhältnis zu ihr gespalten war. Interessant ist nebenbei eine Formulierung, in der er für das Lateinische dieselben Vokabeln verwendet wie die Neoplatoniker für das Universale, und für das volgare dieselben wie jene für das Einzelne:
Lo latino è perpetuo e non corruttibile e lo volgare è non stabile e corruttibile.
Die Zusammenfassung der Bestandsaufnahme Johannes von Salisburys über die verschiedenen Auffassungen zur Universalienfrage ist, wie bei ihm nicht anders zu erwarten, kurz, aber nicht ohne "Biß": "quot homines, tot sententiae."
2. Der franziskanische "Weg der Bejahung" – die Transzendenz im Einzelnen
Dies war der Stand der Dinge, als die Bewegung des Franz von Assisi begann, ihre Wirkung über ganz Europa auszudehnen und bis an die Universitäten vorzudringen, um fortan in den Wissenschaften eine tragende Rolle zu spielen. Ihr Begründer hätte eine solche Entwicklung wahrscheinlich nicht gern gesehen, denn er hegte ein tiefes Mißtrauen gegen die Wissenschaft als Versuchung zum Hochmut und war wohl auch der Ansicht, daß das, worauf es ihm ankam, in ihrer Sprache nicht auszudrücken und mit ihren Methoden nicht zu fassen sei. Zu seinem Charisma und seinem spontanen Erfolg gehörte eine Art der Vermittlung, die das Gegenteil von "systematisch" war, die in ihrer Unmittelbarkeit gleichsam direkt das Herz erreichte, ohne den Weg über den Kopf und seine Kategorien zu nehmen. Franziskus war kein Philosoph – er war Dichter, aber mehr als das und ursprünglicher war er Schauspieler. Er verkörperte selbst seine Botschaft, bevor er daran dachte, sie schriftlich zu formulieren. Die einzige methodische Anweisung, die dieser "Clown Gottes" seinen Mitbrüdern für die Predigt gab, hieß "plus exemplo quam verbo". öffnete die Türe des Dunklen Zeitalters. Er verkörperte die Versöhnung der Christen mit der Schöpfung und mit sich selbst als Teilen der Schöpfung. Die Natur wurde nun nicht erneut als Gott selbst angesehen, sondern als gottgewollt, gottgeliebt, "gottesträchtig" in dem Sinne, daß der Schöpfer in ihr seine Spuren hinterlassen hatte wie ein Siegel auf dem Wachs, das es formt.
Aus dem gemeinsamen Ursprung alles Geschaffenen ergab sich die Verbrüderung des Menschen mit seinen Mitgeschöpfen, von Bruder Sonne und Schwester Wasser bis zum "Bruder Esel", dem eigenen Körper. Der Weg des Heils lag nicht mehr einzig in der Abwendung von allem, das nicht Gott war, sondern konnte auch gegangen werden in der Zuwendung zu allem, was aus Gott war. So sehr dies auf der Oberfläche Franziskus zum "Grünen Heiligen" zu prädestinieren scheint, ist doch der Ursprung der Brüderlichkeit in der gemeinsamen Gotteskindschaft das, worauf es Franziskus selbst ankam, und ohne das man ihn mißversteht.
Zusammen mit der Vermittlung, die wegen ihrer Anschaulichkeit geeignet war, jeden, auch den einfältigsten Menschen zu erreichen, war dieser Inhalt das, was die Christen sofort anzog: Du darfst ein Mensch mit einem Körper und mit Schwächen sein, du darfst die Schönheiten der Schöpfung empfinden. Es wurde etwas zugelassen und sogar gutgeheißen, das sie ohnehin nicht vermeiden konnten – es sei denn, sie versuchten, Übermenschen zu sein und riskierten dabei, Unmenschen zu werden. Gewiß wurde es als unglaubliche Befreiung empfunden, Christ sein zu können, ohne diesem Zwang zu unterliegen; und gewiß erklärt sich auch so das Neuerwachen des Interesses an der Frömmigkeit: sie lag ja nun im Bereich des Menschenmöglichen. Die dramatische Vermittlung, mit der Franziskus spirituelle Inhalte anschaubar, sinnlich erfaßbar machte, verdient eine nähere Betrachtung:
Zwischen zwei Dialogpartnern, die dieselbe Sprache in vergleichbarer Weise beherrschen, werden Inhalte in dieser Sprache vermittelt und verstanden. Dies ist nicht mehr problemlos möglich, wenn einer der Partner mehr versteht als der andere. Ein solcher Vorsprung kann auf einen Unterschied der Sprachkompetenz zurückgehen, etwa wenn die Dialogpartner verschiedene Muttersprachen haben. Oder es kann sich um eine Fachsprache bzw. einen in irgendeiner Hinsicht spezifischen "Code" innerhalb der Verständigungssprache handeln, der bei gleicher allgemeinsprachlicher Kompetenz einem Partner geläufiger ist als dem anderen. Einer der Partner könnte auch weniger sprachbegabt oder intelligent sein als der andere, und schließlich könnte der zu vermittelnde Inhalt etwas sein, das anders ist als alles, woran der Adressat gedanklich und sprachlich anknüpfen kann, etwas, das jenseits seiner Denkgewohnheiten liegt und ihm ganz neu ist.
Wie die Vermittlung in solchen Fällen erfolgt, hängt zunächst vom Grad der Verständigungsschwierigkeit ab. Ist er nicht gravierend, kann eine anschauliche, metaphorische Sprechweise schon helfen. Ein größeres Problem löst vielleicht eine optische Darstellung, und schlimmstenfalls wird der Körper, die Sprache der Gesten zu Hilfe genommen. Außerdem hängt die Wahl der Ausdrucksmittel mit dem Inhalt zusammen – nicht jeder Sachverhalt eignet sich beispielsweise zur graphischen Darstellung – und auch die Persönlichkeit des Vermittlers spielt eine Rolle: mancher Sprecher wird sofort gestikulieren, wenn er sich nicht verstanden fühlt. Die Trennung dieser Vermittlungsweisen ist künstlich; in der Wirklichkeit werden sie kombiniert.
Bei Franz von Assisi würde man sagen, daß er etwas zu vermitteln hatte, das die Denkgewohnheiten seiner Zeitgenossen (Ausnahmen bestätigen die Regel) überstieg und deshalb zunächst unverständlich war, und daß er seinem Temperament entsprechend sofort mit dem Gestikulieren anfing: er gestikulierte mit seiner gesamten Existenz. Nun ist das Existieren, der Lebensvollzug sicher die ursprünglichste, unmittelbarste, wenn man will, "naivste" Ausdrucksweise. Doch diese Naivität hat bei Franziskus nichts mit Dummheit oder Gedankenlosigkeit zu tun – es ist schon eine "geniale Naivität", oder auch "nachnaiv", so wie die Redeweise der Theologie nach Bultmann "nachmythisch" genannt wird. Denn die letztlich gültigen, die "wesentlichen" Antworten auf die wesentlichen Fragen sind immer am Ende wieder existentiell, immer am Ende wieder ein Ich Bin. Eine Naivität, in der der Anfang und das Ende in dem Ich Bin zusammenkommen, ist eine göttliche Naivität. Sie ist es, die Franziskus zum Clown Gottes, zum "Jongleur de Dieu" macht. Franz lebte seine Ideen vor, bot sie quasi schauspielerisch dar. Vom Schauspieler unterschied ihn nur das Fehlen der Rollendistanz und die Lückenlosigkeit seiner Darstellung, die sich nicht auf bestimmte Auftritte beschränkte, sondern auch "offstage", hinter der Bühne weiterging. Solche bestimmten Auftritte hat es freilich gegeben: dramatisch verdichtete Momente, in denen besondere Anliegen oder Aussagen dargestellt wurden.
Die anschauliche Vermittlung findet sich in allen Quellen über Franziskus – und hier kann man die Blütenlegende oder die rotuli des Bruder Leo getrost einschließen, obwohl sie zu jener Kategorie von Quellen gehören, die ihre Entstehung einem ganz bestimmten programmatischen Interesse im frühen Minderbrüderorden des ersten Jahrhunderts verdanken. Die Streitfrage der Armut, an der ihre Parteilichkeit ja abzulesen ist, hatte vor Franziskus mit zwei Hauptströmungen von Katharern, mit Waldensern und Humiliati bereits eine lange und bewegte Geschichte. Sie mag auch Franz von Assisis vordringlichstes Anliegen gewesen sein – doch das unterscheidende, typische Merkmal seiner Bewegung war ein anderes. Es war die Bejahung des Geschaffenen, trotz Evangelischer Räte: der "Weg der Bejahung". Die anschaulich-greifbare Vermittlung dieser Botschaft nun hängt untrennbar mit dieser neuen Würdigung des Irdischen und damit Materiellen zusammen.
Auch die Katharer hatten volkstümlich, in der Vulgärsprache gepredigt und ein untadeliges Leben geführt – aber sie hatten die Gläubigen vor die Wahl gestellt, entweder nur Geist oder nur Fleisch zu sein. Ebensowenig wie die Waldenser konnten sie sich vorstellen, daß ein Priester, der nicht asketisch lebte, gültig Sakramente spenden konnte. Daß dies möglich war, stand für Franziskus außer Zweifel. Er sah, daß Körper und Geist sich in der Schöpfung nicht ausschließen, sondern im Gegenteil untrennbar verbunden sind – und daß das Materielle, Körperliche das Geistige, Transzendente anschaulich machen kann.
3. Die Vermittlung der Idee Franz von Assisis: Anschaulichkeit
Zur Freude an den Geschöpfen gehörte bei Franziskus eine äußerst strenge Lebensform. Er trieb die "Abtötung des Fleisches" mit solcher Konsequenz, daß sie tatsächlich zu einem frühen Tod führte: Wachen und Weinen, Frieren und Fasten zerrütteten seine Gesundheit. Gegen Ende seines Lebens räumte er auch ein, daß er mit "Bruder Esel", seinem Körper, wohl zu streng umgegangen sei. Doch war die Askese bei ihm nicht Selbstzweck, sondern ein Mittel, um "Bruder Esel" gefügig und arbeitswillig zu halten, zur Erfüllung der Aufgaben, die Franz und seine Gefährten sich gestellt hatten. Als eines Nachts ein Bruder vor Hunger schrie, weil er so lange gefastet hatte, gab Franz ihm nicht nur zu essen, sondern brach selbst sein Fasten und aß mit ihm, damit er nicht beschämt würde. Franziskus wollte mit seinem Leib predigen; und auch sein Fasten war als Beispiel für die anderen gemeint.
Man muß davon ausgehen, daß diese Vermittlungstechnik, die "Predigt durch das Beispiel", mindestens zum Teil bewußtes Programm war, daß Franziskus sie als seine Lebensaufgabe verstand:
Unde semper teneor illis dare bonum exemplum, maxime quia in hoc sum datus illis.
Mit der Vorstellung des "Bruder Immerfroh", dem der liebe Gott immer das Richtige in den Instinkt gegeben habe, ist die Predigt durch das Beispiel allein nicht zu erklären; denn mit dem Moment, als er für seine ersten Mitbrüder Verantwortung übernahm – schon der zweite, Petrus Catanii, stellte wegen seines Priesterstandes ein delikates Problem dar – konnte er sich unbedachte Spontaneität nicht mehr erlauben. Er mußte vermeiden, daß seine fraternitas mit den vielen häretischen Aufbrüchen gleichgesetzt wurde, und er mußte eine Alternative zu der unautorisierten Predigt finden, die jene praktizierten. Die Predigt durch das Beispiel war nicht nur überzeugender als die mit Worten, sondern auch kirchenpolitisch weniger riskant. So wird es aus diesen beiden Gründen gewesen sein, wenn Franz auch seine Brüder zu gerade jener Art des Verkündigens anhielt. Er wollte ja mit seinem Orden die Kirche erneuern, aber eben – hier liegt der Trugschluß der Sabatierschen und ähnlicher Interpretationen – ohne sie zu spalten. Er stürmte nicht gegen das als böse Erkannte an, hämmerte keine Thesen an Türen oder in Köpfe; Thesen waren seine Stärke nicht und Hämmern nicht seine Art. Statt dessen überwand er es mit Sanftmut, wie den Wolf von Gubbio oder die drei Strauchritter, die in der Folge zu Minderbrüdern wurden. Auch dieser Stil der Auseinandersetzung mit dem Bösen macht die Grundidee des "Wegs der Bejahung" anschaulich: das Annehmen und dadurch Verwandeln der Dinge.
Freilich hat Franz von Assisi nicht viel gesagt über rückhaltloses Annehmen des Entsetzlichen und dessen Integrierung in das Reich Gottes. Wenn er Rückhaltlosigkeit und Blöße meinte, so lebte er sie vor: er zog sein Habit aus, wie in der Predigt zu San Rufino oder bei seinem Tod. Wenn er Annehmen meinte, so lebte er auch dies vor: er pflegte Leprakranke und küßte sogar einen von ihnen auf den Mund; er besänftigte ein wildes Tier und drei wilde Gesellen und feierte Hochzeit mit der Dame Armut. Wenn er Armut meinte, so gab er sich nicht damit zufrieden, daß prächtige Klöster nominell dem Papst gehörten, sondern zeigte, wie sehr er den Besitz von Häusern mißbilligte, indem er vom eben fertiggestellen franziskanischen Studienhaus in Bologna die Ziegel hinunterwarf – und wie sehr er ein nicht ausreichend dürftiges Weihnachtsmahl mißbilligte, indem er das Haus verließ, dann als Pilger vermummt anklopfte und sich mit einem Napf auf den Boden setzte. Der Weg der Bejahung, die Predigt durch das Beispiel waren bei ihm keine Konzepte, sondern Lebensstil.
Daß die kirchliche Hierarchie mit ihm nicht ähnlich verfuhr wie mit Joachim von Fiore oder gar den Albigensern, ist vielleicht auch gerade diesen Grundkomponenten seiner Geistigkeit zuzuschreiben. Das Annehmen schloß ja auch die zum Teil nicht nur verweltlichte, sondern geradezu verlotterte Geistlichkeit mit ein, und die Predigt durch das Beispiel kam ohne jede kritische Äußerung zu den Zuständen aus: wer Augen hatte, zu sehen, der sah.
Wie solche Szenen im Einzelnen aussahen und wie sie verstanden wurden, soll am Beispiel der Lossagung vom Vater verdeutlicht werden, Sie fand am Anfang seines neuen Weges statt, Franz fühlte sich auf noch recht unbestimmte Weise berufen. Noch weniger als er selbst verstanden seine Mitbürger aus Assisi, wohin Gott mit ihm wollte, und vielleicht am wenigsten Pietro Bemardone, sein Vater. Dieser sah mit Schmerzen, daß sein Sohn ihm die Stofflager plünderte, aber trotzdem wie ein Bettler auftrat und sich und die ganze Familie zum Gespött der Stadt machte. Für dies Verhalten wollte Bemardone von seinem allem Anschein nach "ausgeflippten" Sohn eine Erklärung fordern – wenn es sein mußte, auch mit Gewalt. Sowie er seiner habhaft werden konnte, sperrte er ihn zuhause ein. In Abwesenheit des Hausherrn aber verhalf Donna Pica ihrem Sohn zur Flucht, Bemardone wandte sich schließlich verzweifelt an die Gerichtsbarkeit, und Franz erhielt eine Vorladung. So entstand der öffentliche Rahmen für seine Inszenierung dessen, was er bisher über seinen Lebensweg verstanden hatte.
Er aber erwiderte dem Boten, er sei bereits durch Gottes Gnade frei und unterstehe nicht mehr den Konsuln, weil er einzig und allein Diener des höchsten Gottes sei. Die Konsuln wollten ihm nicht Gewalt antun und sagten deshalb zum Vater: "Seitdem er in Christi Dienst getreten ist, steht er außerhalb unseres Machtbereiches." Der Vater sah ein, daß er bei den Konsuln nichts erreichte, und stellte deshalb beim Bischof der Stadt dieselbe Klage. Der Bischof, ein kluger und weiser Mann, lud Franziskus in geziemender Weise vor, er möge vor ihm erscheinen und über des Vaters Klage Rede und Antwort stehen, Franziskus entgegnete dem Boten: "Zum Herrn Bischof will ich kommen, denn er ist Vater und Herr der Seelen." Der Bischof nahm ihn, als er zu ihm kam, mit großer Freude auf und sprach zu ihm: "Dein Vater ist gegen dich sehr aufgebracht und verärgert. Wenn du also Gott dienen willst, so gib ihm das Geld zurück ..."
Da erhob sich der Mann Gottes voll Freude und, ermutigt durch die Worte des Bischofs, bracht er das Geld zu ihm mit den Worten: "Herr, nicht nur das Geld, das ich von seiner Habe besitze, will ich ihm frohen Herzens zurückgeben, sondern auch die Kleider." Und er ging in ein Zimmer des bischöflichen Hauses, zog alle Kleider aus, die ja von des Vaters Habe waren, und legte vor Bischof und Vater das Geld auf die Kleider. Dann kam er in Gegenwart aller Schaulustigen nackt wieder heraus und sprach: "Hört alle und versteht! Bis jetzt habe ich den Petrus Bernardone meinen Vater genannt; aber weil ich mir vorgenommen habe, Gott zu dienen, gebe ich jenem das Geld zurück, um dessentwillen er in Unruhe war, und dazu noch sämtliche Kleider, die ich von seiner Habe besaß. In Zukunft will ich sagen: Unser Vater, der du bist im Himmel, nicht: Vater Petrus Bernardone." Man entdeckte aber, daß der Mann Gottes damals auf dem Leibe unter den bunten Gewändern ein Zilizium trug. Alsdann erhob sich der Vater, von übergroßem Schmerz und Gram gepackt, und nahm das Geld und alle Kleider mit. ... Als der Bischof die Entschlossenheit des Mannes Gottes bemerkte, schloß er ihn in seine Arme ... und bedeckte ihn mit seinem eigenen Mantel.
In Franz’ Weigerung, vor einem weltlichen Gericht zu erscheinen und der freudigen Bereitschaft zur Kooperation mit dem kirchlichen Gericht ist die Hauptaussage der gesamten "Inszenierung" schon wie in einem Prolog vorweggenommen. Es ist eine Absage an die bürgerliche Welt zugunsten der Hinwendung zum Reich Gottes. Bemardones Unglück will es, daß in der Folge er als Beispiel für diese bürgerliche Welt herhalten muß, daß sein Sohn an ihm ein Exempel statuiert statt umgekehrt: an seinem Vater macht Franziskus deutlich, daß er von nun an die Werte der zeitgenössischen Gesellschaft geringachten will. So ist sein Auftritt offenbar auch verstanden worden, denn anders hätte niemand die unbezweifelbare Härte gegen den Vater hingenommen oder gar wie der Bischof stillschweigend gutgeheißen.
Daß es bei dieser "Szene", die Franz seinem Vater – oder eigentlich dem ganzen Volk von Assisi – macht, um Geld geht, ist besonders beachtenswert. Man kann ziemlich sicher sein, daß es Bernardone mehr um die Pläne ging, die er mit seinem Erben hatte, als um einen Beutel Gold: als er, wie gefordert, sein Eigentum zurückerhielt, war er ja nicht etwa zufrieden, sondern tief verletzt. Mit dem Geld, und den Kleidern, das spürte sicher auch der Vater, tat Franz die Werte des Vaters ab, die dieser nicht allein vertrat, sondern das anwesende Publikum mit ihm. Das Geld war nur die sichtbare Spitze vom Eisberg, das Gipfelphänomen der gesamten materialistischen, merkantilistischen Weltanschauung und Lebensweise, die sich damals gerade machtvoll durchsetzte: es war Symbol für alles, was Franziskus nicht mehr wollte, aus dem er "ausstieg" wie aus den bunten Kleidern, dem schönen Schein.
Bloßgelegt wurde das wirkliche Sein: ein schmächtiger, nackter Körper mit einem Bußgürtel – ein Mensch, der seine Bedürftigkeit und sein Suchen nach Gott sehen ließ – ein Mensch, der "wesentlich geworden" war. In Gestalt des Bischofs nahm ihn die Kirche unter den Mantel ihres Schutzes. In ihr sah Franz die Möglichkeit der "Alternative" – und dies, obwohl auch die Kirche jener Zeit ihren Möglichkeiten nur selten gerecht wurde.
Der Inhalt seiner Aussage ist also zusammengefaßt dieser: "Ich, Francesco Bernardone, sage mich los von der bürgerlichen Gesellschaft, ihren Werten und Bindungen, von den Möglichkeiten, die sie mir eröffnen und den Ansprüchen, die sie an mich stellen könnte. Ich sage mich los vom Habenwollen und Herzeigenwollen und will nicht mehr scheinen, als ich wirklich – das heißt vor Gott – bin. Statt dessen will ich für das Reich Gottes leben, und dies im Einklang mit der Kirche, die ich als den Ort solcher Bemühungen anerkenne."
Die Form der Aussage ist ein Rollenspiel, das viele Züge des damals üblichen Misterienspiels aufweist, zum Beispiel die Einbeziehung des Publikums, die Aufführung vor der Kirche und die religiöse Thematik:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Was aber haben Inhalt und Form solcher Aussagen mit Philosophie des Einzelnen oder mit der Universalienfrage zu tun? Ungelehrtheit war doch als Aspekt der Armut für den Ordensgründer wesentlicher Teil seiner Spiritualität, so daß er sich sogar schwertat, den Brüdern den Besitz eines Breviers zu gestatten?
4. Von der Praxis der Anschaulichkeit zur Philosophie der Anschaulichkeit
Man kann sicher sein, daß Franz, der sich selbst und seine ersten Brüder "ydiotae" nannte,
Die ältere Franziskanerschule fand im Platonismus augustinischer Prägung Anknüpfungspunkte zur Frömmigkeit des Ordensgründers. Sie konnte sich auf die innere Verwandtschaft des Sonnengesangs mit der Lichtmetaphysik berufen, oder auf die Affinität zwischen Franziskus' Christusmystik und Augustinus' Lehre von Christus, der göttlichen Weisheit, als Sitz der ewigen Ideen; auch ein Vergleich dieser Ideen, die gleichzeitig das wahre Sein und etwas Jenseitiges waren, mit Franziskus' Abkehr von den Werten der "Welt" zugunsten der ewigen Werte lag nicht fern. Bonaventura schuf dann mit der Lehre des Exemplarismus die philosophische Entsprechung zu Franziskus' Bejahung der Geschöpfe als Spuren und Abglanz des Schöpfers. Auch er, seine Zeitgenossen und Nachfolger gaben die Bindung an den Platonismus nicht auf, doch traten dann andere Elemente des franziskanischen Erbes nach und nach in den Vordergrund, die mit Platon und Augustinus zu versöhnen erhebliche Mühe kostete und auch nicht immer ganz gelang. Es waren gerade diejenigen Elemente, die in der obigen Darstellung des Heiligen besonders hervorgehoben wurden: die Predigt "plus exemplo quam verbo" und das Annehmen, die Offenheit zur Begegnung mit den Geschöpfen – der "Weg der Bejahung". Ideen sind im Platonismus als abstrakte Seinsprinzipien von den Dingen getrennt und zielen auch mit ihrer Funktion als Erkenntnisprinzipien nicht auf individuelle Gegenstände, sondern wiederum auf deren abstrakte Seinsprinzipien – also praktisch auf sich selbst. Erkenntnis ist Abstraktion und nur Abstraktion. Anders die "Predigt durch das Beispiel": sie vermittelt ihre Inhalte ohne Abstraktion und ermöglicht Erkenntnis im Konkreten. Dabei steht außer Frage, daß hinter solchem Predigen eine "Idee", ein Gedanke steht, doch wird dieser auf sinnenfällige Weise zum Ausdruck gebracht. Der Adressat, die "Zielperson" kann den Gedanken regelrecht erleben. Heute ist es eine pädagogische Selbstverständlichkeit, daß jeder Stoff umso leichter verstanden und erinnert wird, je mehr Sinne am Lernprozeß beteiligt werden. Bewußt oder unbewußt hat Franz mit seinem Leben, seinen Auftritten das geboten, was man heute Anschauungsmaterial, neudeutsch "Realien" nennt, und so eine Erkenntnis erreicht, bei der sinnliche Erfahrung nicht erst durch Abstraktion zur Erkenntnis wird, sondern sie selbst schon konstituiert. Einzig mögliches Objekt der Sinnes – und überhaupt der Erfahrung aber ist das Einzelne; "Katze im Allgemeinen" kann mit keinem Sinn wahrgenommen werden, sondern immer diese, jene oder mehrere voll individuierte Katzen, jede für sich. Ebensowenig konnte "Zuwendung zum Reich Gottes", "Armut", "Barmherzigkeit" als Begriff erlebt und erfahren werden, wohl aber Francesco Bernardone, wie er auf einem bestimmten Platz in Assisi an einem bestimmten Tag seinem Vater sein Eigentum zurückgab, wie er mit Hut und Stock vermummt im Kloster von Rieti bettelte, wie er einem bestimmten Leprösen die Wunden säuberte und dabei seinen üblen Geruch und nicht minder üble Reden ertrug. Die Predigt durch das Beispiel ist eine Predigt durch das Einzelne. Sie hat ein Hier und Jetzt, im Gegensatz zur Überzeitlichkeit und Unveränderlichkeit der Abstraktion, des "Universale.
Dieser Art des Verstehens und Verständlichmachens liegt eine Sinnlichkeit zugrunde, die mit "Sensibilität" genau übersetzt ist: Sensibilität für die Schöpfung, die zu verachten lange Zeit Bedingung der Frömmigkeit gewesen war. Für Franz war alles, was es in der Welt gab, ein Geschöpf: Himmelskörper, Wetterphänomene, Elemente, auch der Tod – nicht nur belebte Materie, sondern ausnahmslos alles, von dem er entdecken konnte, daß es "da" war. Im Unterschied zu früheren Asketen war für ihn Materie nicht das Gegenprinzip zum Geist, d.h. zu Gott und daher in sich böse, sondern gottgeprägt, gottdurchdrungen, gottgewollt und daher in sich gut. Er suchte und genoß die Begegnung mit dem Geschaffenen, weil er es als Zeichen des Schöpfers wahrnahm. Alles Geschaffene aber ist Individuum. Nicht Individuiertes ist in der Wirklichkeit nicht anzutreffen. Jene Begegnungen waren Begegnungen mit Individuen, mit Einzelnem.
Mit diesen Aspekten franziskanischer Spiritualität nun, die weithin als besonders charakteristisch anerkannt sind, konnten sich jene Minderbrüder rechtfertigen, die den konkreten Dingen mehr Wirklichkeit zuschrieben, die, wie Roger Bacon, mit Aristoteles den abstrakten Gehalt als den Dingen selbst innewohnend statt von ihnen getrennt betrachteten.
Das Resultat dieser Geistigkeit und der Auffassung vom Abstrakten oder Transzendenten als auch innerweltliches Seinsprinzip besteht darin, daß Transzendentes, Abstraktes im Einzelnen anschaubar, erfahrbar wird. Damit bekommt das "Fühlen", die Erfahrung einen neuen Stellenwert als Weg der Erkenntnis. Für die franziskanische Mystik, die ja wie alle Mystik und darüber hinaus Erfahrung ist, bedeutet die Einbeziehung von Jenseitigem ins Diesseits nun gerade nicht das Aufgeben der Transzendenz, sondern die Erweiterung um die Qualität der Sensibilität, der "Sinnlichkeit". Franziskus war ein "Mystique du sentiment", und jene neue Philosophie des Einzelnen ist sein Erbe.
Auch wenn, wie Bracaloni über den Mystiker des Fühlens weiter schreibt, Franz seinen Zeitgeist nicht geschaffen hat, sondern sein bester Interpret war, so steht doch außer Zweifel: der Entdecker der religiösen Sinnlichkeit ist nicht Ignatius von Loyola, sondern der Komödiant Gottes aus Assisi, und damit auch der Anreger einer christlichen Philosophie des Einzelnen.
Zwischen der leiblichen Verkörperung von Ansichten und Einsichten, wie Franz sie praktizierte, und deren Eingliederung in ein System philosophischer Begriffe liegt nicht zeitlich, aber psychologisch ein weiter Weg. Es ist der Weg von der primären, unmittelbaren, sinnenfälligen Ausdrucksform zur reflektierten, sekundären und zunächst nicht sinnenfälligen. Zwischen diesen beiden Polen liegt die Sprache der Bilder und Symbole, die zwischen Anschaubarkeit und Verstehbarkeit, zwischen Sinnen und Verstand vermittelt.
5. Zwischen Anschaubarkeit und Verstehbarkeit – die Sprache der Bilder und Symbole
Einer der ersten Vermittler zwischen konkretem Ding und abstraktem Begriff im franziskanischen Umfeld, einer der ersten Gestalter franziskanischen Gedankengutes in sinnenfälligen Bildern war Giotto di Bondone. Gleichviel, ob er Tertiar gewesen, ob er der Schöpfer der Fresken in der Oberkiche von San Francesco in Assisi gewesen ist oder auch nicht – er ist in intensive Berührung mit Franziskanern und der Gestalt des Franziskus gekommen. Nun wird im Zusammenhang mit Giotto oft von den Anfängen des Kunstverständnisses der Neuzeit oder zumindest der Renaissance gesprochen, und in der Tat kommt in seiner Malerei etwas Neues zum Ausdruck – etwas Neues, das auf der Ebene der Malerei die Parallele zur franziskanischen Bewegung im religiösen Leben darstellt: die Verlegung der Transzendenz in das Konkrete. Während die Heiligen und Madonnen seines Lehrers Cimabue, in überirdischer Zartheit und emblemhafter, frontaler Bewegungslosigkeit noch vor dem Goldhintergrund der reinen Transzendenz stehen und mit jenseitigem Blick eher durch den Betrachter hindurchsehen als ihn ansehen, wirken Giottos Figuren irdisch, bisweilen – namentlich die Franziskaner in ihren braunen Kutten – sogar erdig. Diese Gestalten bestehen nicht nur aus Gewandfalten, Augen und Geist, sondern haben eine ganz neue körperliche Präsenz. Unter ihren Gewändern sind Knochen und Fleisch, die sichtbar ihre eigene Schwere haben. Diese Heiligen sind aus demselben Stoff wie Bauern, sind gleichzeitig und untrennbar irdische, stoffliche Menschen und überirdische Heilige. Anstatt in einer fernen, goldenen Jenseitigkeit stehen sie an irdischen Orten, die mit sparsamen Mitteln bezeichnet sind, aber in Formen und Farben wiedererkennbar sind wie im Fall des graugrünen, felsigen Umbrien: es ist ein Hier und Jetzt bezeichnet. Die Figuren sind bewegt in Körpersprache und Mimik; sie reagieren auf das dargestellte Geschehen, in das sie ganz einbezogen scheinen, Sie schauen nicht distanziert aus dem Bild heraus, sondern der Betrachter sieht sie umschlossen von ihrer Wirklichkeit, "mitten im Leben".
Giotto rückt mit seiner Malerei das Heilige in den Bereich des Faßbaren, Konkreten, Diesseitigen, ohne daß die Transzendenz dabei verlorenginge – im Gegenteil, sie wird erst zugänglich gemacht. Mit den Mitteln der Malerei vollzieht er also die franziskanische Bewegung; das Irdische bezeichnet, drückt das Überirdische aus. Dies ist erst die Voraussetzung dafür, Individuen zum Gegenstand sakraler Kunst zu machen. Es ist auch die Voraussetzung für Bacons Theorie von der Wissenschaft der Erfahrung, bei der er induktiv vom erfahrenen Einzelnen auf das unerfahrbare Allgemeine schließt. Das Konkrete als Zeichen, Bild, Symbol für das Abstrakte, Transzendente – dies ist der Grundgedanke bei Franziskus wie bei Giotto, bei Bacon wie bei Dante.
Auch Dante war ein franziskanisch inspirierter Mensch. – denn das neue Bild der Frau hatte ebensowenig Einfluß auf ihre tatsächlichen Lebensbedingungen wie dessen nichtreligiöser Vorläufer, der Minnesang.
Was aber bei Dante mindestens ebensosehr beeindruckt wie der volkssprachliche Aufbruch und das neue Frauen- und damit Menschenbild und im gegenwärtigen Zusammenhang noch mehr interessiert, ist wiederum die Art der Vermittlung seiner Gedanken. Es ist ein sprachliches Malen, mit dem er sein philosophisch-theologisch durchkonstruiertes Universum dem inneren Auge sichtbar macht: statt Definitionen benutzt er Symbole, Sinn-Bilder, die Sinn in Bildern sinnenfällig machen. Dies gelingt ihm, obwohl sein Medium Sprache ist, an sich Resultat und Mittel der Abstraktion, indem er wie in einem Drama die Tugenden und Laster nicht abstrakt abhandelt, sondern sie an Personen festmacht, die sein Publikum kennt, die wirklich gelebt haben und so konkret sind, wie ein Mensch nur sein kann. Die Bedeutung eines Individuums kann kaum höher sein als als Repräsentant des Allgemeinen, und dies sind sowohl seine Sünder und Heiligen als auch er selbst, der Jedermann; zugleich Dante Alighieri, bekannter (wenn nicht gar notorischer) Sohn der Stadt Florenz mit dezidierten politischen Vorlieben, mit charakterlichen und physischen Eigenheiten und "Der Mensch" überhaupt. Mit einem kochenden Schlammsee im Inferno oder rosigem Licht im Paradiso tut er eben den franziskanischen Gestus: das Jenseitige anschaubar machen, das Allgemeine im Individuum begreifen.
6. Roger Bacon OFM – Transzendenz des Einzelnen in einer anschaulichen Philosophie
Anschaulichkeit ist Greifbarkeit des Transzendenten im Stofflichen: im konkreten Individuum wird das greifbar, was über es selbst hinausweist. Franziskus, Giotto, Bacon und Dante haben die Idee der Anschaulichkeit, der Transzendenz im Einzelnen auf anschauliche Weise vermittelt, und diese Vermittlung unterscheidet sie von allen anderen Vermittlern desselben Gedankens. Bonaventuras Exemplarismus ist dagegen eine rein begriffliche, abstrakte und unanschauliche Theorie der Anschaulichkeit, also latent widersprüchlich. Auch er wertet Sinneserfahrung als einen Weg – genauer: den Anfang des Weges einer menschlichen Seele zu Gott. Doch geht er nicht so weit, sie als Träger und Zuträger von philosophischen Befunden einzusetzen bzw. einen solchen Einsatz auch nur zu fordern oder zu begründen, wie dies Bacon tat. Sinneserfahrung ist nur Ausgangspunkt und Rohmaterial für diese Befunde. Roger Bacon, Zeitgenosse und Mitbruder in seinem Schatten, war es, der den Gedanken der Transzendenz des Einzelnen und die Anschauung als Medium dieses Gedankens in einem philosophischen Denkgebäude zusammenführte.
Trotz des langen Schattens von Bonaventura hat Bacon, 1214 in Ilchester geboren, in seinem eigenen wie auch in späteren Jahrhunderten Beachtung gefunden. Das 19. und frühe 20. Jahrhundert meinte in ihm einen Propheten und Märtyrer seiner eigenen "Wissenschafts"gläubigkeit zu entdecken und widmete ihm entsprechende Hagiographien, doch auch heute noch unüberholte Studien.
Im Gegenzug entstand in der Mitte unseres Jahrhunderts unter der Führung von Easton die "debunking school", die Bacon als Epigonen oder als neidzerfressenen, abergläubischen Fanatiker und Wirrkopf darstellte. Inzwischen sind positive wie negative Gesamtbewertungen selten geworden, und die neuere Bacon-Forschung befaßt sich hauptsächlich mit Detailfragen, wenn auch natürlich Details das Gesamtbild noch beeinflussen. Ausgewogene Beurteilungen seiner Persönlichkeit und Philosophie sind im Ganzen eher die Ausnahme, und so bedauerlich man dies finden mag – es harmoniert auf eigentümliche Weise mit Bacons unharmonischem Leben.
Bacon studierte zunächst an der damals schon franziskanisch geprägten Universität Oxford Theologie und die artes liberales. Schon damals dürfte er dort Bekanntschaft mit dem Franziskanerfreund Grosseteste und dem Franziskaner Adam von Marsh geschlossen haben. Als etwa Zwanzigjähriger ging er für ein gutes Jahrzehnt nach Paris. Hier lernte er Petrus von Maricourt kennen, der sein bereis in Oxford gewecktes Interesse am Experiment sicherlich weiter gefördert hat. Die Freundschaft mit diesem Mann, der als Alchimist galt, obwohl seine Forschungen eher zur Physik gehörten, hat Bacons Ruf als treuer Sohn der Kirche möglicherweise schon den ersten Schaden zugefügt. Denn gleichgültig ob Chemie oder Physik – jegliche experimentelle, mit konkreten Gegenständen und sinnlichen data arbeitende Wissenschaft gehörte zu jener Zeit in eine ungewisse, durchaus unvollständig definierte Grauzone, die nicht eindeutig, bzw. für viele eindeutig nicht in den Bereich der christlichen Wissenschaft fiel. In Paris herrschte nicht dieselbe Freiheit der Lehre wie in Oxford: man beobachtete, mißtraute und bekämpfte einander. Zwar lehrten an der Universität Alexander von Hales und Albert der Große, doch war zur selben Zeit ein Lehrverbot für Aristoteles in Kraft. Dies Verbot wurde freilich nicht ganz eingehalten, auch nicht von Roger Bacon – vielleicht ein Grund mehr für ihn, eine Reform des geistigen Lebens herbeizusehnen und sich für eine solche Reform intensiv und persönlich einzusetzen. Daß er dies nicht gegen die Kirche, sondern in ihr, mit ihr und letztlich für sie tun wollte, wurde er nie müde zu betonen und dokumentierte es auch durch seinen Eintritt in den Orden der Minderbrüder nach seiner Rückkehr in Oxford.
Als Bacon diesen Entschluß faßte, war er dreißig Jahre alt oder älter. Bei dreißig Jahren lag die durchschnittliche Lebenserwartung eines Menschen im Mittelalter, und wer nicht nur dies Alter erreicht, sondern auch die beste damals mögliche Bildung genossen hatte, kam zu einer so schwerwiegenden Entscheidung wahrscheinlich nicht ohne reifliche Überlegung. Innerhalb der "debunking school" ist angenommen worden, es habe sich dabei um Überlegungen finanzieller Art gehandelt: Nachdem Bacon sein eigenes Vermögen und das seiner Verwandten und Freunde mit seinem kostspieligen Experimentierhobby durchgebracht hatte, war ihm der Orden des Kleinen Armen als neuer Geldgeber willkommen.
Dies ist aus zwei Gründen unwahrscheinlich: nach seinen Klagen an Papst Clemens im Opus Tertium war er gerade wegen seines Standes als Bettelmönch dazu gezwungen, Freunde und Familie um Mittel anzugehen, sondern um den franziskanischen "Weg der Bejahung", der Frömmigkeit und Sinneserfahrung auf einzigartige Weise zusammenführt: die materielle Schöpfung kann angenommen, bejaht werden, weil sie aus Gott ist, auf ihn hin geschaffen und letztlich gut. Die Oxforder Franziskaner wollten nicht wie Blaubarts Frauen die dreizehnte Tür offnen, um verbotene Geheimnisse zu kosten; sie wollten mehr über das Werk des Schöpfers und damit über den Schöpfer erfahren, ihre Theologie auf eine breitere Basis bauen. Die Einbindung der Naturphilosophie – auch der experimentellen – in die spezifisch christliche Weisheit und ihre Funktion als Wegbereiter für die christliche Lebenspraxis waren Bacons Anliegen. Betrachtet man den Aufbau seiner gesamten Wissenschaftstheorie, die er scientia universalis nennt und die eben die umfassende christliche Weisheit bedeutet, so wird dies Anliegen überaus deutlich. Bei Descartes, der die vollkommene Trennung der Inhalte des Wissens voneinander forderte, ging genau dies Anliegen, der Zusammenhang wissenschaftlicher Tätigkeit mit dem Lebensvollzug des Menschen, der wiederum in einem kosmischen Zusammenhang eingebettet ist, verloren. Heute versucht man mit berechtigter Verzweiflung, diesem Anliegen wieder Gehör zu verschaffen. Das Experiment bei Bacon entsteht in der Bejahung der konkreten Geschöpfe; es ist eine Begegnung mit ihrer Wirklichkeit und nicht, wie nach Descartes, ausbeutendes Hantieren mit einer Sache, die, weil nicht geistbegabt, in keinem Zusammenhang mit dem Menschen steht. Gerade dieser Zusammenhang des gemeinsamen Natur-Seins, Geschöpf-Seins wird heute wieder als lebenswichtig, ja überlebenswichtig erkannt, da das cartesianische Weltbild seine verhängnisvolle Schwäche immer mehr offenbart.
Aus der Bejahung konkreter Geschöpfe und der Begegnung mit ihrer Wirklichkeit ergibt sich Bacons Auffassung, daß Einzelnes real ist. Zwar steht diese Auffassung im Widerspruch zum Idealismus augustinisch-platonischer Prägung, wie ihn Johannes von Salisbury und die ältere Franziskanerschule vertraten, der beinhaltet, daß nur die Ideen in mente divina im vollen Sinne wirklich seien, daß ihre materiellen Manifestationen aber, die konkreten geschaffenen Dinge, diese Wirklichkeit nur in beschränktem Maß widerspiegeln. Dennoch sollte dieses Höherbewerten der Geschöpfe als in sich geschlossene Realitäten nicht dahingehend mißverstanden werden, daß hier das Materielle über das Spirituelle die Oberhand gewinnt. Im Gegenteil: die geistig-geistliche Wirklichkeit rückt näher, weil sie dem Konkreten, Greifbaren, Erfahrbaren innewohnt. Aus der unerreichbaren, von der Schöpfung ganz getrennten Transzendenz wird eine Transzendenz, die gleichzeitig in der Schöpfung Immanenz ist. Man sieht die Verwandtschaft mit Franziskus, mit Giotto und Dante: Die Materie selbst ist anschaulich, sie spiegelt Geistiges wider, ist Träger von Bedeutungen.
Aus dieser Erfahrung heraus, die die franziskanische Bewegung wiederentdeckt hatte, hat sich die neuere Franziskanerschule und auch Bacon vom extremen Realismus abgewandt. Doch Bacon betont eindringlich, daß dies keine Abwendung von der Theologie ist, sondern aus theologischen Gründen geschieht. Da aber alles menschliche Denken in Konzepten, Begriffen, Ideen vor sich geht, ergab sich daraus die Schwierigkeit des Erkennens der Realität. Ideen sind allgemein, universal und können nur vom universal angelegten Denken verarbeitet werden. Einzelnes aber ist der Struktur des menschlichen Denkapparates unzugänglich. Wenn nun im Einzelnen die reale Seinsweise einzeln ist, bleibt es für den Menschen unmöglich, die ihn umgebende Wirklichkeit nach ihrer Seinsweise zu erkennen; er kann sie nur analog erkennen.
Eine solche Lehre könnte man Skeptizismus nennen, doch ist sie bei Bacon in einer eindeutig franziskanisch geprägten Religiosität begründet und verankert. Die Lehre des zeichenhaften Verstehens ist eng verwandt mit Bonaventuras Exemplarismus, aber auch mit dem "Exemplarismus" des Sonnengesangs, wo z.B. die Kraft und Schönheit des Feuers ein Bild für Kraft und Schönheit Gottes ist, die der menschliche Verstand selbst nicht fassen kann, oder mit Giottos "Exemplarismus", der als Trägerin des unfaßbaren Geheimnisses und Prototyp des erlösten Menschen ein Bauernmädchen aus Fleisch und Blut malt.
Wie sich zeigt und bei der Textanalyse noch deutlicher zeigen wird, ist also Roger Bacons innere Affinität zum Orden der Minderbrüder nicht nur keine "übermäßig subtile Idee", sondern anhand seiner Philosophie auch leicht nachzuweisen. Freilich muß man einräumen, daß von seinen eigenen Ordensoberen gerade seine franziskanische Rechtgläubigkeit zeitweise bezweifelt und im Zusammenhang mit einigen Themen entschieden bestritten wurde. Doch von der Frage, ob solche Zweifel heute noch Bestand haben können, wird noch die Rede sein.
Nachdem er etwa zehn Jahre in Oxford verbracht hatte, war Bacon 1257 wieder in Paris im Exil. Er lebte dort wahrscheinlich unter einem Dach mit dem damaligen Generalminister Bonaventura, und gerade ihm kam er offenbar "nicht ganz katholisch" vor. Gründe hierfür gab es allerdings mehr als genug: Bruder Roger betrieb mit großem Eifer die suspekte Geheim- und Grenzwissenschaft "Alchimie", er nahm an den damals allzu beliebten astrologischen Spekulationen regen Anteil und schien Sympathien für die Spiritualen und für Joachim von Fiores eben erschienene Drei-Reiche-Lehre zu hegen – Sympathien, die Bonaventura aus ordenspolitischen Gründen nicht duldete. Und Bruder Roger ließ bei seiner ätzenden Kritik berühmter Lehrer, die seiner Meinung nach ihre Berühmtheit nicht verdienten, auch die Franziskaner nicht aus.
So wurde er zum Problem für seinen Orden. Sein Verhältnis zu den Oberen verschlechterte sich so, daß ihm ein striktes Lehr-und Publikationsverbot auferlegt wurde. Bei Zuwiderhandlung drohte nicht nur Konfiszierung der betreffenden Schrift, sondern auch Arrest bei Wasser und Brot. Darunter sollte man sich aber wohl kein Gefängnis vorstellen, wie Charles, Experimente, die gemeinhin für Magie gehalten wurden. Diese Lage änderte sich erst 1265, als der Kardinalbischof von Sabina, der an Bacons Arbeit interessiert war, als Clemens IT. den Papstthron bestieg. Am 22. Juni 1266 forderte er Bruder Roger brieflich auf, ungeachtet aller möglichen Verbote von dritter Seite ihm das Werk zu senden, über das beide miteinander gesprochen oder korrespondiert hatten. Das Werk war allerdings noch nicht geschrieben, weil Bacon sich nicht hatte frei äußern dürfen und aus Geldmangel die Forschungen nicht hatte anstellen können, die anderen leicht möglich waren. Innerhalb der folgenden eineinhalb Jahre brachte er nun in fieberhafter Eile sein. Hauptwerk, das Opus Maius, und zwei Zusammenfassungen mit Ergänzungen, das Opus Minus und Opus Tertium, zu Papier. Diese Eile ist sicher der Grund für die Auslassungen, Wiederholungen und Widersprüche in jenen drei Schriften, die ohnehin nur eine Art Exposé abgeben sollten für das große scriptum principale, das aber nie vollendet wurde. Clemens IV. nämlich starb bereits 1268, und sein Nachfolger nahm Bacon nicht in gleicher Weise in Schutz: die "Schonzeit" war abgelaufen.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Wer war Roger Bacon und was zeichnet seine Philosophie aus?
Roger Bacon war ein franziskanischer Gelehrter des Mittelalters, der als Wegbereiter der modernen Wissenschaft gilt. Seine Philosophie betont die Bedeutung der Erfahrung (Experiment) und der Anschaulichkeit.
Was ist der Universalienstreit im Kontext von Bacons Werk?
Der Universalienstreit dreht sich um die Frage, ob Allgemeinbegriffe (Universalien) eine eigene Realität besitzen oder nur Namen für Einzeldinge sind. Bacon vertrat eine Position, die dem Einzelding einen hohen Stellenwert einräumte.
Wie hängen Bacons Theorien mit der franziskanischen Spiritualität zusammen?
Die Arbeit zeigt, dass Bacons Fokus auf das Einzelne und die Anschaulichkeit tief in der franziskanischen „Bejahung der Schöpfung“ verwurzelt ist, wie sie von Franz von Assisi vorgelebt wurde.
Was bedeutet „scientia experimentalis“ bei Roger Bacon?
Bacon begründete die experimentelle Wissenschaft als notwendige Ergänzung zur bloßen Logik, da nur die Erfahrung Gewissheit über die Beschaffenheit der Welt liefern könne.
Welche Bedeutung hat der neu gefundene Text „De signis“?
Die Arbeit liefert eine neue Deutung dieses Textes, der Bacons Zeichentheorie und sein Verständnis von Sprache und Erkenntnis vertieft.
- Quote paper
- Ph.D, MA Mara Huber (Author), 1984, Roger Bacon - Lehrer der Anschaulichkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120984