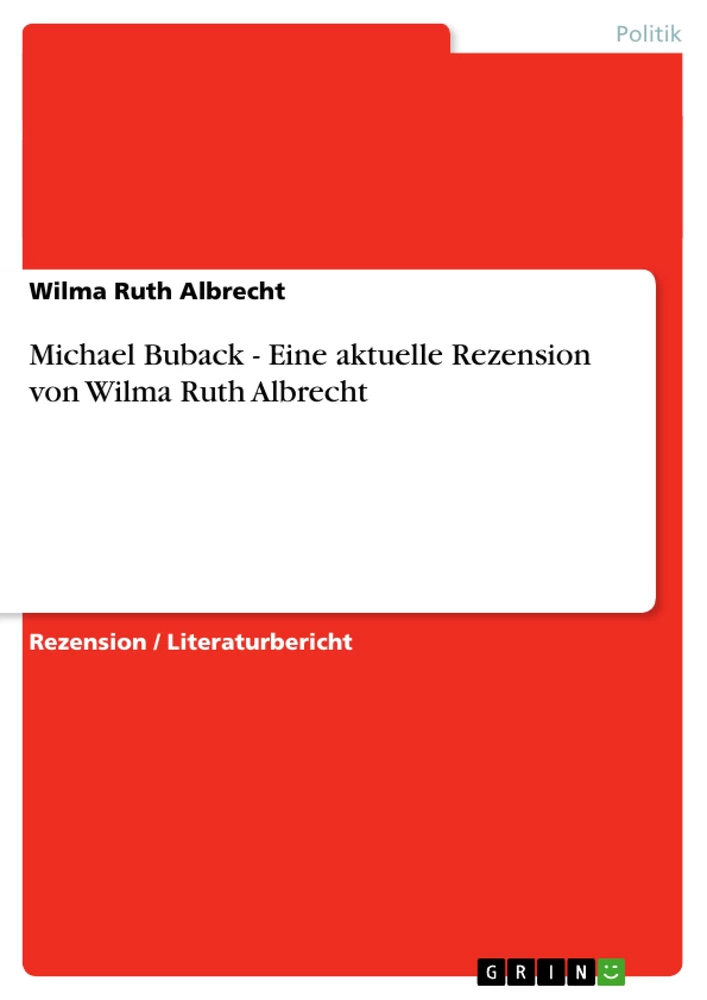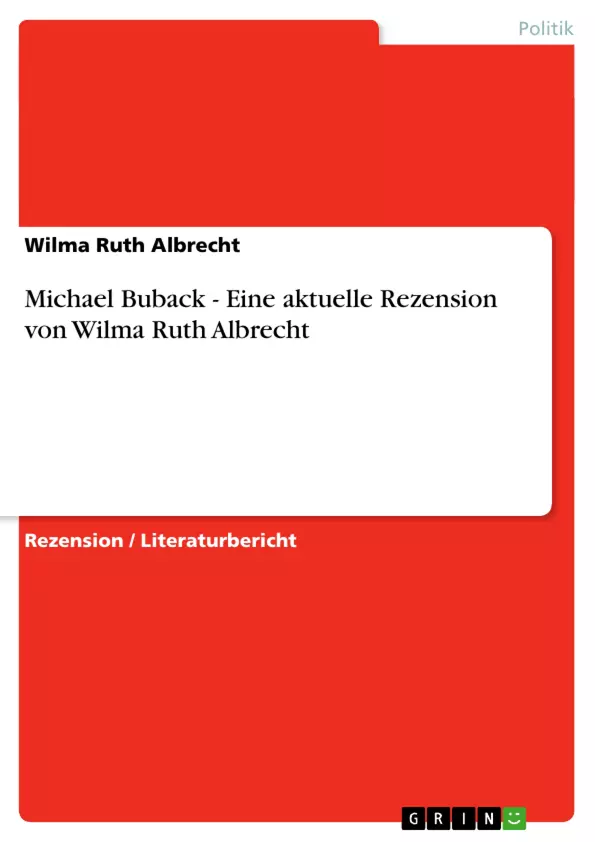Michael Bubacks “Der zweiter Tod meines Vaters” ist sowohl ein persönliches als auch ein aufklärerisches Buch: Persönlich ist es in den Teilen, in denen der Autor seine Gefühle im Zusammenhang mit dem Bubak-Attentat 1977 und der Tätigkeit der Verfolgungs- und Strafbehörden zur Aufklärung des Verbrechens darlegt. Aufklärerisch ist es in der Darstellung der Methoden, mit denen der Autor versucht, die Verschleierung der Verfolgungs- und Strafbehörden um den wahren Tathergang und den/die Täter(in/innen) - dies stellt er chronologisch dar - aufzudecken. Letztere sind nachvollziehbar und stehen im Mittelpunkt dieser Buchbesprechung (Rezension).
Michael Buback -
Eine aktuelle Rezension von Wilma Ruth Albrecht
Wilma Ruth Albrecht
Michael Bubacks “Der zweiter Tod meines Vaters” ist sowohl ein persönliches als auch ein aufklärerisches Buch: Persönlich ist es in den Teilen, in denen der Autor seine Gefühle im Zusammenhang mit dem Bubak-Attentat 1977 und der Tätigkeit der Verfolgungs- und Strafbehörden zur Aufklärung des Verbrechens darlegt. Aufklärerisch ist es in der Darstellung der Methoden, mit denen der Autor versucht, die Verschleierung der Verfolgungs- und Strafbehörden um den wahren Tathergang und den/die Täter(in/innen) - dies stellt er chronologisch dar - aufzudecken. Letztere sind nachvollziehbar und stehen im Mittelpunkt dieser Buchbesprechung (Rezension).
I.
Am Gründonnerstag, dem 7. April 1977, wurde in Karlsruhe am Linkenheimer Tor auf Siegfried Buback, seit 1974 Generalbundesanwalt der Bundesrepublik Deutschland (BRD), ein Attentat verübt. Dabei wurden Buback und sein Fahrer Wolfgang Göbel, der an diesem Tag den Cheffahrer ersetzte, getötet und Begleiter Georg Wurster, der im Dienstwagen mitfuhr, so schwer verletzt, dass er wenige Tage später starb. Die Attentäter näherten sich dem Dienstwagen (Mercedes) auf einem Motorrad (Suzuki GS 750, Kennzeichen LU-LN 8). Der Todesschütze saß auf dem Soziussitz und schoss mit einer Schnellfeuerwaffe aus unmittelbarer Nähe auf die Insassen des Autos. Beide Attentäter trugen Motorradhelme. Das Motorrad und zwei Helme wurden gleichentags, am 7. 4. 1977, in einer Brückenpfeiler-Kammer der Autobrücke Wolfahrtsweier bei Karlsruhe gefunden.
Als mögliche Täter wurden am 8. April 1977 die “RAF”-Mitglieder Günter Sonnenberg, Knut Folkerts und Christian Klar, alle aus Karlsruhe, präsentiert und zur Fahndung ausgeschrieben.
Am 3. Mai 1977 wurden in Singen aufgrund eines Hinweises einer älteren Frau Verena Becker und Günter Sonnenberg nach einem heftigen Schusswechsel mit der Polizei festgenommen. Bei ihnen wurde die Tatwaffe des Karlsruher Attentats gefunden.
Nachdem aus dem vermuteten Täterkreis Sonnenberg am 3. 5. 1977 festgenommen worden war, erfolgte die Festnahme Folkerts im September 1977 und die Klars im November 1982.
Diese drei wurden verurteilt: Klar und Folkert wegen Beteiligung am Karlsruher Attentat, Sonnenberg wegen der Singener Schießereien (gemeinsam mit Verena Becker).
II.
Jahrzehntelang blieben offizielle Tathergangsschilderung und der Täterpersonenkreis unhinterfragt. Das änderte sich erst 2007 als Michael Buback erfuhr, dass nach der Mindestverbüßungsdauer Brigitte Mohnhaupt 2007 und Christian Klar 2009 nach Mindestverbüßungsdauer freigelassen würden. Daraufhin engagierte sich Buback in öffentliche Diskussionen und verwies dabei auch darauf, dass die Morde an seinem Vater und dessen Begleiter immer noch nicht aufgeklärt seien.
In diesem Zusammenhang habe sich im März 2007 Peter-Jürgen Boock bei Buback telefonisch gemeldet, um ihm mitzuteilen, “dass Christian Klar und Knut Folkerts definitiv nicht an der Durchführung des Attentats in Karlsruhe beteiligt gewesen seien. Keiner von ihnen habe auf dem Motorrad gesessen, von dem aus mein Vater und seine beiden Begleiter erschossen wurden.” (S. 82) Vielmehr seien Günter Sonnenberg und Stefan Wisniewski die Motorradbesetzung gewesen. Dies jedenfalls sei 1976 in einem Ausbildungscamp in Aden (Jemen), an dem auch Verena Becker, Sieglinde Hofmann, Brigitte Mohnhaut sowie Günter Sonnenberg, Peter Wisniewski und Peter-Jürgen Boock selbst (nicht aber Christian Klar) teilgenommen hätten, geplant worden.
Des weiteren erhielt Buback im April 2007 die e-Postmitteilung eines 44-jährigen Mannes, der ihm mitgeteilt habe, dass er am 6. April 1977, also am Vortag des Attentats, zusammen mit seinen Eltern und seiner Schwester im Auto unterwegs gewesen sei. Vor dem Bundesverfassungsgericht hielt der Vater das Auto an und er, der damals 14-jährige Junge, habe ohne auf den Verkehr zu achten, die Tür geöffnet, so dass ein vorbeifahrendes Motorrad fast zu Fall gekommen sei. Er habe auch zum gleichen Zeitpunkt Siegfried Buback gesehen. Am nächsten Tag, als das Attentat auf Buback und seine Begleiter bekannt wurde, habe man der Polizei den Motorradvorfall und dabei während des nachmittäglichen Verhörs auch mitgeteilt, dass auf dem Soziussitz eine kleinere, zierliche Person, ein “Hüpferle”, zwischen einssechzig und einssiebzig groß, gesessen und eine Tasche bei sich getragen habe. In weiteren Telefonanrufen teilte der Mann noch mit, dass weder er noch sein Vater zu “Gegenüberstellungen oder als Zeugen zu Gerichtsverhandlungen geladen worden” seien (S. 114).
Diese Mitteilungen sowie eine gewisse Reserviertheit der Bundesanwaltschaft, der sich Buback verbunden fühlte, nährten bei ihm Zweifel an der offiziellen Version des Tathergangs und der Täter des Karlsruher Attentats. Diese führten zunächst noch zu pragmatischen und dann immer stärker zu methodisch angeleiteten Fragen und textanalytischen Untersuchungen mit dem Ergebnis:
(1) Bei der zeitnahen Berichterstattung über das Karlsruher Attentat in der Tagesschau am 7. April 1977 und in Presseberichten (Welt, FAZ) vom 9. April 1977 wurde gemeldet, dass die Person auf dem Soziussitz des Tatmotorrades, die auch geschossen habe, eine Frau gewesen sein könnte. Auch der unmittelbare Augenzeuge, dessen Auto direkt links neben dem Dienstfahrzeug Bubacks vor einer roten Ampel stand, habe erklärt, dass die beiden Attentäter zwischen zwanzig und dreißig Jahre alt gewesen seien, die Person auf dem Soziussitz eine Frau sein könnte. (S. 87)
[...]
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Michael Bubacks Buch?
In „Der zweite Tod meines Vaters“ setzt sich Michael Buback mit dem Attentat auf seinen Vater Siegfried Buback und der mangelhaften Aufklärung durch die Behörden auseinander.
Wer war Siegfried Buback?
Er war der Generalbundesanwalt der Bundesrepublik Deutschland, der 1977 von Mitgliedern der RAF ermordet wurde.
Was kritisiert Michael Buback an den Ermittlungsbehörden?
Er wirft ihnen Verschleierung vor und vermutet, dass die wahren Täter (insbesondere die Person auf dem Motorrad-Sozius) absichtlich nicht benannt wurden.
Welche neuen Hinweise erhielt Buback im Jahr 2007?
Er erhielt Informationen von Peter-Jürgen Boock und Zeugenaussagen, die darauf hindeuteten, dass Christian Klar und Knut Folkerts nicht die unmittelbaren Schützen waren.
Wer wurde ursprünglich für das Attentat verurteilt?
Verurteilt wurden Christian Klar, Knut Folkerts und Günter Sonnenberg, wobei Buback die tatsächliche Tatbeteiligung in seinem Buch hinterfragt.
- Citation du texte
- Dr. Wilma Ruth Albrecht (Auteur), 2009, Michael Buback - Eine aktuelle Rezension von Wilma Ruth Albrecht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/121232