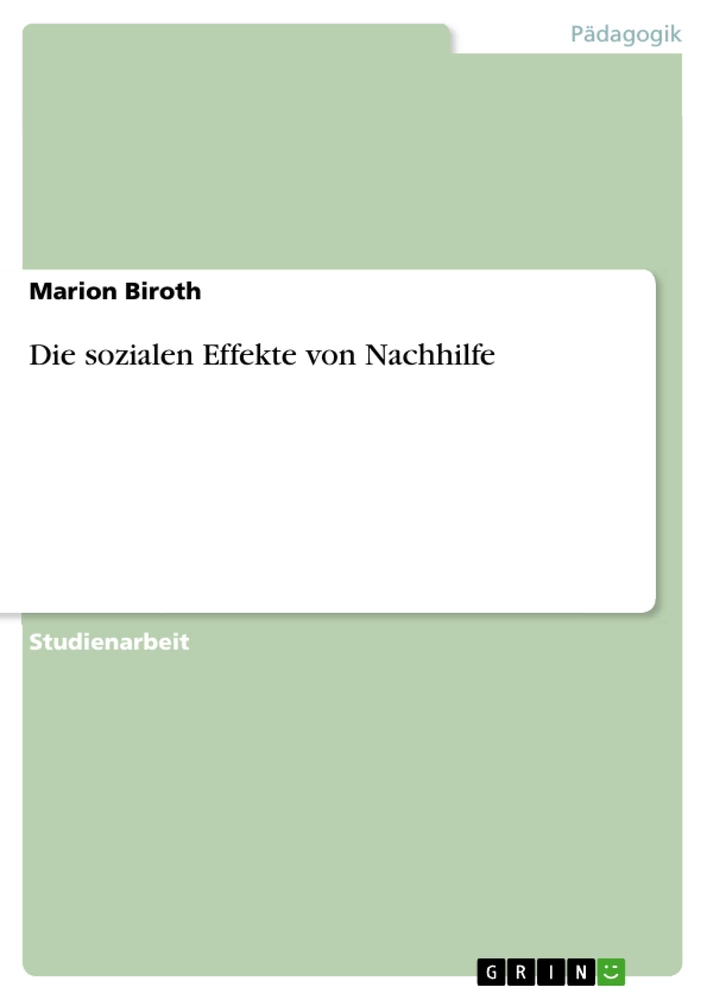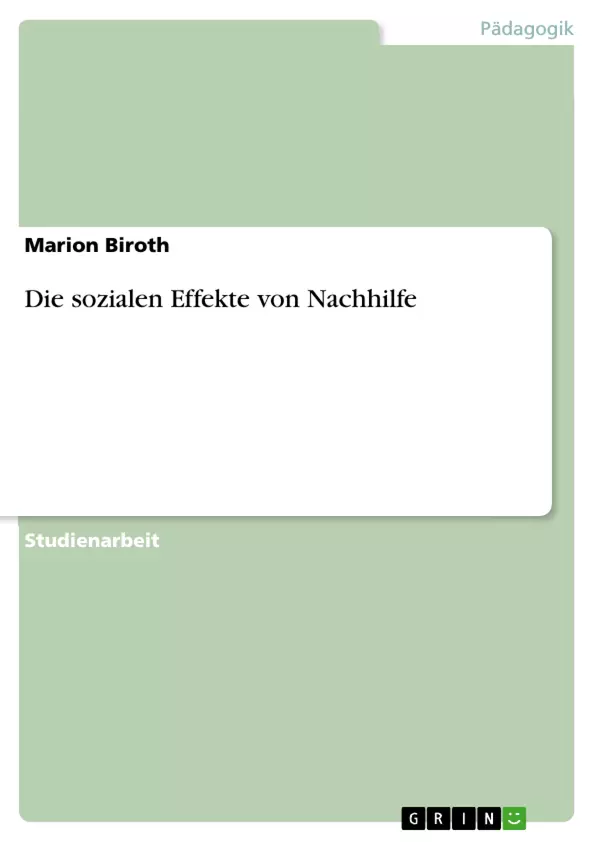Im Studiengang Bildungswissenschaft der Fernuniversität Hagen wird im Modul 2a das Thema „Methoden der empirischen Bildungsforschung“ behandelt. Entsprechend ist im Rahmen einer Hausarbeit ein selbst gewähltes Forschungsprojekt unter Auswahl einer der Methoden der empirischen Sozialforschung durchzuführen und auszuwerten. Bedingt durch meine berufliche Tätigkeit im Nachhilfesektor fokussierte sich mein Forschungsinteresse auf diese Thematik. Das Anfang dieses Jahres im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung erschienene wissenschaftliche Gutachten „Was wissen wir über Nachhilfe? – Sachstand und Auswertung der Forschungsliteratur zu Angebot, Nachfrage und Wirkungen“ vertiefte mein Interesse noch, wird im Rahmen dieses Gutachtens, dessen Schwerpunkt auf der Darlegung, Zusammenfassung und Bewertung empirischer Forschungsarbeiten der Jahre 1990 – 2007 liegt, doch immer wieder auf Lücken und Unübersichtlichkeit in der Nachhilfeforschung hingewiesen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Qualitative Sozialforschung
2.1 Darlegung der Forschungsfrage
2.2 Begriffsdefinition
2.3 Hypothesenbildung
3. Darlegung der Methode: Das narrative Interview
3.1 Begründung der Methodenwahl
3.2 Durchführung des Interviews
3.3 Transkription
4. Erfahrungen mit der Erhebung
4.1 Feldzugang
4.2 Die Erhebung
5. Inhaltliche Auswertung und Interpretation
5.1 Formale Textanalyse Mitarbeit (Zeilen 140 – 158)
5.2 Strukturelle Beschreibung
5.3 Analytische Abstraktion
5.4 Wissensanalyse
6. Fazit
7. Ausblick
Literaturverzeichnis
ANHANG
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Im Studiengang Bildungswissenschaft der Fernuniversität Hagen wird im Modul 2a das Thema „Methoden der empirischen Bildungsforschung“ behandelt. Entsprechend ist im Rahmen einer Hausarbeit ein selbst gewähltes Forschungsprojekt unter Auswahl einer der Methoden der empirischen Sozialforschung durchzuführen und auszuwerten.
Bedingt durch meine berufliche Tätigkeit im Nachhilfesektor fokussierte sich mein Forschungsinteresse auf diese Thematik. Das Anfang dieses Jahres im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung erschienene wissenschaftliche Gutachten „Was wissen wir über Nachhilfe? – Sachstand und Auswertung der Forschungsliteratur zu Angebot, Nachfrage und Wirkungen“ vertiefte mein Interesse noch, wird im Rahmen dieses Gutachtens, dessen Schwerpunkt auf der Darlegung, Zusammenfassung und Bewertung empirischer Forschungsarbeiten der Jahre 1990 – 2007 liegt, doch immer wieder auf Lücken und Unübersichtlichkeit in der Nachhilfeforschung hingewiesen.
2. Qualitative Sozialforschung
Laut Flick (2007, S. 27) ist das Ziel der qualitativen Sozialforschung, „Neues zu entdecken und empirisch begründete Theorien zu entwickeln“. Es geht hier also nicht um die Überprüfung wissenschaftlicher Theorien, sondern um die Entdeckung von theoretischen Aussagen. Nach Brüsemeister (2008, S. 28) bezeichnen diese beiden Begriffe den zentralen Unterschied zwischen qualitativer und quantitativer Sozialforschung, „aus dem sich alle weiteren Unterschiede zwischen den Methoden ergeben“. Untersuchungsfeld der qualitativen Sozialforschung ist gemäß Flick (2007, S. 27) „das Handeln und Interagieren der Subjekte im Alltag“, weshalb ForscherInnen sich mit dem Prinzip der Offenheit ins Feld begeben, um der „Differenziertheit des Alltags“ gerecht zu werden. Darüber hinaus sind von den ForscherInnen das Prinzip der Gegenstandsangemessenheit bei der Methodenwahl, das Prinzip der Generalisierbarkeit der Ergebnisse sowie die Formulierung von Gütekriterien zu berücksichtigen.
2.1 Darlegung der Forschungsfrage
Seit vielen Jahren begleite ich als Nachhilfelehrerin SchülerInnen durch ihren Schulalltag. Dabei sind Leistungsverbesserungen ein äußeres Kennzeichen des Effekts von Nachhilfeunterricht, das ich persönlich beobachte. Allerdings wurde ich durch die Aussage einer Schülerin, dass sie zum ersten Mal seit langer Zeit ohne Angst in den Unterricht ginge, darauf aufmerksam, dass Nachhilfe auch noch andere Effekte haben könnte.
Nun geht es bei dieser Arbeit nicht darum, eine von persönlichen Interessen geleitete Forschungsfrage zu untersuchen, vielmehr sind nur „Fragen, die eine Wissenslücke im Theoriegebäude benennen und die Schließung dieser Wissenslücke anleiten, ... Forschungsfragen“ (Gläser & Laudel, 2006, S.64). Folglich zog ich das o.g. wissenschaftliche Gutachten zurate, musste aber feststellen, dass die Effekte von Nachhilfeunterricht in der bisherigen Forschung überwiegend an der Notenentwicklung festgemacht wurden. So wurde entsprechend unter dem Abschnitt „pädagogische Wirkungen von Nachhilfe“ das Fehlen von Studien konstatiert und gefordert, dass es weitere Forschungsarbeiten geben müsse, um bestehende Lücken zu schließen (Dohmen, Dieter, Erbes, Annegret, Fuchs Kathrin, Günzel Juliane (2008), S. 132, S. 149). All dies veranlasste mich zur folgenden Forschungsfrage: „Welche sozialen Effekte hat Nachhilfe?“ Dies möchte ich mithilfe eines narrativen Interviews erforschen.
2.2 Begriffsdefinition
Untersuchungsgegenstand dieser Hausarbeit ist das Thema Nachhilfe, für das es unterschiedliche Definitionen gibt, von denen nachfolgende hier Anwendung findet: Nachhilfe bezeichnet den „außerhalb des regulären Schulunterrichts und zusätzlich zu ihm stattfindenden, mehr oder weniger regelmäßigen und häufig vorübergehenden privaten Einzel- (oder Gruppen-) unterricht durch Lehrer, Studenten, Schüler und Laien zum Zwecke einer dem Schulunterricht nachfolgenden Erfolgssicherung in bestimmten Unterrichtsfächern“ (Krüger 1977, S. 545).
2.3 Hypothesenbildung
Laut Brüsemeister (2008) spielen Anfangshypothesen eine wichtige Rolle als erste Zugänge, um neue theoretische Konzepte aus Daten entwickeln zu können. Sie dienen nicht als Messlatte, sondern sensibilisieren ForscherInnen für Bestimmtes. Darüber hinaus stellt er es als natürlich dar, dass ForscherInnen nicht bei jeder neuen Untersuchung ihre Erfahrungen aufgeben. So vermutete ich aufgrund der oben bereits erwähnten Bemerkung einer Nachhilfeschülerin, dass ein Zusammenhang zwischen Nachhilfeunterricht und Schulangst bestehen könnte. Allerdings merkte ich dann bei der Formulierung dieser Hypothese, dass ich hier überwiegend von positiven Effekten ausging. Dies widerspricht dem Prinzip der Offenheit. Es wurde mir sehr deutlich, dass es bei der qualitativen Sozialforschung gerade nicht darum geht, Vermutungen zu überprüfen, sondern Neues zu entdecken. Aus diesem Grund beschloss ich dann auch, einen mir unbekannten Nachhilfeschüler zu interviewen. Dazu generierte ich nach dem Prinzip der Offenheit folgende Vorab-Hypothesen:
- Nachhilfeunterricht beeinflusst die Schul-/Prüfungsangst
- Nachhilfeunterricht wirkt sich auf das Selbstbewusstsein aus
- Nachhilfeunterricht verändert Lernmotivation und Lernstrategien
Diese werden im Verlauf der Untersuchung der Gegenstandsangemessenheit entsprechend gegebenenfalls angepasst oder ergänzt.
3. Darlegung der Methode: Das narrative Interview
Das narrative Interview ist eine Forschungsmethode der qualitativen Sozialforschung, die im wesentlichen von dem Soziologen Fritz Schütze entwickelt wurde und darauf basiert, dass der Interviewer mithilfe einer offen gehaltenen Eingangsfrage dem Erzähler einen Stimulus gibt, so dass dieser in einer Stegreiferzählung seinen biografischen Lebensweg darlegt. Der Erzähler wird dann nicht mehr unterbrochen, bis er seine Erzählung selbst beendet. Dies geschieht üblicherweise mit einer eindeutigen Formulierung. Dann wird in einem immanenten Nachfrageteil um weitere Detaillierung einzelner Erzählungen gebeten oder es werden abgebrochene Erzähllinien der Stegreiferzählung aufgegriffen. Im letzten Teil des Interviews hat der Interviewer die Möglichkeit, vorbereitete, exmanente Fragen zu stellen.
3.1 Begründung der Methodenwahl
Fritz Schütze (1983) beschreibt, wie mithilfe des narrativen Interviews soziale Entwicklungsprozesse bei Individuen erfasst werden können, indem Datentexte erzeugt werden, „welche die Ereignisverstrickungen und die lebensgeschichtliche Erfahrungsaufschichtung des Biographieträgers so lückenlos reproduzieren, wie das im Rahmen systematischer sozialwissenschaftlicher Forschung überhaupt nur möglich ist. ... Das Ergebnis ist ein Erzähltext, der den sozialen Prozess der Entwicklung und Wandlung einer biographischen Identität kontinuierlich ... darstellt und expliziert.“
[...]
Häufig gestellte Fragen
Welche sozialen Effekte kann Nachhilfe neben der Notenverbesserung haben?
Nachhilfe kann Auswirkungen auf die Reduzierung von Schulangst, die Steigerung des Selbstbewusstseins sowie die Veränderung von Lernmotivation und Lernstrategien haben.
Was ist ein "narratives Interview" in der Sozialforschung?
Es ist eine Methode, bei der der Befragte durch eine offene Eingangsfrage dazu angeregt wird, seine Erlebnisse als freie Stegreiferzählung ohne Unterbrechung darzustellen.
Wie wird Nachhilfe in dieser Arbeit definiert?
Nachhilfe ist privater Zusatzunterricht außerhalb der regulären Schule, der der Erfolgssicherung in bestimmten Fächern dient.
Was unterscheidet qualitative von quantitativer Sozialforschung?
Qualitative Forschung will Neues entdecken und Theorien entwickeln, während quantitative Forschung meist bestehende Theorien durch Messzahlen überprüft.
Warum wurden in der Arbeit Vorab-Hypothesen gebildet?
Sie dienen als erster Zugang und sensibilisieren die Forscherin für bestimmte Themen, ohne das Prinzip der Offenheit für neue Entdeckungen zu verletzen.
Was war der Anlass für diese Untersuchung?
Ein wissenschaftliches Gutachten des Bildungsministeriums wies auf erhebliche Forschungslücken bei den pädagogischen Wirkungen von Nachhilfe hin.
- Quote paper
- Marion Biroth (Author), 2008, Die sozialen Effekte von Nachhilfe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/121258