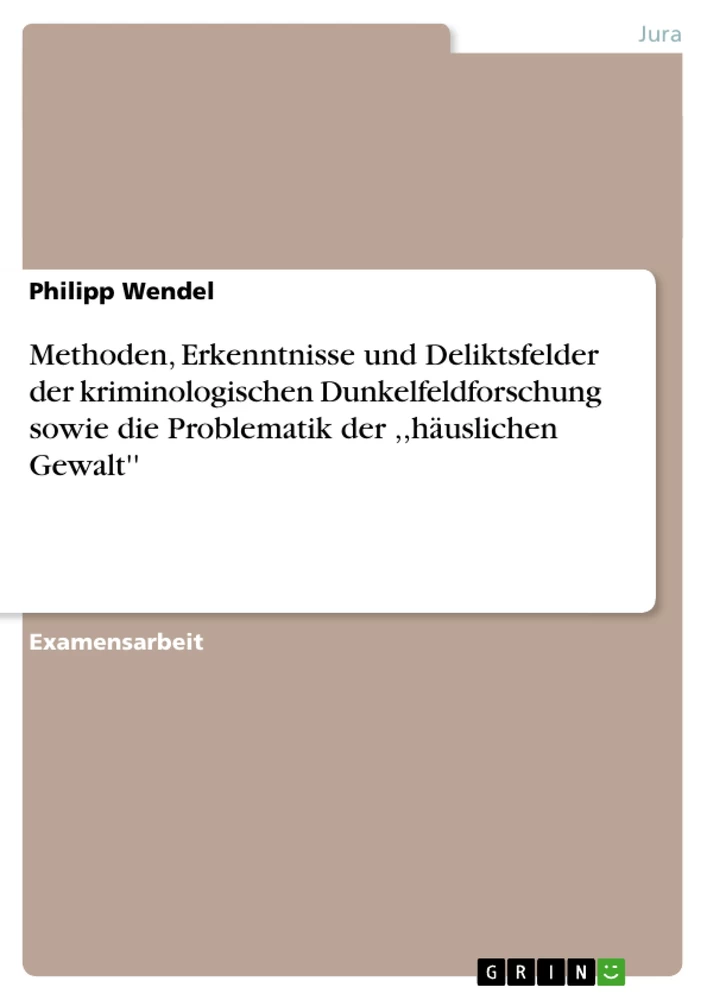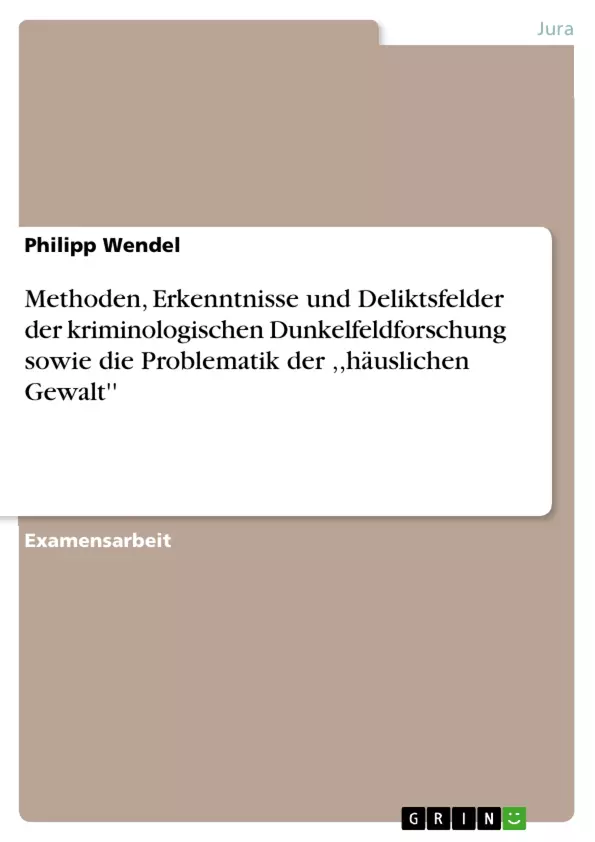Eine exakte Erfassung der Kriminalitätswirklichkeit in Deutschland ist aufgrund verschiedener variabler Faktoren unmöglich. Registriert wird die Kriminalität in Deutschland in der ,,Kriminalstatistik’’, welche alle solche amtlichen Statistiken umfasst, in denen Ergebnisse staatlicher Ermittlungs- und Strafverfolgungstätigkeit vermerkt werden. Eine sehr wichtige Informationsquelle für die Öffentlichkeit, die Strafverfolgungsbehörden und die Wissenschaft über Umfang, Struktur und Entwicklung der Kriminalität ist die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS). Die PKS ist nach ihrer eigenen Definition die Zusammenstellung der erfassbaren wesentlichen Inhalte aller der Polizei bekannt gewordenen strafrechtlichen Sachverhalte. Sie wird bei ,,statischer und dynamischer Betrachtungsweise unter verschiedenen Einschränkungen gewisse Aussagen zur Struktur vermuteter tatsächlicher Kriminalität ermöglichen’’. Dies wird allerdings nicht gelten können bei Taten und/oder zugehörigen Tätern mit hoher Entdeckungsimmunität sowie bei außergewöhnlichen Verfolgungserschwernissen z.B. bei Delikten, bei denen gesellschaftlich dominierende Einstellungen eine informelle bzw. formelle Strafverfolgung hemmen, weil diese Delikte beispielsweise nicht zur Anzeige gebracht werden. Um sich der realen Verbrechenswirklichkeit anzunähern und damit dass Kriminalitätslagebild zu optimieren, ist es notwendig, ergänzend zu den kriminalstatistischen Informationen über das Hellfeld auch Daten über diejenigen Taten zu gewinnen, die den Blicken der Strafverfolgungsbehörden entzogen sind und daraus Resultierend gewissermaßen im Dunkeln verbleiben. Dieser Aufgabe widmet sich die sog. Dunkelfeldforschung. Allgemein bezeichnet der Begriff des Dunkelfeldes die ,,Summe jener tatsächlich begangenen Straftaten, die nicht amtlich bekannt geworden sind und dementsprechend nicht in der Kriminalstatistik in Erscheinung treten’’.
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel 1: Einführung in die Thematik
- Kapitel 2: Analyse bestehender Literatur
- Kapitel 3: Diskussion der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Hausarbeit im Schwerpunktbereich Strafjustiz und Kriminologie analysiert die vorhandene Literatur zu einem spezifischen Thema innerhalb der Strafjustiz. Ziel ist es, einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu geben und die wichtigsten Aspekte kritisch zu beleuchten.
- Analyse der Forschungsliteratur im Bereich Strafjustiz
- Kritische Betrachtung unterschiedlicher methodischer Ansätze
- Zusammenstellung und Auswertung relevanter empirischer Daten
- Identifikation von Forschungslücken und zukünftigen Forschungsfragen
- Bewertung der Relevanz der Forschung für die Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einführung in die Thematik: Dieses Kapitel wird voraussichtlich eine Einleitung in das Thema der Arbeit bieten, die Forschungsfrage formulieren und die Methodik der Literaturanalyse darlegen. Es wird die Relevanz des gewählten Themas im Kontext der Strafjustiz und Kriminologie erläutern und den Rahmen der Untersuchung abstecken. Die Einleitung wird den Lesenden einen klaren Überblick über die Struktur und die Zielsetzung der Arbeit geben. Der Fokus wird auf die Begründung der Relevanz des Forschungsthemas liegen und die methodischen Schritte zur Literaturanalyse detailliert beschreiben.
Kapitel 2: Analyse bestehender Literatur: In diesem Kapitel wird eine systematische Analyse der relevanten Literatur erfolgen. Die Arbeit wird verschiedene wissenschaftliche Publikationen, empirische Studien und relevante Gesetzestexte untersuchen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der kritischen Auseinandersetzung mit den jeweiligen Argumentationen, Methodologien und Ergebnissen. Die Zusammenfassung der einzelnen Literaturstellen wird zu einem umfassenden Bild des aktuellen Forschungsstands führen und mögliche Widersprüche und offene Fragen aufzeigen. Die Analyse wird die unterschiedlichen Perspektiven und Ansätze der Autoren berücksichtigen und diese kritisch bewerten.
Kapitel 3: Diskussion der Ergebnisse: Dieses Kapitel diskutiert die Ergebnisse der Literaturanalyse aus Kapitel 2. Es werden Schlussfolgerungen aus den gewonnenen Erkenntnissen gezogen und die Bedeutung der Ergebnisse für die Praxis der Strafjustiz bewertet. Mögliche Limitationen der Forschung werden angesprochen und Ansätze für zukünftige Forschungsarbeiten vorgeschlagen. Die Diskussion wird den Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis hervorheben und die Implikationen der Ergebnisse für die Weiterentwicklung des gewählten Forschungsgebietes erläutern. Der Fokus liegt auf der kritischen Reflexion der gewonnenen Erkenntnisse und ihrer Bedeutung für das Verständnis des gewählten Themas.
Schlüsselwörter
Strafjustiz, Kriminologie, Literaturanalyse, empirische Forschung, methodische Ansätze, Forschungsstand, Strafrecht, Rechtswissenschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur wissenschaftlichen Hausarbeit: Analyse der Literatur im Bereich Strafjustiz und Kriminologie
Was ist der Inhalt dieser wissenschaftlichen Hausarbeit?
Die Arbeit analysiert bestehende Literatur im Bereich Strafjustiz und Kriminologie zu einem spezifischen Thema (welches in der Vorlage nicht genannt wird). Sie umfasst eine Einleitung, die Literaturanalyse selbst und eine abschließende Diskussion der Ergebnisse. Der Fokus liegt auf der kritischen Auseinandersetzung mit verschiedenen methodischen Ansätzen und der Identifikation von Forschungslücken.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: Kapitel 1 (Einführung), Kapitel 2 (Literaturanalyse) und Kapitel 3 (Diskussion der Ergebnisse). Kapitel 1 bietet eine Einleitung in das Thema, formuliert die Forschungsfrage und beschreibt die Methodik. Kapitel 2 analysiert systematisch relevante Literatur, inklusive wissenschaftlicher Publikationen, empirischer Studien und Gesetzestexte. Kapitel 3 diskutiert die Ergebnisse der Literaturanalyse, zieht Schlussfolgerungen und schlägt Ansätze für zukünftige Forschung vor.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu einem spezifischen Thema innerhalb der Strafjustiz zu geben und die wichtigsten Aspekte kritisch zu beleuchten. Sie analysiert die Forschungsliteratur, betrachtet unterschiedliche methodische Ansätze kritisch, wertet relevante empirische Daten aus, identifiziert Forschungslücken und bewertet die Relevanz der Forschung für die Praxis.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der Forschungsliteratur im Bereich Strafjustiz, eine kritische Betrachtung unterschiedlicher methodischer Ansätze, die Zusammenstellung und Auswertung relevanter empirischer Daten, die Identifizierung von Forschungslücken und zukünftigen Forschungsfragen sowie die Bewertung der Relevanz der Forschung für die Praxis.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Strafjustiz, Kriminologie, Literaturanalyse, empirische Forschung, methodische Ansätze, Forschungsstand, Strafrecht, Rechtswissenschaft.
Wie wird die Literatur analysiert?
Die Literaturanalyse in Kapitel 2 erfolgt systematisch und kritisch. Die Arbeit untersucht verschiedene wissenschaftliche Publikationen, empirische Studien und relevante Gesetzestexte. Der Schwerpunkt liegt auf der kritischen Auseinandersetzung mit Argumentationen, Methodologien und Ergebnissen, um ein umfassendes Bild des aktuellen Forschungsstands zu erstellen und Widersprüche sowie offene Fragen aufzuzeigen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen werden in Kapitel 3 gezogen. Dieses Kapitel diskutiert die Ergebnisse der Literaturanalyse, bewertet deren Bedeutung für die Praxis der Strafjustiz, spricht mögliche Limitationen der Forschung an und schlägt Ansätze für zukünftige Forschungsarbeiten vor. Der Fokus liegt auf der kritischen Reflexion der gewonnenen Erkenntnisse und ihrer Bedeutung für das Verständnis des gewählten Themas.
- Quote paper
- Philipp Wendel (Author), 2008, Methoden, Erkenntnisse und Deliktsfelder der kriminologischen Dunkelfeldforschung sowie die Problematik der ,,häuslichen Gewalt'', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/121348