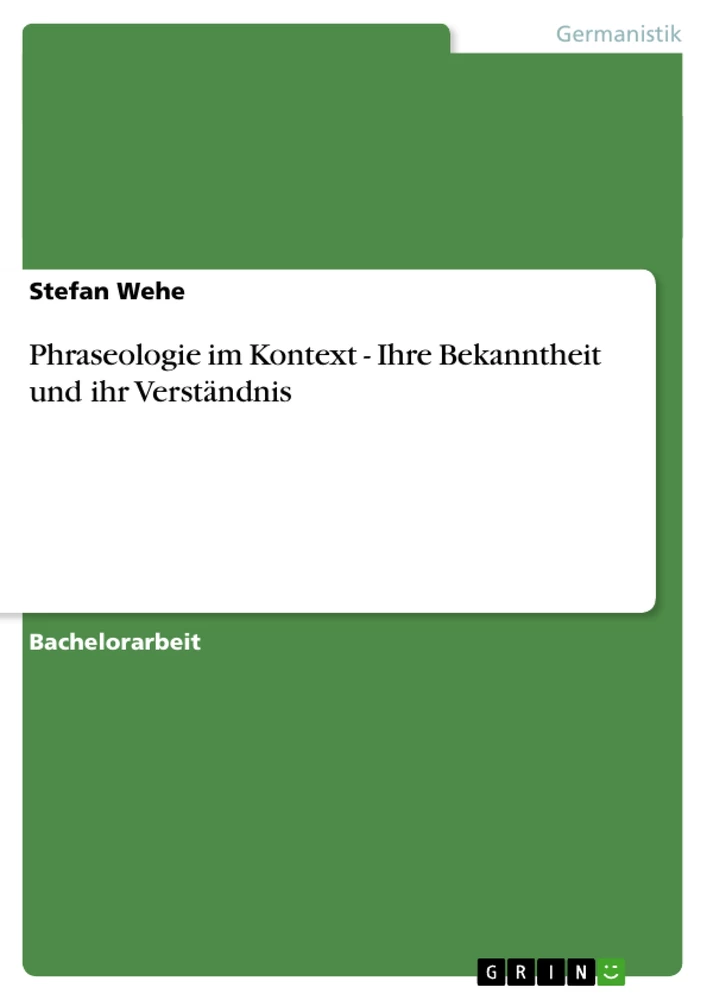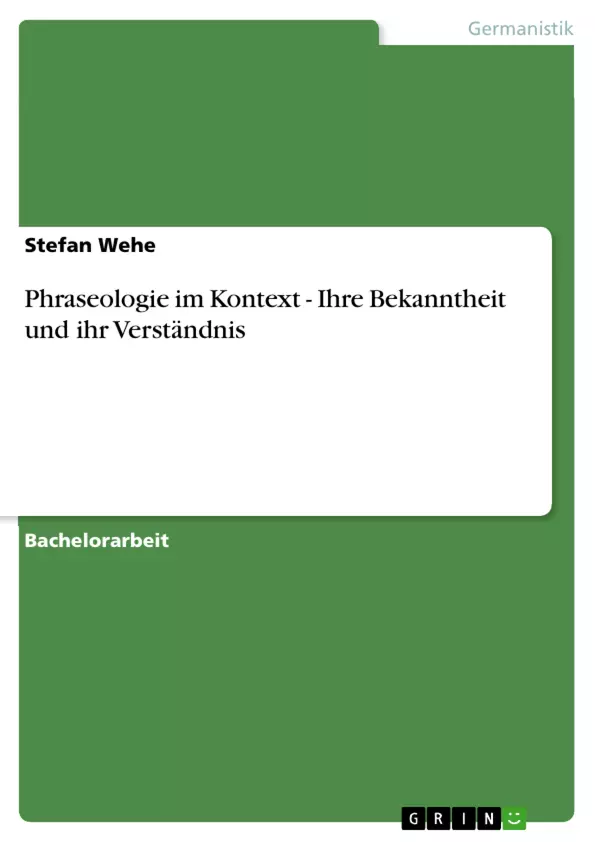Phraseologismen begegnen uns regelmäßig in der Alltagssprache. „Die Flinte ins Korn werfen“, „den Mund halten“ oder auch Formulierungen wie „guten Tag“ können als Beispiele dieses überaus
großen Sprachbereichs gelten. Häufig dienen sie dabei der Erweiterung unseres Wortschatzes aber auch der Benennung und Verarbeitung der sprachlichen und vor allem der mentalen Welt. Auch in der Wissenschaft haben sie Aufmerksamkeit erhalten. Als Teildisziplin1 der Lexikologie oder auch als selbstständige linguistische Disziplin ist die Phraseologie seit den 70er Jahren in den Fokus der
Sprachwissenschaft gerückt.2 Insbesondere Analysen von Werbesprache setzten Phraseologismen als allgemeingültig und bekannt voraus. Diese Untersuchung soll überprüfen, ob die gängige Akzeptanz der Phraseologismen als tatsächlich gelten kann. Wie bekannt sind Phraseologismen? Wie oft werden sie verwendet, wie verstanden und
wie erlernt? Welche Rolle spielt der Kontext dabei? All diese Fragen sollen im Zentrum dieser Arbeit stehen. Ihnen vorausgehend wird sowohl eine notwendige, ausführliche und wissenschaftliche Begriffsbestimmung als auch eine Analyse der Funktionen der Phraseologismen erfolgen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Themenkomplex Phraseologie
- 2.1 Definition
- 2.1.1 Polylexikalität
- 2.1.2 Festigkeit
- 2.1.2.1 Psycholinguistische Festigkeit
- 2.1.2.2 Strukturelle Festigkeit
- 2.1.2.3 Pragmatische Festigkeit
- 2.1.3 Idiomatizität
- 2.2 Terminologie und ihre Probleme
- 2.3 Klassifikation und Abgrenzung
- 2.4 Funktionen von Phraseologismen
- 3. Die Untersuchung - eine Evaluation mittels Fragebogen
- 3.1 Vorüberlegungen
- 3.2 Psycholinguistische und pragmatische Aspekte der Phraseologie
- 3.2.1 Psycholinguistische Aspekte
- 3.2.2 Spracherwerb von Phraseologismen
- 3.3 Durchführung der Untersuchung
- 3.3.1 Die Versuchspersonen und die Durchführung der Untersuchung
- 3.3.2 Aufbau und Inhalt des Fragebogens
- 3.4 Auswertung der Untersuchung
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Bekanntheit und das Verständnis von Phraseologismen bei Schülern der 7. Jahrgangsstufe. Ziel ist es, das individuelle Wissen über verschiedene Phraseologismen zu ermitteln und deren Verständnis im Kontext zu analysieren. Es soll untersucht werden, wie kontextuelle Einflüsse das Verständnis beeinflussen und welche Rolle semantische Struktur und syntaktische Funktion spielen.
- Bekanntheit und Verwendung von Phraseologismen
- Einfluss des Kontextes auf das Verständnis von Phraseologismen
- Rolle der semantischen Struktur und syntaktischen Funktion
- Analyse der psycholinguistischen und pragmatischen Aspekte der Phraseologie
- Evaluation des Wissens über Phraseologismen mittels Fragebogen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 (Einleitung): Die Einleitung stellt die Relevanz der Phraseologie in Alltagssprache und Wissenschaft dar und formuliert die Forschungsfragen der Arbeit. Es wird die Notwendigkeit einer wissenschaftlichen Begriffsbestimmung und der Analyse der Funktionen von Phraseologismen hervorgehoben.
Kapitel 2 (Der Themenkomplex Phraseologie): Dieses Kapitel definiert den Begriff Phraseologismus anhand der Kriterien Polylexikalität, Festigkeit und Idiomatizität. Die verschiedenen Aspekte der Festigkeit (psycholinguistisch, strukturell, pragmatisch) werden erläutert. Die Kapitel behandeln zudem die Terminologie, Klassifikation, und die Funktionen von Phraseologismen.
Kapitel 3 (Die Untersuchung - eine Evaluation mittels Fragebogen): Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der Untersuchung, einschließlich der Vorüberlegungen, der psycholinguistischen und pragmatischen Aspekte, der Durchführung (Probanden, Fragebogen), und der Auswertung der Daten. Die Kapitel beschreibt den Aufbau und den Inhalt des Fragebogens.
Schlüsselwörter
Phraseologie, Phraseologismen, Polylexikalität, Festigkeit, Idiomatizität, Kontext, Verständnis, Spracherwerb, Fragebogen, Evaluation, Schüler, semantische Struktur, syntaktische Funktion.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Phraseologismus?
Ein fester sprachlicher Ausdruck aus mehreren Wörtern (Polylexikalität), dessen Bedeutung oft nicht direkt aus den Einzelwörtern ableitbar ist (Idiomatizität).
Was bedeutet "Idiomatizität"?
Es beschreibt den Grad, zu dem ein Ausdruck eine übertragene Bedeutung hat, wie bei "die Flinte ins Korn werfen" (aufgeben).
Wie wichtig ist der Kontext für das Verständnis von Redewendungen?
Der Kontext ist entscheidend, da er Hinweise auf die übertragene Bedeutung gibt und hilft, Phraseologismen von wörtlich gemeinten Sätzen zu unterscheiden.
Wie erlernen Kinder Phraseologismen?
Der Spracherwerb erfolgt meist über den regelmäßigen Kontakt in der Alltagssprache und durch das Erschließen der Bedeutung in konkreten Situationen.
Was versteht man unter "Struktureller Festigkeit"?
Dass Phraseologismen in ihrer Form meist unveränderlich sind; man kann Wörter oft nicht einfach austauschen oder die Grammatik stark verändern, ohne dass der Ausdruck seine Funktion verliert.
- Quote paper
- Stefan Wehe (Author), 2008, Phraseologie im Kontext - Ihre Bekanntheit und ihr Verständnis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/121428