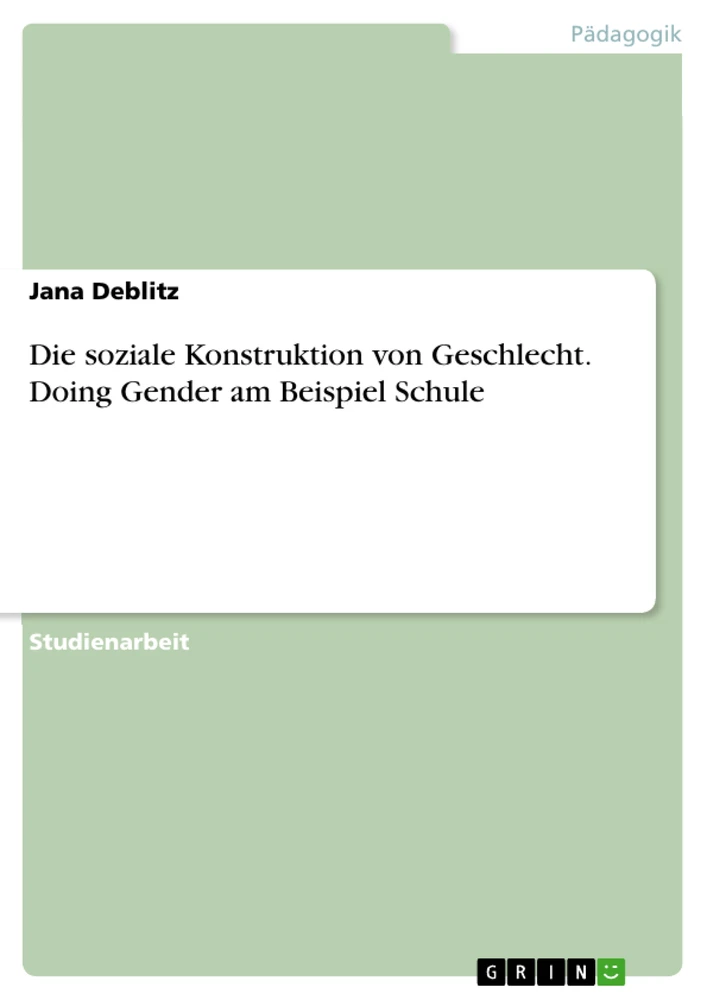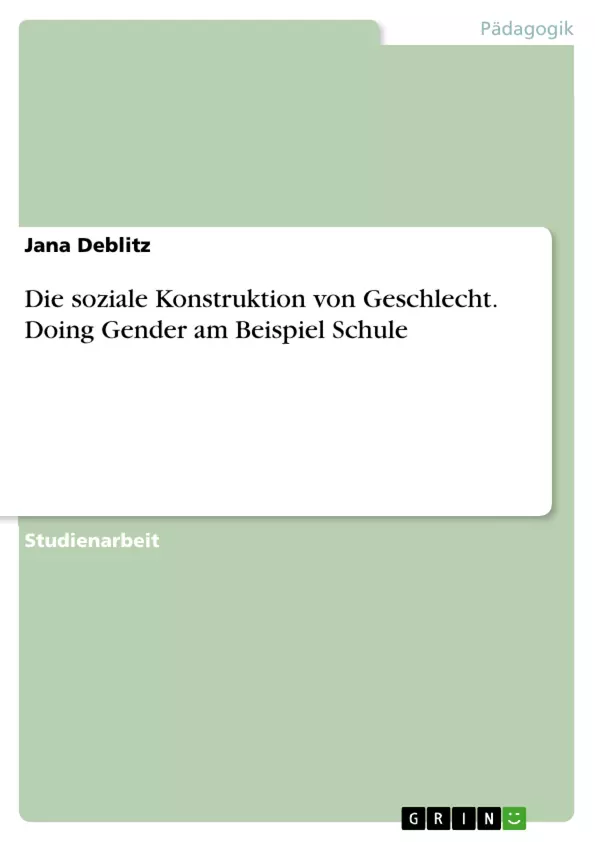Bevor sich diese Arbeit der Frage, in welchem Ausmaß der Erwerb des sozialen Geschlechts in der Schule durch das „doing gender“ beeinflusst wird, widmet, muss zunächst eine geschlechtertheoretische Grundlage geschaffen werden. Dafür werden zuerst die Begrifflichkeiten „sex/sex category“ sowie die beiden Begriffe „soziale Konstruktion“ und „gender“ erläutert und voneinander abgegrenzt. Anschließend wird der Prozess des „doing gender“ definiert und erklärt. In einer Zusammenfassung werden die Begriffe noch einmal miteinander in Zusammenhang gebracht.
Im nächsten Kapitel wird konkreter auf „doing gender“ in der Institution Schule eingegangen. Hierfür werden zunächst vorhandene Geschlechterdifferenzen in der Schule thematisiert, wobei auf den Bildungserfolg und die Leistungsunterschiede zwischen Jungen und Mädchen, (sowie die Interaktion zwischen Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften) genauer eingegangen wird. Anschließend werden verschiedene Erklärungsansätze und Ursachen für die Geschlechtsunterschiede erläutert.
Im Fokus des letzten Kapitels steht der Weg zu einer geschlechtergerechten Schule durch eine gendersensible Pädagogik. Es wird aufgezeigt, wie Geschlechtsunterschiede vermieden und somit eine Geschlechtergerechtigkeit hergestellt werden kann. Hierbei wird neben den Herausforderungen für die Lehrkräfte, auch auf die Chancen und Potenziale, die sich durch eine Gleichstellung der Geschlechter ergeben, eingegangen. Der Abschluss der Arbeit bildet das Fazit mit einem kurzen Ausblick auf die Pädagogik der Zukunft.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschlechtertheoretische Grundlagen
- Begriffe „sex“ und „sex category“
- Begriffe „soziale Konstruktion“ und „gender“
- Definition des Konzepts „doing gender“
- Zusammenfassung
- Doing Gender in der sozialen Institution Schule
- Geschlechterdifferenzen in der Schule
- Ursachen und Erklärungsansätze für Geschlechterunterschiede
- Biologische Faktoren
- Psychosoziale Faktoren
- Zusammenfassung
- Gendersensible Pädagogik als Weg zur Geschlechtergerechtigkeit
- Fazit
- Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung befasst sich mit der sozialen Konstruktion von Geschlecht und untersucht, wie das Konzept „doing gender“ im Kontext der sozialen Institution Schule wirkt. Sie analysiert, wie geschlechtstypische Rollen und Verhaltensmuster in der Schule reproduziert werden und welche Folgen dies für die individuelle Entwicklung von Schülerinnen und Schülern haben kann.
- Soziale Konstruktion von Geschlecht
- Das Konzept „doing gender“
- Geschlechterdifferenzen in der Schule
- Ursachen und Erklärungsansätze für Geschlechterunterschiede
- Gendersensible Pädagogik als Weg zur Geschlechtergerechtigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der sozialen Konstruktion von Geschlecht und dem Konzept „doing gender“ ein. Sie verdeutlicht die Relevanz dieser Konzepte für die pädagogische Praxis, insbesondere im Kontext der Schule.
Das zweite Kapitel stellt die geschlechtertheoretischen Grundlagen dar. Es erläutert die Begriffe „sex“, „sex category“, „soziale Konstruktion“ und „gender“ und definiert das Konzept „doing gender“.
Im dritten Kapitel wird das Konzept „doing gender“ auf die Institution Schule angewendet. Es werden Geschlechterdifferenzen im Bildungssystem thematisiert, Ursachen und Erklärungsansätze für diese Differenzen diskutiert.
Das vierte Kapitel beleuchtet die Gendersensible Pädagogik als Ansatz zur Gestaltung einer geschlechtergerechten Schule. Es werden Möglichkeiten und Herausforderungen für die Umsetzung einer gendersensiblen Pädagogik in der Praxis aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Ausarbeitung sind: Soziale Konstruktion, Geschlecht, doing gender, Schule, Geschlechterdifferenz, Gendersensible Pädagogik, Geschlechtergerechtigkeit.
- Citar trabajo
- Jana Deblitz (Autor), 2020, Die soziale Konstruktion von Geschlecht. Doing Gender am Beispiel Schule, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1214665