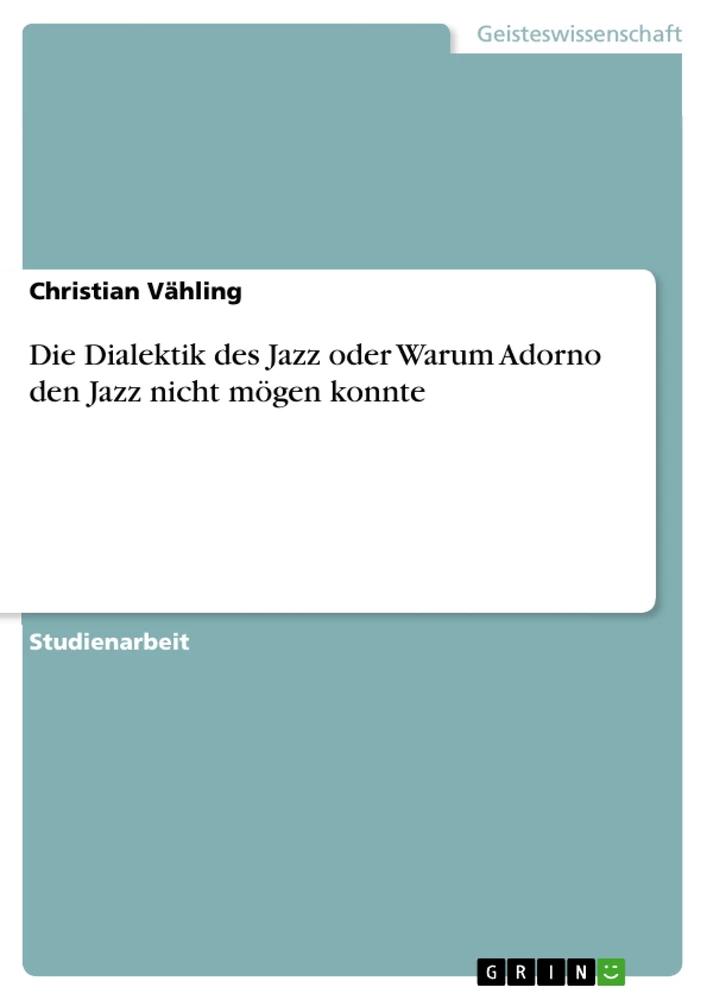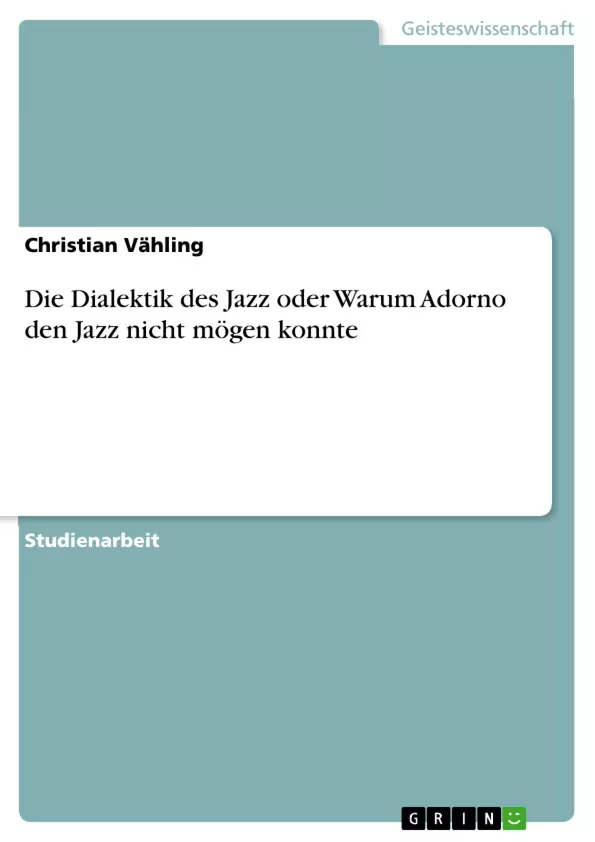Wann immer sich jemand von Adorno distanzieren möchte, ohne richtige Argumente zu haben, kommt früher oder später der Hinweis auf Adornos Missverhältnis zur Jazzmusik. Tatsächlich gilt Adornos Ablehnung des Jazz als Prototyp der Kritik an der Kulturindustrie in der "Dialektik der Aufklärung".
Wer sich die betreffenden Texte genauer ansieht, stellt fest, dass Adornos Ablehnung des Jazz keineswegs total war. Er bezieht sich in seiner Kritik vor allem auf den nachgespielten, von Noten abgelesenen Jazz der deutschen Tanzorchester (eine Differenzierung, die später verwischt). Er kritisiert die stilistischen Besonderheiten des aufgeschriebenen Jazz aus der Perspektive des Zwölftonkomponisten und berücksichtigt nur am Rand, dass die Übertragung auf das europäische Notensystem bereits eine Verfremdung der afrikanischen Harmonik des Jazz beinhaltet. Zudem entlarvt er den kreativen Impuls des Jazz als eher sportlich denn künstlerisch. So betrachtet, ist der Jazz für Adorno wenig mehr als ein triviales Ausdrucksmittel der Kulturindustrie, und auf keinen Fall die Kunstmusik, als die er heute gilt. (Zu unrecht, denn auch das war er anfangs nicht. Der frühe Jazz lässt sich eher mit dem heutigen Hip Hop vergleichen als mit dem heutigen Avantgarde-Jazz.)
Aus all dem lässt sich ableiten, dass Adorno schlicht keine Ahnung vom Jazz hatte, aber diese Kritik greift zu kurz. Denn die Formen, die er (fälschlich) als Grundelemente des Jazz analysiert hatte, (die Synkope und die Blue Notes) wurden in der weiteren Entwicklung, spätestens im Jazzrock der Siebziger, tatsächlich zu ebendiesen Grundelementen. Der Jazz entwickelte sich, vereinfacht gesagt, entlang der von Adorno und Horkheimer beschriebenen Mechanismen der Kulturindustrie zu genau dem Produkt, das Adorno beschrieben hatte. Als Kritik der massenmedialen Verwertung des Jazz ist Adornos Jazzkritik weit besser als ihr Ruf. Oder anders formuliert: Selbst wenn Adorno keine richtige Ahnung hatte, war seine Theorie gut.
Inhaltsverzeichnis
- Intro: Mißtöne
- Tonart: Geistiger Hintergrund
- Grundmelodie: Adornos Musiksoziologie
- Jam: Wirklichkeit" des Jazz
- Solo: Wahrheit" des Jazz
- Schlußakkord: Adorno kritisieren
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Theodor W. Adornos kritische Haltung gegenüber Jazzmusik im Kontext seiner Musiksoziologie. Sie hinterfragt, inwieweit Adornos Kritik die Wesensmerkmale des Jazz erfasst und diskutiert, ob seine Ablehnung auf rationalen Argumenten oder persönlichen Vorurteilen basiert.
- Adornos Verhältnis zum Jazz im Vergleich zum gängigen Verständnis des Jazz
- Adornos Musiksoziologie und deren Bezug zur Kritik am Jazz
- Die Dialektik zwischen Adornos standortgebundener Kritik und dem ereignishaften Charakter des Jazz
- Die Rolle des Jazz in Adornos Kulturindustriekritik
- Adornos kritisches Verständnis von Musik und dessen Bezug zur Zwölftonmethode
Zusammenfassung der Kapitel
- Intro: Mißtöne
Das Kapitel behandelt die kontroversen Debatten um Adornos Jazzkritik und stellt die Arbeit von Neitzert und Steinert vor, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Es werden die Diskrepanzen zwischen Adornos Ablehnung des Jazz und der gängigen Wahrnehmung des Jazz als rebellische Musikform beleuchtet. - Tonart: Geistiger Hintergrund
Dieses Kapitel analysiert Adornos Denkweise und seine Methode, die er in seiner Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Phänomenen anwendet. Dabei wird die Bedeutung der dialektischen Methode für Adornos Vorgehensweise hervorgehoben und die Frage aufgeworfen, ob die vehemente Ablehnung des Jazz von Jazzmusikern selbst zu einem Rechtfertigungsdruck geführt hat. - Grundmelodie: Adornos Musiksoziologie
Der dritte Teil der Arbeit widmet sich Adornos „Ideen zur Musiksoziologie“ und untersucht seine Analyse der gesellschaftlichen Verwobenheit von Musik. Adornos Konzept der musikalischen Kritik und der Bezug zur Zwölftonmethode werden erläutert. - Jam: Wirklichkeit" des Jazz
Dieses Kapitel soll sich mit der Interpretation der „Wirklichkeit" des Jazz auseinandersetzen, die aus Adornos Sichtweise hervorgeht. Es wird erwartet, dass hier Adornos Kritik an der improvisatorischen Natur des Jazz sowie an der gesellschaftlichen Einordnung des Jazz in der Kulturindustrie betrachtet wird. - Solo: Wahrheit" des Jazz
Der fünfte Teil befasst sich mit Adornos Konzept der „Wahrheit" des Jazz, die möglicherweise in seiner Kritik zum Ausdruck kommt. Es ist zu erwarten, dass hier Adornos Kritik an der vermeintlichen Unfähigkeit des Jazz, genuine Kunst zu schaffen, beleuchtet wird.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Adornos Musiksoziologie, Jazzkritik, Kulturindustrie, Zwölftonmethode, dialektische Methode, Standpunktgebundenheit, Improvisation, gesellschaftliche Verwobenheit von Musik, kritisches Musikverständnis und Wahrheit in der Musik.
- Quote paper
- Christian Vähling (Author), 1997, Die Dialektik des Jazz oder Warum Adorno den Jazz nicht mögen konnte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12150