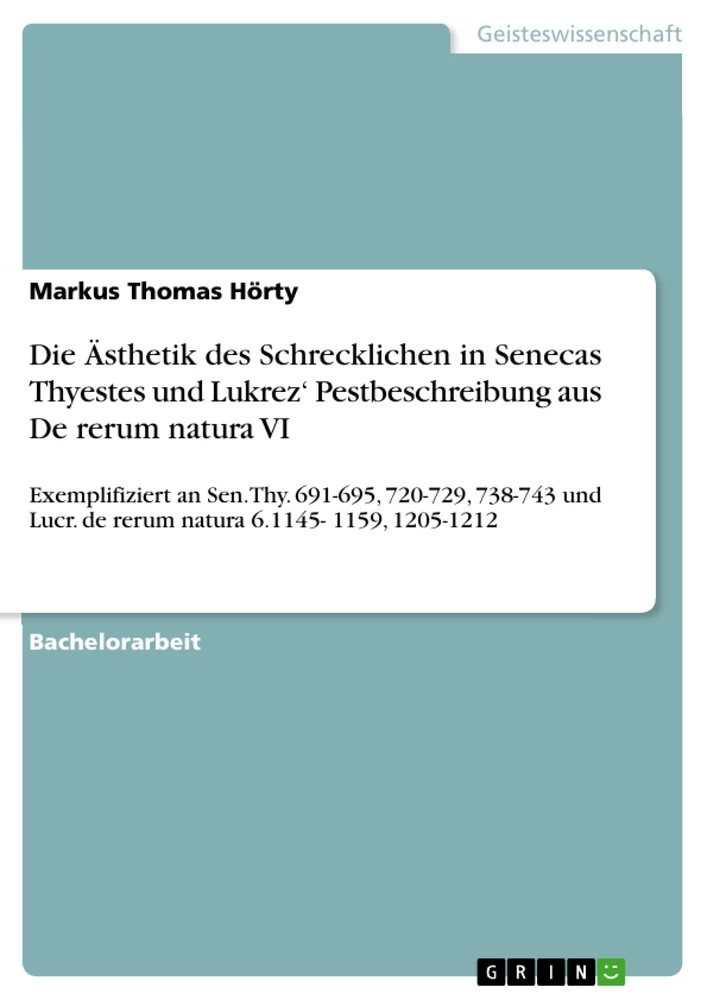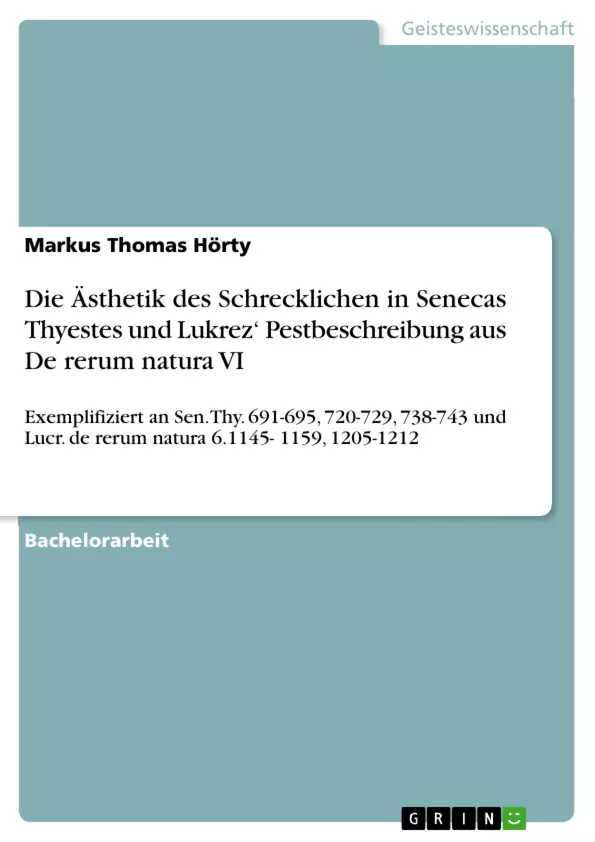Die Werke, die im Zentrum der vorliegenden Arbeit stehen, sind durchaus sehr verschieden, ebenso wie ihre Autoren. Lucius Annaeus Seneca Philosophus war einer der reichsten und mächtigsten Männer seiner Zeit, sein literarisches Schaffen vielfältig. Bemerkenswert ist seine von Grausamkeit bestimmte Tragödiendichtung: In seinem Thyestes schlachtet Atreus seine Neffen in einem düster-verstörenden Opferritus voller Ambivalenz und Paradoxie auf brutale Art und Weise hin und serviert sie anschließend seinem Bruder als Gastmahl. Die antike Idee von ξενία, der Gastfreundschaft, wird zu einer bizarren Parodie. Dass offensichtlich auch das stoische Prinzip der ἀπάθεια, der Freiheit von den Affekten, in Atreus negiert wird überrascht, war Seneca doch Stoiker.
Über Titus Lucretius Carus, den Autoren des zweiten vorliegenden Werks, ist wenig bekannt. In De rerum natura versucht er seine Vorstellung epikureischer Physik in Form eines Lehrgedichts darzubringen, wobei auch ethische Erwägungen geschickt eingestreut werden. Hervor sticht die eklige und grausig-detaillierten Darstellung der Epidemie in Athen im 5. Jahrhundert v. Chr. Dieser literarische Charakter ist dabei beispiellos innerhalb des Gesamtwerks; nirgends sonst umreißt der Autor ein Bild, welches in diesem Maße das Ekelhafte evoziert. Darf man annehmen, dass vorbenannte Darstellung eine künstlerische Absicht verfolgt, die den historischen Stoff lediglich zu Grunde legt und im Exzess eine unterliegende Botschaft zu mitteln sucht?
In beiden Texten werden Bilder gezeichnet, die die Grenzen von Anstand und Geschmack weit überschreiten. Beide stammen von einem Autor, von dem vermutet werden darf, dass Einflüsse seiner jeweiligen philosophischen Ansichten in seinem Werk Ausdruck finden. Diese Arbeit nun soll mittels einer Synopse (altgr. σύνοψις, Zusammenschau) zweierlei herausstellen: Zunächst, ob sich eine gemeinsame Essenz der Ästhetik des Schrecklichen herausarbeiten lässt, auf deren Basis beide Passagen operieren und - darauf aufbauend - inwiefern diese Form der Ästhetik als rhetorisch-inhaltliche Gestaltungsmethode philosophischen Ausdruckscharakter trägt. Dazu werden zunächst beide Passagen gesondert analysiert und wesentliche gestalterische Merkmale der Ästhetik des Schrecklichen und philosophische Aspekte, sowie ihr Zusammenspiel diskutiert. Zuvor werden für die Arbeit die wesentlichen philosophische Strömungen angerissen und die Grundideen des Konzepts der "Ästhetik des Schrecklichen" dargelegt.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- THEORETISCHE UND HISTORISCHE GRUNDLAGEN
- DAS KONZEPT DER ÄSTHETIK DES SCHRECKLICHEN IN DER LITERATUR
- DIE STOA
- DER EPIKUREISMUS
- DIE ÄSTHETIK DES SCHRECKLICHEN IN SENECAS THYESTES
- TEXTSTELLE
- ÜBERSETZUNG
- INTERPRETATION
- Einordnung der Textstelle in den Kontext
- Die Ästhetik der Brutalität und das Paradoxe am Beispiel der Schlachtung der Neffen des Atreus
- Der Perspektivwechsel vom Opfer- zum Täterblick im Botenbericht
- Die Rolle der ¿vάpyɛta in der Ästhetik des Schrecklichen
- Atreus saevus als Antistoiker? Einsatz schrecklich-ästhetisierender Elemente zur Realisierung einer philosophischen Aussageabsicht
- DIE ÄSTHETIK DES SCHRECKLICHEN IN LUKREZ' DE RERUM NATURA
- TEXTSTELLE
- ÜBERSETZUNG
- INTERPRETATION
- Einordnung der Textstelle in den Kontext
- Das Schreckliche in der Verletzung der Integrität des menschlichen Körpers
- Die Verbildlichung des Ekels
- Ekel und Panik - Nährboden für die Vermittlung epikureischer Philosophie?
- SYNOPSIS
- EKEL UND BRUTALITÄT – VERSCHIEDENE SPIELARTEN DES SCHRECKENS
- DAS ZUSAMMENSPIEL VON GRENZEN UND GRENZÜBERSCHREITUNG
- EINSATZ DER ¿NAPÈEIA ZUR VERGEGENWÄRTIGUNG DES SCHRECKENS
- DIE PHILOSOPHISCHE BELEHRUNG ALS ENDZWECK?
- SCHLUSS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Verwendung der Ästhetik des Schrecklichen in zwei antiken Texten: Senecas Tragödie Thyestes und Lukrez' Lehrgedicht De rerum natura. Das Ziel ist es, zu erforschen, ob sich eine gemeinsame Essenz der Ästhetik des Schrecklichen herausarbeiten lässt und wie diese Form der Ästhetik als rhetorisch-inhaltliche Gestaltungsmethode philosophischen Ausdruckscharakter tragen kann.
- Die Darstellung von Brutalität und Ekel als Mittel der Ästhetik des Schrecklichen
- Die Rolle von Grenzüberschreitung und Grenzsetzung in der Ästhetik des Schrecklichen
- Das Zusammenspiel von Sprache und Bildlichkeit in der Darstellung des Schrecklichen
- Der Einfluss der stoischen und epikureischen Philosophie auf die Gestaltung des Schrecklichen
- Die Funktion der Ästhetik des Schrecklichen als Mittel der philosophischen Belehrung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die beiden untersuchten Texte und ihre Autoren vor, wobei die Besonderheit der Verwendung des Schrecklichen in beiden Werken hervorgehoben wird. Das Ziel der Arbeit wird formuliert: Die Analyse der gemeinsamen Essenz der Ästhetik des Schrecklichen und ihre Bedeutung für die philosophische Botschaft der Texte.
- Theoretische und historische Grundlagen: Dieses Kapitel definiert das Konzept der Ästhetik des Schrecklichen in der Literatur und beleuchtet seine historische Entwicklung. Es wird erläutert, wie das „Schreckliche“ in der Kunst und Literatur zur Kategorie wurde, die moralisch unabhängig existieren kann. Die Stoa wird als eine der wichtigsten philosophischen Strömungen der Antike vorgestellt, die Senecas Denken beeinflusst hat. Das stoische Konzept der ȧлáðɛα, der Freiheit von Affekten, steht im Fokus der Analyse.
- Die Ästhetik des Schrecklichen in Senecas Thyestes: Dieses Kapitel analysiert Senecas Tragödie Thyestes mit Fokus auf die Darstellung des Schrecklichen. Die Textauszüge des Opferritus, in dem Atreus seine Neffen ermordet, stehen im Zentrum der Betrachtung. Es werden Aspekte der Ästhetik der Brutalität, der Perspektivwechsel vom Opfer- zum Täterblick und die Rolle der ¿vάpyɛta in der Darstellung des Schrecklichen diskutiert.
- Die Ästhetik des Schrecklichen in Lukrez' De rerum natura: Dieses Kapitel analysiert Lukrez' Lehrgedicht De rerum natura, wobei die Pestschilderung am Ende des sechsten Buches im Mittelpunkt steht. Es werden die Darstellung des Schrecklichen durch die Verletzung der menschlichen Körperintegrität, die Verbildlichung des Ekels und die Verbindung von Ekel und Panik zum Zwecke der Vermittlung epikureischer Philosophie untersucht.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Themenfelder der Arbeit sind: Ästhetik des Schrecklichen, Brutalität, Ekel, Grenzüberschreitung, Senecas Thyestes, Lukrez' De rerum natura, Stoa, Epikureismus, philosophische Belehrung, Rhetorik, Stilistik.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter der „Ästhetik des Schrecklichen“?
Es ist ein literarisches Konzept, bei dem Grausamkeit, Ekel oder Brutalität künstlerisch so gestaltet werden, dass sie eine rhetorische oder philosophische Botschaft vermitteln.
Wie nutzt Seneca das Schreckliche in seinem Drama „Thyestes“?
Seneca schildert einen brutalen Opferritus, um die Negation stoischer Prinzipien (wie Affektfreiheit) darzustellen und die zerstörerische Kraft der Rache aufzuzeigen.
Warum beschreibt Lukrez die Pest so detailliert in „De rerum natura“?
Die eklige Darstellung der Epidemie dient als Nährboden für die epikureische Philosophie, indem sie die Verletzlichkeit des Körpers und die Notwendigkeit geistiger Ruhe betont.
Was bedeutet der Begriff „Enargeia“ (Evidenz)?
Enargeia bezeichnet die rhetorische Methode, Ereignisse so lebendig und detailliert zu schildern, dass sie dem Leser wie vor Augen stehend erscheinen, was den Schrecken intensiviert.
Inwiefern trägt die Ästhetik des Schrecklichen zur philosophischen Belehrung bei?
Die Arbeit zeigt auf, dass der Exzess und die Grenzüberschreitung in den Texten dazu dienen, den Leser emotional aufzurütteln und philosophische Wahrheiten (Stoa/Epikureismus) zu verdeutlichen.
- Arbeit zitieren
- Markus Thomas Hörty (Autor:in), 2018, Die Ästhetik des Schrecklichen in Senecas Thyestes und Lukrez‘ Pestbeschreibung aus De rerum natura VI, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1215196