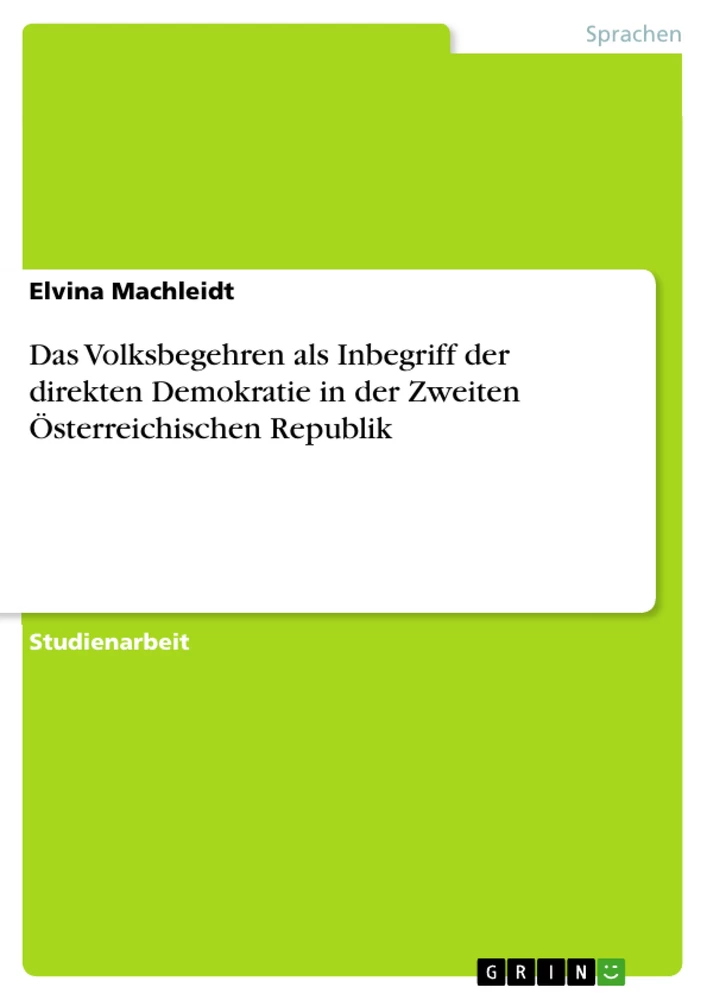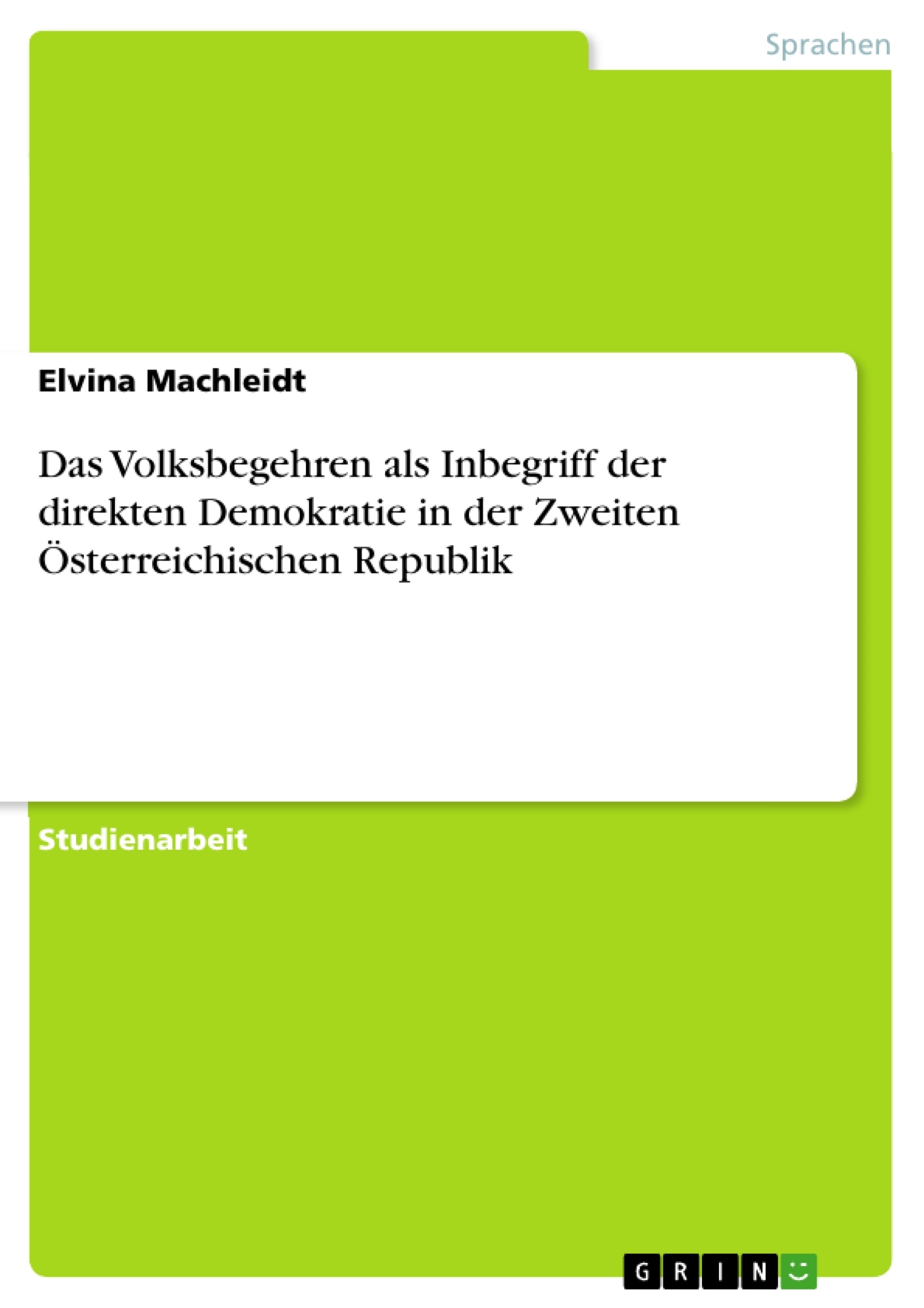Einem wesentlichen direktdemokratischen Verfahren, nämlich dem in seiner politischen Bedeutung hoch im Kurs stehenden Volksbegehren, widmet sich die vorliegende Arbeit vordergründig mit dem Anspruch, zu eruieren, wie sich die Beschaffenheit und Ausgestaltung der direkten Demokratie im historischen Verlauf der Zweiten Österreichischen Republik verändert haben.
Eng mit dieser Frage steht auch die Diskussion darüber in Verbindung, welchen gesellschaftspolitischen Stellenwert das Volksbegehren als wichtiges Instrument der direkten Demokratie mittlerweile erlangt hat und wie sich dieser seit Beginn der Zweiten Republik verändert hat. In Hinblick auf die mindestens genauso bedeutende Thematik linguistischer
Inklusionsprozesse, sprich gezielter Einbeziehung von (offiziell anerkannten) Minderheitensprachen, geht diese Untersuchung auch der Frage nach, inwieweit Aufrufe zur bürgerlichen Partizipation mittels anlassbezogener Inanspruchnahme direktdemokratischer Mitbestimmungsrechte ausschließlich in der ‚Staatssprache‘ Deutsch erfolgen und die Volksbegehren selbst lediglich monolingual durchgeführt wurden und werden. Angesichts zahlreicher gesellschaftlich anerkannter und auch gesetzlich geschützter Minderheiten(-rechte) wird im Rahmen der Arbeit auch analysiert, ob und inwiefern die zu diesen Minderheiten gehörenden Sprachen im Zuge direktdemokratischer Vorgänge in ausreichendem bzw. angemessenem Maße berücksichtigt werden. Abgerundet wird die Analyse mit einer kurzen Diskussion darüber, wie es der direkten Demokratie gelingen kann, eine markante Ergänzung zum System der repräsentativen Demokratie zu bilden, ohne diese letztlich auszuhebeln.
"Demokratie [wird] heute vielfach als sehr abstrakte Angelegenheit betrachtet, deren konkreter Stellenwert im gesellschaftlichen Entwicklungsprozess kaum noch reflektiert wird (…); [v]ielfach wird die Frage gestellt, wieweit die traditionellen Einrichtungen der politischen Demokratie heute noch echte Beteiligungschancen sichern."
Angesichts dieser bereits vor etwa dreißig Jahren zutreffenden Feststellung erscheint eine tiefgreifende Debatte über die Möglichkeiten einer sinnvollen Ergänzung der repräsentativen Demokratie durch direktdemokratische Elemente ebenso sinnvoll wie notwendig.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Fragestellungen
- 2. Methodische Vorgehensweise & Aufbau der Arbeit
- 3. Direkte Demokratie & Volksbegehren: Eine begriffliche Einordnung
- 4. Der historische Wandel des Volksbegehrens in der Zweiten Republik
- 5. Exkurs: Ein kurzes Für und Wider der direkten Demokratie
- 6. Die Einbeziehung anerkannter Minderheiten (-sprachen)
- 7. Die Schweiz als Musterbeispiel für gelungene direkte Demokratie?
- 8. Zusammenfassung und abschließende Bemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Seminararbeit zielt darauf ab, den historischen Wandel des Volksbegehrens in der Zweiten Österreichischen Republik zu analysieren. Insbesondere untersucht sie die Entwicklung der direkten Demokratie im Kontext der Einbeziehung von Minderheitensprachen und hinterfragt deren Stellenwert als Instrument der politischen Partizipation.
- Historische Entwicklung des Volksbegehrens in Österreich
- Direkte Demokratie als Ergänzung zur repräsentativen Demokratie
- Bedeutung des Volksbegehrens für die politische Partizipation
- Einbeziehung von Minderheitensprachen in direktdemokratischen Verfahren
- Komparativer Blick auf die Schweiz als Modell für direkte Demokratie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Forschungsfragen und den Aufbau der Arbeit erläutert. Kapitel 3 befasst sich mit der begrifflichen Einordnung der "direkten Demokratie" und des "Volksbegehrens". Kapitel 4 beleuchtet den historischen Wandel des Volksbegehrens in der Zweiten Republik. Kapitel 5 bietet einen Exkurs zu den Vor- und Nachteilen der direkten Demokratie. Kapitel 6 analysiert die Einbeziehung von Minderheitensprachen in Volksbegehren und stellt die Frage nach ihrer ausreichenden Berücksichtigung. Kapitel 7 widmet sich der Schweiz als Musterbeispiel für gelungene direkte Demokratie. Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung und abschließenden Bemerkungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen "direkte Demokratie", "Volksbegehren", "historische Entwicklung", "politische Partizipation", "Minderheitensprachen", "Inklusion", "Repräsentation", "Schweiz" und "komparative Analyse".
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Volksbegehren in Österreich?
Ein Volksbegehren ist ein Instrument der direkten Demokratie, mit dem Bürger ein Gesetzgebungsverfahren im Nationalrat einleiten können.
Werden Minderheitensprachen bei Volksbegehren berücksichtigt?
Die Arbeit analysiert kritisch, ob Aufrufe zur Partizipation und die Durchführung von Volksbegehren lediglich monolingual (Deutsch) oder auch in anerkannten Minderheitensprachen erfolgen.
Wie hat sich das Volksbegehren in der Zweiten Republik gewandelt?
Die Untersuchung zeigt den historischen Wandel von einem selten genutzten Instrument hin zu einem wichtigen Mittel der gesellschaftspolitischen Artikulation.
Dient die direkte Demokratie als Ersatz für das Parlament?
Nein, sie wird als markante Ergänzung zur repräsentativen Demokratie verstanden, die Beteiligungschancen sichern soll, ohne das System auszuhebeln.
Warum wird die Schweiz in der Arbeit erwähnt?
Die Schweiz dient als komparatives Musterbeispiel für eine stark ausgeprägte und funktionierende direkte Demokratie.
Was ist das Ziel linguistischer Inklusionsprozesse?
Es geht um die gezielte Einbeziehung von Menschen mit anderen Erstsprachen in den demokratischen Prozess, um echte Teilhabe zu ermöglichen.
- Quote paper
- Elvina Machleidt (Author), 2019, Das Volksbegehren als Inbegriff der direkten Demokratie in der Zweiten Österreichischen Republik. Eine Analyse der historischen Entwicklung politischer Beteiligungsprozesse mit Fokus auf Minderheitensprachen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1215350